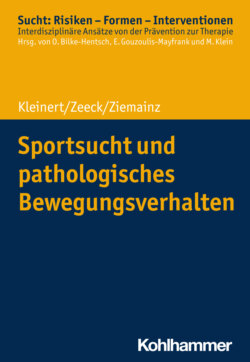Читать книгу Sportsucht und pathologisches Bewegungsverhalten - Jens Kleinert - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.4 Primäre und sekundäre Sportsucht
ОглавлениеDie bislang diskutierten Zahlen zur Prävalenz der Sportsucht unterscheiden nicht zwischen primärer und sekundärer Sportsucht. Eine solche Unterscheidung (die auch bei anderen Suchtformen vorgenommen wird) ist nicht nur aus ätiologischer, sondern auch aus epidemiologischer Sicht bedeutsam. Von sekundärer Sportsucht wird gesprochen, wenn sich das auffällige Sport- und Bewegungsverhalten erst in Folge oder als Begleiterscheinung einer anderen klinischen Störung ergibt (wie z. B. Essstörungen, Körperbildstörungen oder der Zwangsstörung; Brewerton et al. 1995, Davis und Kaptein 2006, Gulker et al. 2001, Kleinert 2014). Im Rahmen solcher Störungsbilder wird von den Betroffenen Sport und Bewegung häufig instrumentalisiert, um entweder mit der Grundstörung zurecht zu kommen (d. h. zur Kompensation) oder die Grundstörung ausleben zu können (d. h. zur Realisation; Kap. 5.1). In diesen Fällen einer sekundären Sportsucht liegt dann zwar der Symptomkomplex der Sportsucht vor, allerdings steckt das eigentliche und ursächliche klinisch-psychische Problem nicht im Sport- und Bewegungsverhalten selbst. Demgegenüber wird von primärer Sportsucht gesprochen, wenn sich das auffällige Verhalten im Sporttreiben selbst bzw. in der Auseinandersetzung mit dem Sport selbst entwickelt (Kleinert 2014).
Diese Einteilung in eine primäre und sekundäre Sportsucht wird von einigen Autoren unterstützt (Breuer und Kleinert 2009; Freimuth et al. 2011; Kleinert 2014; Veale 1995), wenngleich sie auch nicht kritiklos bleibt (Keski-Rahkonen 2001; Zeeck und Schlegel 2012). Insbesondere ist in der Praxis ätiologisch nicht immer nachweisbar, welche der bestehenden Störungsbilder ursprünglich entscheidend war, zum Beispiel ob die Essstörung zu einem sportsüchtigen Verhalten oder die Sportsucht zu einem essgestörtem Verhalten geführt hat (»Henne-Ei-Problem«). Gleichzeitig weisen jedoch Untersuchungen darauf hin, dass Sportsüchtige ohne Vorliegen anderer Störungen (d. h. eindeutig primär Sportsüchtige) eine andere Motivationsstruktur (Blaydon et al. 2002) und auch in anderen Merkmalen (Freimuth et al. 2011) Unterschiede zu vermutlich sekundär Sportsüchtigen zeigen. In der epidemiologischen Betrachtung wäre die Unterscheidung einer primären und einer sekundären Sportsucht deshalb wichtig, da allein die starke Verbindung von Essstörungen und auffälligem Sport- und Bewegungsverhalten (Davis und Kaptein 2006) die Prävalenz der Sportsucht überwiegend erklärt. Oder anders: Sportsüchtige, die kein auffallendes Essverhalten zeigen, sind einerseits relativ selten, andererseits ein Hinweis darauf, dass Sportsucht nicht allein als sekundäre Erscheinung, also als Konsequenz einer anderer Störung auftritt.
Die primäre Sportsucht, das heißt das krankhafte Sport- und Bewegungsverhalten ohne vorhergehende andere psychische Auffälligkeiten, ist jedoch vermutlich selten (Szabo 2000; Terry et al. 2004; Veale 1995). Breuer und Kleinert (2009) leiten aus den vorliegenden Zahlen und Untersuchungsbedingungen ab, dass die primäre Sportsucht je nach Krankheitsgrad (und zugrundeliegendem Instrument) bei Sportlern eine Lebenszeitprävalenz von 0,1–1 % hat. Zugleich lässt sich also sagen, dass die reine Form der Sportsucht, also ohne Begleitstörungen wie zum Beispiel Ess-, Körper- oder Zwangsstörung, eher die Ausnahme ist. Die Prävalenz der sekundären Sportsucht ist deutlich höher, was daran liegt, dass bestimmte Störungsbilder sehr häufig mit Anzeichen einer Sportsucht einhergehen. Nach Zeeck und Schlegel (2012) zeigen beispielsweise 40–70 % der Menschen mit Essstörungen auffälliges Sportverhalten. Demnach besitzen sehr wahrscheinlich die meisten sportsuchtauffälligen Patienten in der Praxis eine sekundäre Symptomatik in Folge oder im Zusammenhang mit einer grundlegenden Essstörung ( Kap. 4.3). Die reine, primäre Sportsucht bleibt die Ausnahme (Breuer und Kleinert 2009).