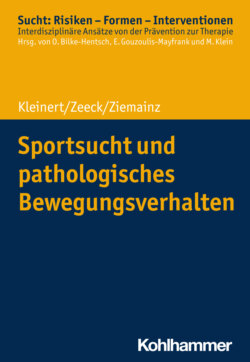Читать книгу Sportsucht und pathologisches Bewegungsverhalten - Jens Kleinert - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.2 Prävalenz der Sportsucht bei Sporttreibenden
ОглавлениеDie geschilderten Probleme der eindeutigen Diagnostik von Sportsucht und der Ableitung von epidemiologischen Daten müssen nicht zwingend dazu führen, dass Forschungsdaten zur Häufigkeit von Sportsucht nicht berücksichtigt werden können. Stattdessen ist es wichtiger, diese Informationen richtig einzuordnen. Entsprechend empfehlen die Entwickler derartiger Forschungsfragebögen selbst, die Ergebnisse eher als symptomatische Hinweise oder Risikoeinschätzungen und nicht als Diagnosen zu bewerten (Hausenblas und Symons Downs 2002b; Terry et al. 2004). Ein weiteres, ermutigendes Indiz für die Verwendbarkeit der Daten ist auch, dass die Daten aus unterschiedlichen Instrumenten zu vergleichbaren Ergebnissen führen (Egorov und Szabo 2013). Es kann also davon ausgegangen werden, dass Hinweise zur Häufigkeit und zum Auftreten von Sportsucht, die mit den bestehenden Instrumenten erbracht wurden, zumindest eine gute Schätzung darstellen (Sussman et al. 2011b). Trotz dieser Güte bleibt die fehlende Eignung vieler Instrumente für eine abschließende Einzeldiagnostik bestehen ( Kap. 6.2).
Die gute Schätzung der epidemiologischen Situation aus Forschungsdaten gilt vor allem für die zwei bekanntesten Fragebogeninstrumente, nämlich die »Exercise Dependence Scale« (EDS; Hausenblas und Symons Downs 2002b; deutsch: Zeeck et al. 2013) und das »Exercise Addiction Inventory« (EAI; Terry et al. 2004; deutsch: Ziemainz et al. 2013). Beide Instrumente sind hinsichtlich wichtiger Gütekriterien (z. B. Sensitivität, Reliabilität) ähnlich (Mónok et al. 2012; Kap. 6.1.1). In der Übersichtsarbeit von Egorov und Szabo (2013) werden 23 Studien aufgeführt, von denen sechs Studien den EDS und fünf Studien den EAI verwendet haben. In diesen 23 Studien wurden ausschließlich Sporttreibende befragt. Die Häufigkeiten von auffälligen Werten (d. h. stark erhöhtes Risiko für Sportsucht) unterscheidet sich zwischen den aufgeführten Studien sehr stark und rangiert zwischen 1,8 % und 77 % (Median 8,25 %; Abb. 3.1). Andere Übersichtsarbeiten bestätigen diese großen Streuungen und Unterschiede (Landolfi 2013).
Zwischen den beiden Hauptinstrumenten (EDS, EAI) zeigten sich in der Übersichtsarbeit von Egorov und Szabo (2013) keine bedeutsamen Unterschiede: Studien, die den EDS verwendeten, schwanken zumeist zwischen 1,8 % und 6,6 % (ein Ausreißer mit 50 %), während Studien unter Verwendung des EAI zwischen 1,8 % und 8,5 % schwanken (zwei Ausreißer mit 19,9 % und 29,6 %). Auffallend ist, dass von den elf Studien, die andere Fragebögen verwendeten, nur vier unter 10 % lagen (Mittel = 26 %). Dies könnte darauf hinweisen, dass Studien mit anderen Fragebögen als dem EDS oder dem EAI die Häufigkeit von Sportsucht (deutlich) überschätzen.
Abb. 3.1: Häufigkeit auffälliger Werte (d. h. stark erhöhtes Risiko für Sportsucht auf der Basis vorgegebener Empfehlungen) in verschiedenen Forschungsarbeiten zur Sportsucht (Daten aus Egorov und Szabo 2013)
Noch größer als der Einfluss des benutzten Fragebogens ist vermutlich die Wahl der befragten Gruppe. Je nachdem, welche Sportart, welche Population oder welcher Aktivitätssektor befragt wird, unterscheidet sich die gemessene Häufigkeit zum Zeitpunkt der Befragung (Punktprävalenz) starkt. Dies wird anhand der Daten in der Übersichtsarbeit von Egorov und Szabo (2013) deutlich: Wenn in den Studien (Sport-)Studierende befragt wurden (sieben Studien), ergab sich eine mittlere Häufigkeit von 6 % auffälligen Personen (3–15 %), bei Fitnesssportlern (ebenfalls sieben Studien) ergab sich eine mittlere Häufigkeit von 23 % (2–41 %) auffälligen Datensätzen und bei Befragung von Läufern oder Triathleten (auch sieben Studien) ergaben sich im Mittel in 35 % (3–77 %) der Fälle auffällige Daten. Wenn diese Daten auch vorerst einen beschreibenden (und keinen metaanalytischen) Charakter haben, so wird doch der große Unterschied zwischen den Prävalenzen der verschiedenen Befragungsgruppen deutlich. Zugleich scheint sich die häufige Annahme zu bestätigen, dass bestimmte Sportarten (z. B. Ausdauersport) ein höheres Risikoprofil beinhalten als andere. Außerdem liegt die Vermutung nahe, dass auch im Fitnesssport nicht selten eine Zwangsorientierung und hiermit verbunden ein gewisses Abhängigkeitspotenzial vorliegt. Trotz allem fallen auch innerhalb dieser unterschiedlichen drei Populationen die extrem hohen Streuungen auf, was darauf verweisen könnte, dass weitere Kriterien (z. B. Leistungsstärke, Erhebungsinstrument) eine bedeutsame Rolle für die Prävalenz spielen. Diese unterschiedlichen Einflusskriterien auf die Prävalenz wurden jedoch bislang nicht systematisch untersucht. Das heißt, es liegen keine repräsentativen und vor allem metaanalytischen Arbeiten vor, in denen die naheliegenden Faktoren Alter, Geschlecht, Leistungsstärke, Sportart, Untersuchungsmethode systematisch in Bezug auf ihren statistischen Einfluss auf die Prävalenzrate untersucht wurden.
Die Schätzungen und Vermutungen vieler Forscherinnen und Forscher sind jedoch bislang nicht widerlegt und können weiterhin angenommen werden. Im Sport insgesamt kann von (niedrig) einstelligen Prävalenzen für ein hohes Sportsuchtrisiko ausgegangen werden (mit starken Streuungen zwischen Sportarten) (Hausenblas und Symons Downs 2002a; Griffiths et al. 2005). Auch im deutschsprachigen Raum lassen sich diese Zahlen bestätigen (Zeeck et al. 2013; Ziemainz et al. 2013).