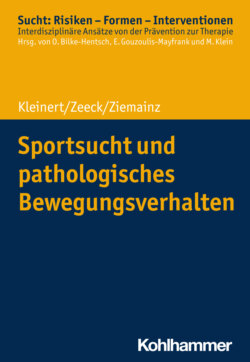Читать книгу Sportsucht und pathologisches Bewegungsverhalten - Jens Kleinert - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2.3 Non-Intentionalität
ОглавлениеNach Hausenblas und Symons Downs (2002a) umschreiben »intention effects« die Tatsache, dass die Betroffenen länger, umfangreicher oder intensiver Sport treiben, als sie dies eigentlich beabsichtigten (d. h. »intendierten«). Offensichtlich fehlt Sportsüchtigen die Fähigkeit, ihr Verhalten willentlich zu steuern (Freimuth et al. 2011). Oder anders: Die Steuerung des Verhaltens ist stattdessen gefühlsbetont (»Affektregulation«). Ziel dieser Verhaltenssteuerung ist es somit, positiven Affekt zu erlangen (reward craving), also zum Beispiel eine euphorisierende Wirkung zu erreichen (was häufig mit subjektiv »Kick« oder »Adrenalinschub« bezeichnet wird). Um derartige Gefühle zu erlangen, können die Aktivitäten weit über das hinausgehen, was eigentlich geplant war. Ebenso gefühlsbetont und ähnlich non-intentional ist es, wenn die Betroffenen durch die körperliche Aktivität negative Affekte (bzw. Entzugssymptome) lindern (s. oben »relief craving«) oder das Auftreten von negativem Affekt »prophylaktisch« verhindern wollen.