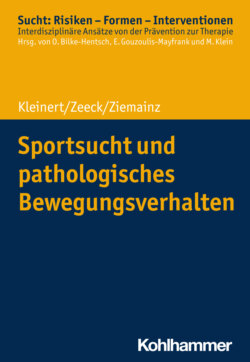Читать книгу Sportsucht und pathologisches Bewegungsverhalten - Jens Kleinert - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3 Prävalenz der Sportsucht in der Gesamtbevölkerung
ОглавлениеIm Vergleich zu den geschilderten Zahlen ist bezogen auf die Gesamtbevölkerung naturgemäß von deutlich geringeren Prävalenzraten auszugehen (Szabo 2000; Terry et al. 2004; Veale 1995). Allerdings sind Studien, in denen das Merkmal Sportsucht in der Gesamtbevölkerung erfasst wird, sehr selten. Einerseits scheint dies nachvollziehbar, da Sportsucht nur bei zumindest regelmäßiger Sportaktivität ein sinnvolles Krankheitsmerkmal ist. Andererseits würden Studien in der Gesamtbevölkerung erfassen, wie hoch das Risiko bei jeglicher Form von Sportaktivität ist (im Unterschied zu den stark selektiven Stichproben der meisten bestehenden Untersuchungen). Auch die Lebenszeitprävalenz ließe sich nur durch Studien in der Gesamtbevölkerung erheben (erfasst werden in den Studien überwiegend Punktprävalenzen).
Eine der wenigen repräsentativen Studien in dieser Richtung wurde an der ungarischen Bevölkerung durchgeführt. Mónok et al. (2012) untersuchten einen Datensatz von 3183 Ungarn zwischen 18 and 64 Jahren. Von diesen äußerten 474 (also 14,9 %), zumindest einmal pro Woche regelmäßig sportaktiv zu sein. In dieser Studie zeigte sich je nach Befragungsinstrument ein Anteil von 1,9 % auffälliger Daten (bei Verwendung des EDS) bzw. 3,2 % auffälliger Personen (Verwendung des EAI). Bezogen auf die Gesamtbevölkerung ergibt dies eine (Risiko-)Prävalenz von 0,3 % bzw. 0,5 %. Diese Zahlen zeigen einerseits, dass die Rate an auffälligen Sporttreibenden insgesamt vermutlich eher an der Untergrenze der vorliegenden Angaben in bestehenden Studien liegt ( Abb. 3.1), oder anders: die Studien berücksichtigen vermutlich überwiegend Problemgruppen, die eine höhere Risikoprävalenz besitzen. Andererseits erscheint eine Prävalenz von 2–3 % relativ hoch, was allerdings stark relativiert werden muss, denn diese Prävalenz bezeichnet, wie zuvor diskutiert, lediglich das Risiko, nicht aber das Vorliegen einer Sportsucht. Je nach Spezifität und Sensitivität der Fragebögen (also je nach Umfang falsch-positiver Werte; Kap. 6.1) liegt die tatsächliche Prävalenz vermutlich deutlich niedriger. Entsprechend zeigten Müller et al. (2014), dass sich nur jeder zweite Verdacht auf eine Sportsucht (erfasst anhand des deutschsprachigen EDS) mittels eines diagnostischen Interviews bestätigen lässt.