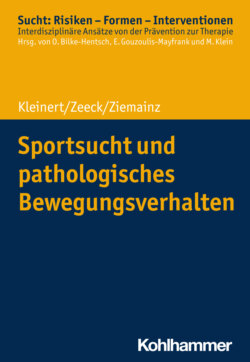Читать книгу Sportsucht und pathologisches Bewegungsverhalten - Jens Kleinert - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1 Einführung Jens Kleinert, Almut Zeeck und Heiko Ziemainz
ОглавлениеHerr W. (24) wird an eine psychosomatische Ambulanz verwiesen. Seine körperliche Verfassung ist bedenklich. Auffallend sind schlechte Stoffwechselwerte, seine Fußsohlen sind teilweise blutig, sein Puls ist kritisch niedrig (< 30 Schläge/Min.), sein Körpergewicht liegt bei einem BMI von 19 kg/m2.
In der Anamnese zeigt sich, dass Herr W. ein Lauftraining von durchschnittlich 100 km pro Woche durchführt. Als er wegen einer Ermüdungsfraktur das Lauftraining unterbrechen musste, kam es zu einer depressiven Krise. In dieser Zeit hatte er Angst zuzunehmen, und sein BMI sank auf 17,0 kg/m2.
Freunde habe er eigentlich nie gehabt, vermisse sie auch nicht. Das Laufen sei für ihn der einzige Weg, mit Konflikten und Anspannung umzugehen. Die Sorgen der Ärzte verstehe er nicht wirklich. Eigentlich ginge es ihm soweit gut. Er wolle weiter trainieren. Das Laufen sei das einzige, was er habe.
Vieles in diesem Fallbeispiel wirkt zweifellos »unnormal« oder »krankhaft«. Sporttreiben ist für Herrn W. offensichtlich etwas Zwanghaftes, nicht Kontrollierbares. Er treibt Sport, obwohl er sich selbst hierdurch Schaden zufügt – körperlich, psychisch und vermutlich auch sozial. Dieses Zusammentreffen von Selbstschädigung, exzessivem Ausmaß von Sportaktivität und fehlender Kontrolle des eigenen Verhaltens legen den Verdacht auf eine Sportsucht nahe.
Das Phänomen Sportsucht geht geschichtlich auf eine Studie aus dem Jahr 1970 zurück: Baekeland (1970) beobachtete im Rahmen einer eigenen Untersuchung, dass einzelne Probanden selbst durch Geld nicht dazu zu bewegen waren, ihr Sporttreiben für eine bestimmte Zeit aufzuhören. Er vermutete einen suchtartigen Hintergrund. Seitdem wurden eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die Sportsucht näher beschrieben haben und ihre Bedingungen analysierten (s. die Übersichtsarbeiten von Adams und Kirkby 2002, Adams et al. 2003, Allegre et al. 2006, Breuer und Kleinert 2009, De Coverley Veale 1987, Hausenblas und Symons Downs 2002a, Kleinert 2014).
Anfangs haben sich Untersuchungen zur Sportsucht auf extreme Ausdaueraktivitäten (z. B. Laufen, Schwimmen, Radfahren) beschränkt. Suchtartiges Verhalten kann jedoch im Grunde bei jeder Form von Bewegungsaktivität entstehen, beispielsweise im Fitnesstraining oder Erlebnisbereich, weswegen wir in diesem Buch neben Sportsucht auch von suchtartigem Bewegungsverhalten sprechen.
Mit dem vorliegenden Buch wollen wir den aktuellen Stand zum Thema Sportsucht aufbereiten. Dies betrifft insbesondere begriffliche Fragen (z. B. Definitionen; Kap. 2), aber auch Fragen der Häufigkeit des Auftretens ( Kap. 3). Weiterhin werden typische Felder für das Auftreten von Sportsucht (z. B. Ausdauersport, Fitnesssport) sowie Zusammenhänge mit anderen Störungsbildern (z. B. Essstörungen, Muskeldysmorphie) erläutert ( Kap. 4). Nach einer Darstellung von pathogenetischen Modellen und Entstehungsbedingungen ( Kap. 5) werden abschließend diagnostische ( Kap. 6) und präventive sowie therapeutische Ansätze ( Kap. 7) besprochen.
Dieses Buch soll aber auch verdeutlichen, in welcher Form sich Sportsucht oder suchtartiges Bewegungsverhalten von einer gesunden, für die persönliche Entwicklung positiven Bewegungs- und Sportaktivität unterscheidet. Denn unter dem Strich bleiben Sport und Bewegung etwas, was entscheidende und positive Effekte für die psychische Gesundheit (Biddle und Asare 2011), für die Therapie und Rehabilitation körperlicher Erkrankungen (Rost 2005) und auch im Falle von psychischen Erkrankungen (Hölter 2011) hat.