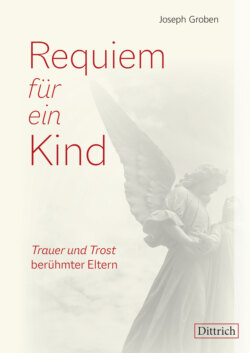Читать книгу Requiem für ein Kind - Joseph Groben - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Kindertod – eine Gnade für die unsterbliche Seele
ОглавлениеIm letzten Teil seines Trostschreibens beruft sich Plutarch auf ihren gemeinsamen Glauben an die Unsterblichkeit. Dieser Glaube wird von vielen Zeitgenossen nicht geteilt, die überzeugt sind, dass mit der »Auflösung des Körpers« alles definitiv zu Ende ist. Timoxena und er werden von diesem Unglauben bewahrt »durch die von den Vätern überlieferte Lehre und die mystischen Sinnbilder der orgiastischen Dionysoszeremonien – die uns beiden als Eingeweihten bekannt sind.« Dank dieser religiösen Zuversicht kann Plutarch so weit gehen, zu behaupten, dass der frühe Tod für die unsterbliche Seele einen unzweifelhaften Vorteil darstelle. Wer lange lebt, verwickelt sich in »irdische Leidenschaften und Zufälle«, das Leben »entfremdet die Seele der Erinnerung an die jenseitigen Dinge und fesselt sie an die diesseitigen Dinge. … Diejenige Seele dagegen, welche zwar auch an den Körper gefesselt, aber nur kurze Zeit mit ihm verbunden war, wird von den höheren Geistern befreit und gelangt gleichsam durch eine sanfte und geschmeidige Umbiegung wieder in ihren natürlichen Zustand zurück.«
Plutarch belegt die Richtigkeit seiner Überzeugung durch die überlieferten Gewohnheiten und Gesetze. Wenn Kinder sterben, bringt man ihnen keine Totenopfer dar, man unterlässt die meisten Handlungen, die beim Begräbnis eines Erwachsenen üblich sind. Die Kinder nämlich hatten »noch keine Gemeinschaft mit der Erde und den irdischen Dingen«, infolge ihrer Unschuld kehren sie sofort zu ihrem göttlichen Ursprung zurück. Trauer ist also nicht angebracht, wenigstens nicht für den Gläubigen:
»Denn die Gesetze gestatten nicht, Tote von solchem Alter zu betrauern, weil dies bei solchen, welche in einen besseren und göttlicheren Zustand und Ort übergehen, nicht recht wäre. Ich weiß freilich wohl, dass diese Sache viele Schwierigkeiten bietet; weil aber der Unglaube noch mehr Schwierigkeiten macht als der Glaube daran, so wollen wir das Äußerliche dabei, wie es die Gesetze vorschreiben, beobachten, das Innerliche aber noch viel mehr unbefleckt und rein und leidenschaftslos erhalten.«
Der Brief scheint nicht vollständig erhalten zu sein, dennoch ist er reich genug, um wichtige Aufschlüsse über die Haltung der antiken Gebildeten dem Kindertod gegenüber zu vermitteln. Er verrät, neben seiner tiefen Menschlichkeit, eine Erhabenheit der Gedankenführung, die das Klischee einer dekadenten heidnischen Welt Lüge zu strafen scheint. Als Priester des Apollo in Delphi glaubt Plutarch zweifellos an die Wahrheit der Orakel. Sie wird ihm bescheinigt durch die geistige und materielle Wiedergeburt des Apolloheiligtums. In seinem Dialog »Über die Orakel der Pythia« beschreibt er den rezenten Aufschwung Delphis, der beispiellos seit tausend Jahren sei, und schlussfolgert: »Es ist nicht möglich, dass eine so vollständige Veränderung in so kurzer Zeit allein durch Menschenhand sich ereignet hat, ohne die Gegenwart eines Gottes, der dem Orakel seine göttliche Autorität verleiht.«
Bezeichnend für diesen hochgebildeten und toleranten Philosophen ist auch, dass er Dionysos mit der ägyptischen Gottheit Osiris und mit dem Gott der Juden identifiziert und den gemeinsamen Jenseitsglauben unterstreicht. Infolge dieses erstaunlichen Gedankengutes, das sich hauptsächlich aus dem Platonismus speist, glaubten manche Kirchenväter, in Plutarch einen Vorläufer des Christentums zu erkennen. So wurden seine Texte in großer Zahl überliefert und konnten eine starke Nachwirkung ausüben.
1929 schrieb Carl J. Burckhardt an Hugo von Hofmannsthal: »Plutarch: die ganze virtù von der Renaissance bis zum napoleonischen Epos ist durch ihn bestimmt, und er wirkt noch weit ins 19. Jahrhundert hinein, bei den Engländern, den Preußen. Er ist eine eminent europäische Kraft.«
Friedrich Dübner: Plutarchi Chaeronensis scripta moralia. Berlin 1841.
Robert Flaceliere/Jean Irigoin: Plutarque. Oeuvres morales. Paris 1987.
Richard Volksmann: Leben, Schriften und Philosophie des Plutarch von Chaeronea. Berlin 1869
Reprint: Hildesheim 1980.