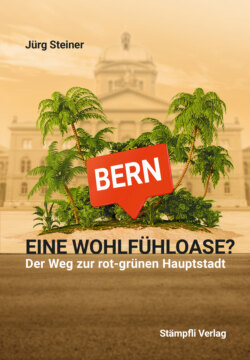Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stadt des Lichterlöschens
ОглавлениеDie klaren Feindbilder aus dem eben erst beendeten Kalten Krieg klebten auch Anfang der neunziger Jahre schwer an Bern. Sich auf die Treppe der Heiliggeistkirche zu setzen, war eine kleine Provokation. Wer in einer WG lebte, den umwehte den Hauch des Staatsfeinds, weil man es damit vielleicht beim Nachrichtendienst auf eine Fiche geschafft hatte. Demonstrationen arteten regelmässig in Tränengasschlachten aus. Der öffentliche Raum war besetzt, aber nicht unbedingt von Menschen. Auf dem Bundesplatz parkierten 95 Autos, die nur für den Wochenmarkt, Staatsempfänge und gelegentliche Demonstrationen verbannt wurden. Autoplantagen belegten auch den Waisenhausplatz und die Schützenmatte. Die Bundesterrasse, die Münsterplattform, die Kleine Schanze waren das Revier von Drogenabhängigen, Alkoholikern und Prostituierten. Und wenn man mit Kindern einen Spielplatz aufsuchte, vergewisserte man sich, dass keine gebrauchten Spritzen im Sandkasten lagen.
Die 24-Stunden-Gesellschaft und ihre frivole Konsuminfrastruktur waren weit entfernt. Der Moonliner etwa, das Nachtbussystem, existierte noch nicht einmal als Idee, wobei ein vollwertiger Ausgang ohnehin meist vor Mitternacht endete. Man sass bei ein paar Bieren im Restaurant Falken an der Münstergasse, bis maximal 22.45 Uhr, und wer es wirklich wissen wollte, schlich danach in die «Glocke» für eine Portion Pouletflügeli und in die Kreissaal-Bar für einen Absacker. Am Wochenende konnte man in die 1968 entstandene Tanzdiele in der Matte oder den Gaskessel. Ansonsten: Lichterlöschen.
Dunkel eingetrübt waren die wirtschaftlichen Aussichten, nicht nur in der Stadt. Im Jahr 1992 ging der Kanton Bern in die Knie wie ein schwer getroffener Boxer. Die Berner Kantonalbank hatte im Kreditgeschäft jahrelang zu viel riskiert, kündigte einen Abschreiber von bis zu 3,5 Milliarden Franken an und erbettelte Staatshilfe vom Kanton. Eine Situation, vergleichbar mit jener Griechenlands während der Euro-Krise. Über zehn Jahre lang engte die Überlebensübung nach dem Kantonalbankdebakel den Spielraum für Investitionen und Innovationen ein und warf Bern weit zurück. Der Kanton sparte, auch auf Kosten der Stadt.
Diese hing ihrerseits in den Seilen: Sie verlor schrittweise rund 40 000 Einwohnerinnen und Einwohner an die steuergünstigen Agglomerationsgemeinden des sogenannten Speckgürtels und fand sich als «A-Stadt» wieder, in der sich Arbeitslose, Abhängige, Alte und Auszubildende konzentrierten. Sie kosteten viel und brachten wenig Steuererträge. Finanziell befand sich die Stadt Bern, zusätzlich gebeutelt durch eine heftige Wirtschaftskrise, im freien Fall. 1992, als die damalige bürgerliche Regierung ihr letztes Budget präsentierte, veranschlagte sie im ersten Anlauf ein horrendes Defizit von 99,6 Millionen Franken, das danach auf vergleichsweise milde 70 Millionen korrigiert wurde.