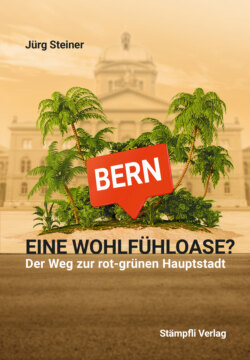Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Politik für Mathematiker
ОглавлениеMan muss ein bisschen rechnen, wenn man die verwinkelte Politik der Stadt Bern verstehen will, denn sie ist wahlrechtlich von zwei Besonderheiten geprägt. Erstens: Bern wählt die Regierung, anders als die meisten anderen Gemeinden, seit 1895 im Proporzverfahren. Gewählt ist also nicht die Person mit den meisten Stimmen, sondern Mandate werden gemäss den erreichten Stimmenanteilen an die Parteien verteilt, ins Amt kommen die Bestgewählten auf deren Listen. Zweitens: Die Gemeindeordnung untersagt Listenverbindungen. Das zwingt die Parteien dazu, Bündnisse zu bilden und Einheitslisten zusammenzustellen, um die Wahlchancen zu optimieren. Je breiter die Koalition, desto besser.
Die beiden Besonderheiten sind der Grund dafür, dass die Parteistrategen alle vier Jahre vor den Wahlen Monate damit verbringen, Wähleranteile zu berechnen und Bündnisverhandlungen zu führen. Man kann Topkandidaten haben und eine formidable Politik machen – es nützt nichts. Ohne Bündnis ist in Bern kein Blumentopf zu gewinnen. Und wenn die Wahlen vorbei sind, besteht die Stadtberner Politik auch darin, minutiös zu überwachen, ob die Gewählten auch ja unter der Fuchtel der Koalition bleiben. Oder ob sie es wagen auszuscheren.
Der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Linken war es an diesem 6. Dezember, sehr gut gerechnet zu haben. Dass die Parteien rechts der Mitte auf getrennten Listen angetreten waren und sich die Stimmen deshalb aufteilten, war der springende Punkt. Der geeinten Rot-Grün-Mitte-Koalition reichte es knapp für vier der sieben Gemeinderatssitze, die Bürgerlichen (FDP, SVP, CVP) verloren einen und wurden auf drei Sitze zurückgestutzt. Die Splittergruppen rechts aussen gingen leer aus.
Ehe Vizestadtschreiber Biancone im Erlacherhof ans Mikrofon trat, musste er dem amtierenden SVP-Gemeinderat und früheren TV-Journalisten Marc-Roland Peter also beibringen, dass er abgewählt worden war. Dies hatte er schon vier Jahre zuvor SP-Gemeinderätin Gret Haller mitteilen müssen. Sie hatte sich im Herbst 1987 offen vom gemeinderätlichen Räumungsbeschluss für das Hüttendorf Zaffaraya distanziert und verpasste im Dezember 1988 die Wiederwahl – um 161 Stimmen. Die SP-Wählerschaft zog ihr den weniger prononcierten Parteikollegen Klaus Baumgartner vor, von dem Hallers Entourage geglaubt hatte, er werde ihr nicht gefährlich.
Ohne die für die SP-Frauen aufwühlende Haller-Abwahl und den Sitzverlust der SP hätte es 1992 den Coup von Rot-Grün-Mitte wohl nicht gegeben. Die Schmach rüttelte die Linken wach. Sie begriffen im dritten Anlauf endlich, wie wichtig Arithmetik in der Stadtberner Politik ist. Bereits 1984 waren sie wegen dieses taktischen Fehlers kläglich gescheitert. Damals erreichte das spätere Rot-Grün-Mitte-Lager sogar 53 Prozent der Stimmen, aber es war auf mehrere Listen aufgeteilt. Deshalb blieb die Linke bei drei Sitzen stehen. Das bürgerliche Dreigestirn FDP-SVP-CVP hingegen hatte sich zu einer Einheitsliste mit dem Namen «Vierer mit» zusammengeschlossen. Der Begriff war der Rudersprache entlehnt und meinte die Regierungsmehrheit von vier Sitzen inklusive Stadtpräsidium. Der «Vierer mit»-Liste genügten 39 Prozent der Wählerstimmen zur Eroberung der Regierungsmehrheit.
Auch 1988 machte das zersplitterte Parteienspektrum links der Mitte zusammengerechnet 48,2 Prozent der Stimmen. Weil die Bürgerlichen aber geschlossen im «Vierer mit» ruderten, konsolidierte sich die bürgerliche Formel für den Stadtberner Gemeinderat: Die FDP besetzte zwei Sitze, CVP und SVP je einen. Die linke Minderheit setzte sich aus zwei SP-Männern (Klaus Baumgartner, Alfred Neukomm) sowie einer Vertreterin des linksliberalen Jungen Bern (Joy Matter) zusammen.