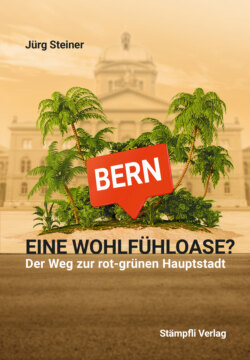Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Persönliches Vorwort
ОглавлениеAls ich an einem Februartag im Jahr 1992 zum ersten Mal bewusst den rot-grünen Mikrokosmos der Stadt Bern betrat, war es düster, es roch feucht, die Dielen knarrten. Ich, ein junger Journalist mit spriessendem Kopfhaar und runder Brille, arbeitete auf der Stadt-Redaktion der «Berner Zeitung» und suchte zusammen mit meiner Kollegin Brigitte Zingg, die später Auslandsredaktorin bei Radio SRF wurde, ein schon damals baufällig wirkendes Haus an der Neubrückstrasse 17 auf. Es lag vis-à-vis der Reitschule beim Henkerbrünnli, ein paar Schritte von der Dead-End-Bar entfernt, mitten in Berns Bermudadreieck.
Der gemeinsame Sekretariatssitz der Feministinnen und Trotzkisten des Grünen Bündnisses und der Militärabschaffer der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) war ein latent staatszersetzender Ort. Für brave Journalisten der bürgerlichen «Berner Zeitung» ein heikles, wenn nicht sogar karrieregefährdendes Terrain. Dafür brauchte es nicht viel, wie mir eine kleine Episode kurz zuvor gezeigt hatte. Nach dem Besuch einer Versammlung der braven Mitte-links-Partei Junges Bern/Freie Liste (JBFL), die heute Grüne Freie Liste (GFL) heisst und den Stadtpräsidenten stellt, schrieb ich einen kurzen Artikel im Berichterstattungsstil irgendwo unten auf einer Zeitungsseite. Niemand nahm diesen Text wirklich zur Kenntnis, ausser Beat Hurni, damals Chefredaktor der «Berner Zeitung». Er bestellte mich sofort in sein Büro und warf mir an diesem Beispiel eine linke Unterwanderungstendenz vor, die ich umgehend zu unterlassen habe.
Mit dem Gefühl im Nacken, zu links zu sein, trafen also Brigitte Zingg und ich an der Neubrückstrasse 17 ein und befragten den Politologen Werner Seitz. Dieser legte staubtrocken seinen Umsturzplan offen, den er für das neue Bündnis der Rot-Grün-Mitte-Parteien der Stadt Bern errechnet hatte. So richtig glaubte ich dem Statistiker Seitz natürlich nicht.
Monate später, im November 1992, traf ich den grünen Politiker Peter Sigerist in der Stadt. Er deutete den Sieg des Demokraten Bill Clinton in den USA, der eben den amtierenden Republikaner George Bush senior aus dem Amt gejagt hatte, als gutes Omen für die rot-grünen Stadtberner Regierungsträume. Ich lächelte freundlich, dachte mir aber: Wie weltfremd kann einer sein, der sich im biederen Bern auf die Weltmacht USA bezieht?
Bekanntlich behielten Sigerist und Seitz Recht. Am Abend des 6. Dezembers 1992 sass ich, ungekämmt und in waghalsig gemustertem Hemd, im Erlacherhof, dem Sitz der Stadtregierung, an einem grossen Tisch. Hinter meinem Rücken brach plötzlich kreischender Jubel aus, während der Freisinnige Kurt Wasserfallen, eben in den Gemeinderat gewählt, das Gesicht verzog, als wäre ihm ein schwerer Stein auf den Fuss gefallen. Die Linksgrüne Therese Frösch hatte die Wahl in die nun rot-grüne Stadtregierung geschafft, und noch fast dreissig Jahre später erinnert sie sich mit einer gewissen Belustigung daran, dass sie gedankenlos rote Strümpfe angezogen hatte, weil sie nicht damit rechnete, auf den Titelseiten der Medien zu landen.
Das ist meine Erinnerung an die politische Zeitenwende. Ich selbst zog mit meiner Familie kurz darauf ins Tessin, verfolgte die Berner Lokalpolitik aber mit etwas distanzierterem Aussenblick weiterhin genau. Als wir 2001 nach Bern zurückkehrten und ich wieder zur «Berner Zeitung» stiess, fühlte sich die Stadt schon unverschlafener, offener, multikultureller an. Doch das war nichts, verglichen mit dem, was in den darauffolgenden fast zwanzig Jahren geschah. Parkplätze verwandelten sich in Fussgängerreviere. Cafés in italienischem Stil, in denen der Cappuccino fünf Franken oder mehr kostet, schossen Pilzen gleich aus dem Boden. Die Warteschlange vor der Gelateria di Berna wurde zum sommerlichen Hotspot. Bürger waren auf einmal Bürger*innen. Skandale wie überteuerte Biohotdogs in Gratisbädern erhitzten die Gemüter. Die Stadt Bern putzte sich zu einem Showroom für rot-grüne Vorstellungen von Lebensqualität heraus. Und wurde zu einem staatlich umsorgten Wohnort, an dem es die Regierung als ihre Aufgabe anschaute, den verkehrsbefreiten öffentlichen Raum zu möblieren und zum «ausgelagerten Wohnzimmer» zu erklären.
Und ja, das windschiefe Haus an der Neubrückstrasse 17 entwickelte sich zu einer erfolgreichen Politkaderschmiede, bis es das Grüne Bündnis und die GSoA zu Gunsten einer standesgemässeren Bleibe im Frühjahr 2019 verliessen. Regula Rytz, die dort ab 1993 als erste bezahlte Sekretärin des Grünen Bündnisses gearbeitet hatte, klopfte im Dezember 2019 als – dann allerdings nicht gewählte – Bundesratskandidatin von ganz links aussen an die Tür der Landesregierung.
«Im Rückblick wirkt Berns Aufblühen wie eine logische Entwicklung. Aber in den neunziger Jahren war es alles andere als klar, dass die Stadt je wieder aus ihrer tiefen Krise finden und die Leaderrolle übernehmen wird», sagt Bernhard Pulver, damals Parteipräsident der heutigen GFL, später grüner Regierungsrat und seit 2019 Verwaltungsratspräsident der Insel Gruppe.
Pulver bringt auf den Punkt, was mich an der Geschichte der rot-grünen Stadt Bern fasziniert und mich bewogen hat, dieses Buch zu schreiben. Man vergisst schnell, wo Bern Anfang der Neunziger stand. Betrachtet man die knapp dreissig rot-grünen Jahre wie einen Film in Superzeitlupe, sieht man, wie ein paar linke Pioniere die in den Seilen hängende Stadt provozieren und beleben. Wie sie sich zu ihrer eigenen Überraschung immer stabiler und bequemer an der Macht installieren. Wie ihre Politik in die Normalität des Alltags hineingreift, bis in die Blumentöpfe urbaner Gärtnerinnen und Gärtner. Und wie sie sich in den Köpfen und Herzen der Menschen zu einem Lebensgefühl verfestigt, das die Stadt immer enger umfasst.
Natürlich gefiel mir, dass die rot-grüne Epoche ein paar hübsche Episoden in bester satirischer Qualität frei Haus lieferte. Die kapitalismuskritische Finanzdirektorin Therese Frösch, die Steuerschlupflöcher in den USA suchte? Bundesanwältin Carla Del Ponte, die durch ihr Berner Bürofenster Prostituierten bei der Arbeit zuschauen musste? Die linkslastigste Stadtregierung des Landes, in der mit Alec von Graffenried und Michael Aebersold zwei Mitglieder der konservativen Burgergemeinde sitzen? Manchmal war Bern auch Hauptstadt des Absurden.
Ehrlich gesagt vermisse ich heute in der städtischen Politik jedoch die Energie, die Konfrontationsfreude und den Mut der rot-grünen Anfänge. Es habe sich angefühlt, als erfinde man jeden Tag die Welt neu, sagte mir Regula Rytz einmal, als sie sich an die Startzeiten zurückerinnerte. Das ist heute anders: 28 Jahre Machtroutine haben Spuren hinterlassen. Die Angst, etwas zu verlieren, ist grösser als die Fantasie, etwas zu verändern. Die Vision, wo Bern sich hinbewegen könnte, hat sich verflüchtigt.
Dass Bern die schönste Stadt der Welt sei, sagt man nicht mit Selbstironie, sondern in heiligem Ernst. Vermutlich ist das Selbstvertrauen derjenige Standortfaktor, den Rot-Grün am meisten gefördert hat. Ungewollt ist allerdings auch die Selbstgefälligkeit mitgewachsen. In der brummenden Stadt von heute fühlt sich Wohlstand wie eine Selbstverständlichkeit an, und nicht unbedingt wie etwas, das erarbeitet werden muss – und deshalb auch gefährdet sein kann. Der Hang, ökonomische Zusammenhänge auszublenden, ist zu einem Persönlichkeitsmerkmal des rot-grünen Bern geworden.
«Vor dreissig Jahren, als ich in die Stadt hineinwuchs, teilte ich Ideen, die mit der Obrigkeit nicht kompatibel waren. Ich ging an Demos, die Gemeinderäte waren Feinde. Heute bin ich mit dem Stadtpräsidenten per du. Das ist eine Kumpelhaftigkeit, die mich zwar oft nervt, die für mich aber auch ihre Richtigkeit hat, weil ich ja auch dazugehöre. Aber das trifft längst nicht für alle zu», sagt Christian Pauli. Der frühere Journalist war Gründungsmitglied der Kulturkneipe Café Kairo in der Lorraine und Co-Leiter der Dampfzentrale, inzwischen ist er Kommunikationsverantwortlicher an der Hochschule der Künste Bern. Und er hat Recht, die politische Mehrheit zu relativieren. Eigentlich ist sie eine Minderheit, weil normalerweise mindestens 50 Prozent der Wahlberechtigten der Urne fernbleiben und 25 Prozent der Einwohner Ausländer ohne politische Rechte sind. Auch das gehört zur gerne ausgeblendeten Realität der rot-grünen Stadt.
Als ich an diesem Buch arbeitete, erfasste die Coronakrise die Welt. Abgesehen vom gesundheitlichen Notstand drohte plötzlich eine schwere wirtschaftliche Rezession, die den Blick auf die Stadt Bern und ihre langfristigen Perspektiven veränderte. Es bahnte sich eine Situation an, ähnlich wie in den neunziger Jahren, als Rot-Grün-Mitte die Macht übernahm: hohe Arbeitslosigkeit, verschärfte Armut, Finanzhaushalt in Schieflage. Damals trauten es die Wählenden der Linken zu, die Stadt aus der Krise zu führen. Und jetzt? Im Frühjahr 2020 waren auf einmal ungewohnte Manöver zu beobachten. Sozialdemokraten und Grüne posierten für Selfies vor lokalen Geschäften und machten sich für die Unterstützung des städtischen Gewerbes stark, während der freisinnige Gemeinderatskandidat Bernhard Eicher mehr Unterstützung für Drogenabhängige und die Notschlafstelle forderte. Weichten sich verhärtete ideologische Denkmuster auf? Es wäre etwas, das diese Stadt voranbrächte.
Während ich schrieb, blätterte ich immer wieder in zwei Büchern aus der grossen internationalen Politik, die mich geprägt haben. Der verstorbene deutsche «Spiegel»-Reporter Jürgen Leinemann beschreibt in «Höhenrausch» die wirklichkeitsleere Welt von Politikern. Und die verdrängte Tatsache, wie stark persönliche Ambitionen und Obsessionen von Politikerinnen und Politikern bestimmen, was sie im Namen öffentlichen Interesses tun (oder lassen). Der amerikanische Reporter George Packer schildert in seinem Werk «Die Abwicklung» in fantastischen Reportagen die «innere Geschichte» der USA im Übergang zur Trump-Ära. Er zeigt, wie Politik ins Alltagsleben der Menschen tröpfelt und fast unbemerkt auch private Handlungen und Lebensentwürfe beeinflusst. In der kleinen Welt der Berner Lokalpolitik ist das nicht anders.
Ich konnte dieses Buch nur schreiben, weil mir viele Menschen mit Gedanken und Tatkraft zur Seite standen. Meine grosse Dankbarkeit gilt: Susann Trachsel, Benita Schnidrig und Laura Ruf vom Stämpfli Verlag, die mich und mein Projekt mit viel Vertrauen und warmer Fürsorge begleiteten.
Ich sprach in vertraulichen Hintergrundgesprächen mit knapp vierzig Interviewpartnerinnen und -partnern aller politischer Lager, die verschiedenste berufliche und persönliche Beziehungen zu Bern haben. Ich fühle mich privilegiert, dass sie mir ihre persönliche Sicht der rot-grünen Epoche anvertraut haben. Einige kommen in autorisierten Zitaten in diesem Buch vor, von anderen sind Sichtweisen in meine Gedanken eingeflossen. Speziell danke ich Peter Sigerist, der mich in aussergewöhnlicher Grosszügigkeit an seinem schier unerschöpflichen Wissen über rot-grüne Angelegenheiten teilhaben liess. Was mich an allen Gesprächen beeindruckt hat: wie viele Leute sich mit grossem Einsatz und meist ehrenamtlich im Hintergrund für diese Stadt und ihr öffentliches Leben einsetzen.
Mein Dank geht an unzählige Stadtberner Journalistenkolleginnen und -kollegen aller Medien, die mit ihrer Arbeit zum kollektiven Gedächtnis dieser Stadt beitragen, von dem ich profitiert habe. Ein spezieller Schatz ist das aktualisierte und frei zugängliche Onlinearchiv, das der Journalist Fredi Lerch mit seinen Texten führt. Stefan von Bergen und Christoph Hämmann, Redaktionskollegen bei der «Berner Zeitung», lasen Teile des Manuskripts gegen, ermutigten mich und bewahrten mich vor Fehlschlüssen.
Wer schreibt, kennt das bange Begleitgefühl, dass sich die eigene Gedankenwelt als Bluff entpuppt, als peinliche Selbstüberschätzung, als sinnloser Vorstoss in den Nebel, nachdem man den Zeitpunkt für den Rückzug verpasst hat. Meine Familie – meine Partnerin Manuschak Karnusian und unsere Kinder Chahan und Taline Karnusian – holte mich liebevoll mit einem einfachen Gedanken zurück auf den Boden der Zuversicht: Man bereut nur, was man nicht gemacht hat. Und nicht, was man gemacht hat.
Jürg Steiner
Juni 2020