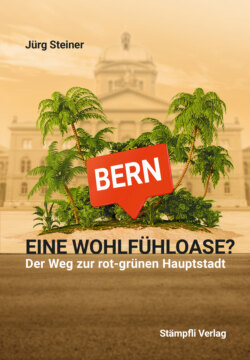Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Opfer der SP-Frauen
ОглавлениеPersonelle Fragen hingegen brachten das Beraterteam an den Rand der Verzweiflung. Ehrgeiz und Empfindlichkeit erwiesen sich als schwer beeinflussbar, und Heinz Däpp machte eine Erfahrung, die ihm auch bei seiner späteren Tätigkeit als Satiriker ständig begegnete: «Viele Linke sind unglaubliche Mimosen. Gut im Austeilen. Weniger gut im Einstecken.»
Der heikelste Mosaikstein bei der personellen Besetzung der Gemeinderatsliste bildete der Anspruch der SP-Frauen. Sie pochten – nach dem Gret-Haller-Debakel 1988 – auf eine Vertretung und hatten mit Grossrätin Ruth-Gaby Vermot eine kantige Kandidatin. In den Plänen der RGM-Strategen war jedoch kein Platz für sie. Weil die drei Bisherigen (die SPler Klaus Baumgartner und Alfred Neukomm sowie Joy Matter vom Jungen Bern) erneut antraten, blieb auf der Fünferliste nur je ein Listenplatz links und rechts der SP.
Parteipräsident Hans Stucki erinnert sich an «ganz schwierige Momente und hitzige interne Diskussionen», wenn er daran zurückdenkt, wie die SP-Frauen zum Verzicht bewegt wurden. Der aufgebaute Druck auf Ruth-Gaby Vermot war subtil: Hätte sie an ihrer Kandidatur festgehalten, wäre sie als Verhindererin der Wende dagestanden. Oder sie hätte Joy Matter aus dem Amt gedrängt. Vermot konnte am Schluss gar nicht anders als einsehen, dass «dies nicht ihre Stunde ist», wie SP-Sekretär Willi Zahnd das Frauenopfer in verbale Watte kleidete.
Ruth-Gaby Vermot kritisierte Anfang 1992 öffentlich, dass die SP-Führung die Frauen praktisch vor vollendete Tatsachen gestellt hatte. «Natürlich war ich sehr verärgert und enttäuscht. Langfristig sind bei mir aber keine Verletzungen zurückgeblieben. Ich habe keine schlechten Gefühle, Rot-Grün-Mitte wurde für Bern zur Erfolgsgeschichte», hält sie im Rückblick fest. Vermot hat ihre politische Karriere im Nationalrat und im Europarat fortgesetzt, wo sie sich vermutlich wohler gefühlt habe als in einem allfälligen Gemeinderatsamt, erklärt die dezidierte Frauen- und Asylpolitikerin, die während ihrer Amtszeit vorübergehend polizeilich geschützt werden musste.
Im Februar 1992 komplettierten wie vorgespurt Otto Mosimann, langjähriger Präsident der Stiftung für Drogenarbeit Contact, für die EVP sowie Therese Frösch, vor allem beim Spitalpersonal aktive Gewerkschafterin, für das Grüne Bündnis die RGM-Fünferliste für den Gemeinderat. Frösch, die sich in der linken Szene als Mitorganisatorin des Frauenstreiks von 1991 einen Namen gemacht hatte, flog unter dem Radar der breiten medialen Öffentlichkeit. Niemand unter den Meinungsmachern konnte sich eine Stadtregierung mit der debattierfreudigen Gewerkschafterin vorstellen.
Hans Kaufmann, bürgerlich denkender Lokalchef der «Berner Zeitung» und späterer Medienverantwortlicher des bernischen Gewerbeverbands, prophezeite der Stadt das Abdriften «ins politische Abseits», zumal er auf der rot-grünen Kandidatenliste ausser Klaus Baumgartner niemanden mit Regierungstauglichkeit ausmachen konnte. Im Falle eines linken Wahlsiegs sah Kaufmann Bern in der Hand rot-grüner Fundamentalisten und Randgruppen, die bloss für weiteren «Abfluss wirtschaftlicher Substanz» sorgen würden.
Auf der anderen Seite des politischen Spektrums löste das Zustandekommen der RGM-Liste Euphorie aus. Blaise Kropf, seit 2017 Co-Generalsekretär in der Präsidialdirektion der Stadt Bern, gehörte 1992 zu den Gründungsmitgliedern der Jungen Alternative (JA!), der Nachwuchsabteilung des Grünen Bündnisses. Eine vielsagende Szene ist ihm aus dem 92er-Wahlkampf im Gedächtnis haften geblieben. Er war zusammen mit seinem damaligen Parteikollegen und heutigen Stadtrat der Grünen Freien Liste (GFL), Manuel C. Widmer, auf Berns Strassen unterwegs, eingekleidet in ein grosses Werbekartonsandwich mit dem Konterfei von Otto Mosimann. Zufällig trafen die beiden Mosimanns Frau, die aufrichtig gerührt war angesichts der beiden Links-aussen-Jungspunde mit wilder Frisur, die sich für ihren eingemitteten, brav frisierten Otto starkmachten. «Das empfand ich als Aufbruchstimmung. Wir wollten den Wandel, und zwar gemeinsam, unterstützten uns gegenseitig und bestellten nicht bloss unser eigenes Parteigärtchen», sagt Kropf.
Als am 6. Dezember 1992 die Wahl von Therese Frösch bekannt wurde, ging im Restaurant Militärgarten im Breitenrain, im Stammlokal der Linken, die Stimmung durch die Decke. Und das bürgerliche Bern fiel aus allen Wolken. Wie ein Kulturschock ereilte die Stadt die Nachricht, dass das neue Regierungsmitglied Therese Frösch mit der grünen Stadträtin Ursula Hirt in einer Wohngemeinschaft lebte und nun plötzlich an den Schalthebeln der Macht sass.