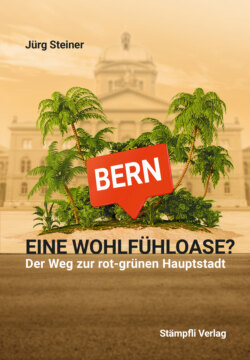Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bern wird bunt
ОглавлениеWie linke Männer Berns politische Wende strategisch einfädeln, die Frauen zuerst aussen vor lassen, in der Stadt aber plötzlich doch eine Frauenmehrheit regiert
Die Feindbilder, die Bern in den Achtzigern und Anfang der neunziger Jahre spalteten, sie waren boshaft, aggressiv, unversöhnlich. «Macht aus Albisetti Hackfleisch und Spaghetti», stand an Berns Sandsteinfassaden gesprayt. Die aufbegehrende Jugend meinte den freisinnigen städtischen Polizeidirektor Marco Albisetti. Er war Mitglied der bürgerlichen Regierung, die in Bern seit 1984 regierte und ein Bild der Überforderung abgab, weil sie keinen Weg fand, mit neuen Lebens- und Protestformen umzugehen. Albisetti, ein distinguierter Jurist mit Tessiner Wurzeln, wurde zur beliebten Zielscheibe während des kulturellen Zusammenstosses, der Bern tief erschütterte.
Im Frühjahr 1987, ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl, rief die Anti-Atom-Bewegung zu einer nationalen Kundgebung nach Bern und forderte erstmals, Atomkraftwerke in der Schweiz stillzulegen. Tausende standen im Demo-Zug, der sich auf einer teilweise unbewilligten Route durch die Marktgasse bewegte, als die Stadtpolizei mit Tränengas und Gummischrot einschritt. «Mühleberg stilllegen, Albisetti endlagern», hiess nach dieser Eskalation die wütende Losung. Ein halbes Jahr später musste die bürgerliche Stadtregierung die Besetzung der Reitschule hinnehmen. Als symbolischen Akt befestigten die Besetzer an einer Wand einen Hampelmann aus Holz namens Albiseppli, mit dem sie den Polizeidirektor verhöhnten.
Später wurde Albisetti mit Farbe beworfen, und nach der polizeilichen Räumung des Hüttendorfs Zaffaraya nur zwei Wochen nach der Reitschulbesetzung erhielt er definitiv das Etikett als Verhinderer einer fortschrittlichen Stadt. Bei einer spontanen Donnerstag-Demonstration in der Innenstadt zur Störung des Abendverkaufs vor Weihnachten 1987 kam es zu Handgreiflichkeiten. Albisetti befand sich zum traditionellen Suurchabis-Essen – dem Jahresschlussanlass des Stadtrats – im Restaurant Zunfthaus zur Webern, und als draussen die Demonstrierenden johlten, stellte sich der Polizeidirektor auf der Strasse der Diskussion. Hitzige Protestler versuchten darauf, ihn in den nahegelegenen Brunnen zu tauchen, wie sich der Berner Autor Matto Kämpf, der als Zeitzeuge dabei war, in einem Text erinnerte.
1988 schaffte die bürgerliche Regierung, inklusive Marco Albisetti, zwar die Wiederwahl. Aber die folgende Legislatur bestätigte das Bild einer blockierten, grauen Stadt, in der sich die politischen Lager in unverhohlener Feindseligkeit gegenüberstanden: die neoliberalen Kultur- und Sozialabbauer rechts gegen die linken Feministinnen, Ökofantasten und Verkehrsbremser. In dieser Konstellation taumelte die Stadt Bern, zu allem Überfluss auch noch auf finanziellem Schleuderkurs, dem 6. Dezember 1992 entgegen.