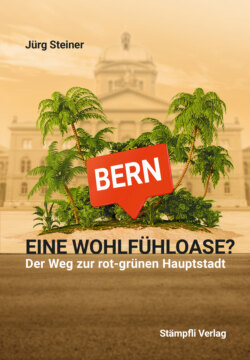Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Folgen des Mauerfalls
Оглавление1991 stiessen die Initianten Stucki und Kaufmann in Bern auf eine günstige Konstellation – vor allem im bewegten Biotop links der SP. Linksalternative Splittergruppen trugen zwar für das brave Bern noch gefährliche Namen wie Revolutionäre Marxistische Liga (RML) oder Sozialistische Arbeiterpartei (SAP). Doch links aussen musste man sich nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 und dem Ende des Kommunismus hinterfragen, weil politische Gewissheiten zerbrachen.
Bereits 1987 hatten Öko-Bewegte, AKW-Gegner, Dritte-Welt-Aktivisten, Feministinnen und Marxisten jeder Färbung in der «Inneren Enge» in Bern das Grüne Bündnis (GB) gegründet. Es war ein unkonventionelles politisches Start-up, mehr Bewegung als klassische Partei, dem es rasch gelang, den Grossteil der politischen Seelen links der SP zu bündeln. Die Idee der permanenten Revolution, sie blieb bestehen, jedoch bloss als ferner Traum. Nach kritischer Reflexion der eigenen Geschichte waren die geläuterten Linksgrünen bereit, den Marsch durch die Institutionen in Angriff zu nehmen, und zwar ungewohnt entschlossen und machtbewusst. Jetzt, hier, in Bern.
«Dass links der Mitte alles in Bewegung war, viele Leute neue politische Identitäten suchen mussten und bereit waren, über ihren Schatten zu springen, förderte unsere Bereitschaft, über ein Bündnis bis in die Mitte nachzudenken», erinnert sich Peter Sigerist, der zu den Gründern sowohl des Grünen Bündnisses wie der RGM-Koalition gehörte. Sigerist kam von sehr weit links, er hatte den RML/SAP-Ableger in Bern aufgebaut, und natürlich wurde sein Telefon vom schweizerischen Nachrichtendienst abgehört, wie er später in seiner Fiche lesen konnte.
Strategisch waren ehemalige Trotzkisten wie Sigerist bestens geschult. In seinem Fall kam auch ein Flair für kreative List hinzu. Er war es, der sich in den siebziger Jahren, offiziell als Vertreter des Veritas-Verlags, in ein baufälliges Haus an der Neubrückstrasse 17 vis-à-vis der Reitschule einmietete. Das Haus gehörte der Berner Uniformfabrik Luginbühl, und weil Sigerist bei der Vertragsunterzeichnung keine Risiken eingehen wollte, nahm er einen Kollegen mit, der extra einen Luginbühl-Eisenbahnermantel angezogen hatte und die Unterschrift unter das Mietverhältnis leistete. Es lief rund. Das knarrende, nicht immer wasserdichte und mitunter von Mäusen heimgesuchte Häuschen wurde zum Epizentrum von Berns linksalternativer Politszene. Auch darum, weil die ausgebufften Alttrotzkisten und -marxisten 1991 im RGM-Projekt die einmalige Chance erkannten, sich trotz noch kleiner Wählerbasis Zugang zum politischen Machtzentrum zu verschaffen.
Die Konstruktion des Bündnisses nötigte den Beteiligten nervenaufreibende Aufbauarbeit ab, wie sie wohl nur gescheiterte Ex-Revolutionäre zu leisten bereit waren. Ein taktisches Meisterstück war es, den Aufbau der Koalition an ein externes Team von hochkarätigen, parteilosen Beratern auszulagern, bestehend aus dem Journalisten Heinz Däpp, dem Politologen Werner Seitz und der Gleichstellungsbeauftragten Claudia Kaufmann, die später zuerst Generalsekretärin von SP-Bundesrätin Ruth Dreifuss und danach Stadtzürcher Ombudsfrau wurde.