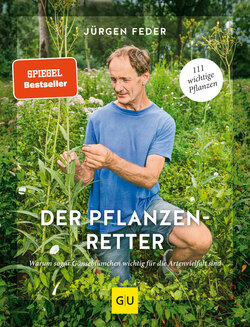Читать книгу Der Pflanzenretter - Jürgen Feder - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDer Braunstielige Streifenfarn liebt schattige Ziegelsteinmauern. Hier kann er richtig Fuß fassen.
AN MAUERN VORBEI
MILZFARN UND BRAUNSTIELIGER STREIFENFARN
Raus in die Natur
Und weiter geht es, vorbei beispielsweise an Mauern, für mich schon seit jeher wahre Herzensangelegenheiten. Bereits als Kind sah ich diese oft moos- und flechtenreichen Hofmauern im Ostwestfälischen, in Bielefeld, um genau zu sein. Ja, diese Stadt gibt es wirklich am Teutoburger Wald, ich schwöre es beim Teutates, selbst wenn einige Mitmenschen sich darüber immer noch einen Scherz erlauben. Wir versteckten uns seinerzeit hinter Mauern, kletterten darauf herum und nutzten sie beim Besteigen alter Apfel- oder Kastanienbäume.
Lang, lang ist es her, vom hohen Bio-Wert des Sonderbiotops »Mauer« für Tiere und Pflanzen bekam ich jedoch erst später etwas mit. Von diesen vertikalen Strukturen, freistehend oder stützend, vor und um Burgen, in Gärten, Klöstern und Schlössern, an Bahnhöfen, Flüssen oder in Parks, in Gestalt von Brücken oder Schleusen, als Einfriedungen von Fried- und Kirchhöfen, von Gefängnissen und Kasernen oder einfach nur so zur Zierde. Natürlich aus Ziegelsteinen oder als Trockenmauern aufgeschichtet, sie sind zweifellos zweite oder auch mal dritte Blicke wert. Jedenfalls sind Mauern ein gliedernder und ordnender Bestandteil in unseren Dörfern oder Städten, wo Platz und Raum schon immer knapp, steinerne Begrenzungen also unverzichtbar waren.
Dabei heißt es hier, die eigentliche Mauer von Mauerkopf und Mauerfuß zu unterscheiden, alles höchst unterschiedliche Biotöpchen abseits der großen Bekanntheit und der Wahrnehmung. Mal sind sie nährstoffarm, mal (meist) nährstoffreich, dann wieder schattig bis extrem besonnt, staubtrocken bis hin zur Gischt nahe von Fließgewässern, mal bemoost und verflechtet, mal basisch-kalkreich bis ganz kalkarm-sauer, mal frei oder mal dünn übererdet. Das sind die wirklichen »Kerle« der Botanik: wer hier Fuß fassen kann, sich einmischt, sich einwurzelt und auch noch entzückend blüht. Mit Samen und Sporen oft sehr lange wartend oder vom Winde verweht, bis die Fuge ganz allmählich doch aufbröckelt – wie ich doch schlampig arbeitende Mauerer von ganzem Herzen liebe! Dagegen sind diese geleckten Mauern völlig öde, die bloß keinen Vorsprung bieten, selbst bei Flechten und Moosen geht schon manchem Mitmenschen der Hut hoch. Warum eigentlich? Sie stechen nicht, verbeulen nichts, man kann über sie nicht stolpern, man kann sie nur bewundern. Und wie alt und treu sie dabei noch sein können. Ewig lang hocken sie da und besetzen diese für uns als lebensfeindlich erachtete Welt.
Aber von wegen, wie schön sind doch die vielen grün-bunten Mauern im Mittelmeergebiet, in Westeuropa oder auf den Britischen Inseln. Von dem bei uns überschaubaren Ensemble der echten Mauerpflanzen, mit Gelbem Lerchensporn und Mauer-Zimbelkraut, haben sich zudem zwei bei uns schon seit langem fest eingebürgerte Neophyten südlicher Gefilde eingefunden. Aber nicht nur: Mauern sind auch Orte für Buchenfarn, Eichenfarn, den Gewöhnlichen Tüpfelfarn, für Hirschzunge, Ruprechstfarn, für den Zerbrechlichen Blasenfarn (gern an Ortsmauern der Bäche, Flüsse und Weiher), für Dorn-, Frauen- und Wurmfarne sowie nicht zuletzt für den seltenen Schwarzstieligen Streifenfarn (ihn fand ich schon an allerlei künstlichem Gestein). Einige Nährstoffzeiger der Mauerfüße bringe ich Ihnen noch später nahe, bei Arten der Mauerkronen wie Färber-Kamille, Feld-Beifuß, Platthalm-Rispengras, Scharfer Mauerpfeffer, Steinbrech-Felsennelke oder Taubenkropf-Lichtnelke muss ich Sie auf andere Gelegenheiten vertrösten.
Und überhaupt: Haben Sie schon mal daran gedacht, aus Bruchsteinen im Garten eine kleine Mauer zu schichten, so ganz ohne Mörtel und mit unterschiedlichen Spalten? Da können sich bestimmte Arten einnisten, aber so ein kleines Bauwerk wäre auch ein Unterschlupf für so einiges Getier, etwa Käfer, Spinnen oder Eidechsen.