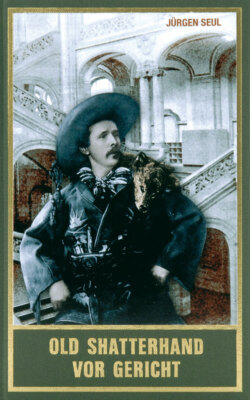Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Der Uhrendiebstahl
ОглавлениеDie nächste Lebensstation führte den Junglehrer in den Chemnitzer Vorort Altchemnitz. Die dort seit jeher vorherrschende bäuerliche Besiedelung war um diese Zeit bereits vor allem durch die am Chemnitzfluss entstehenden Manufaktur- und Fabrikunternehmen verdrängt worden. Spinnereien und andere Textilbetriebe dominierten. Alle sächsischen Unternehmen dieser Art waren auf Grund der sächsischen Schulordnung von 1773 und der damit eingeführten Schulpflicht gezwungen, den bei ihnen beschäftigten Kindern einen obligaten Unterricht zu bieten. Auch die Altchemnitzer Kammgarnspinnerei C. F. Solbrig & Söhne sowie die Baumwollspinnerei Julius Claus unterhielten daher derartige Fabrikschulen. Sie inserierten am 10. und 18. September 1861 eine offene Lehrerstelle in der Leipziger Zeitung, auf die sich der Arbeit suchende Junglehrer May meldete.
Gegenüber dem Diakon Eduard Otto Pfützner (1822-1912), der als Lokalschulinspektor für die Altchemnitzer Fabrikschulen zuständig war, gab May bei seiner Bewerbung für die Stelle über seine kurze Glauchauer Lehrtätigkeit an, er „habe dort das Unglück gehabt bei einem dem Trunke ergebnen Wirthe zu wohnen. Bei einem Streite nun, in den er deshalb mit diesem Manne gerathen sei, habe er unverhohlen demselben sein schändliches Treiben aufgedeckt. Darüber sei nun jener Mann in großen Zorn gerathen und habe ihn nicht nur bei dem Herrn Consistorialrath und Superintendenten Dr. Otto verklagt, sondern auch anderen Leuten gegenüber verunglimpft. Weil nun diese unangenehme Sache seinem Rufe in Glauchau geschadet habe, so sei er nach dem Rathe des Herrn Dr. Otto wieder von Glauchau weggegangen [...].“26
Diese Darstellung der Glauchauer Vorkommnisse wurde May nicht so ohne Weiteres geglaubt. Der Chemnitzer Superintendent Robert Kohl (1813-1881) richtete deshalb am 8. November 1861 eine entsprechende Nachfrage an seinen Glauchauer Kollegen Dr. Otto. Dessen Antwort vom 14. November 1861 entlarvte Mays Darstellung als unkorrekt; er äußerte die Schlussfolgerung: „Leider giebt die Lüge, mit welcher der p. Mai sein hiesiges Verhalten zu bemänteln versucht hat, den Beweis, daß der Lügengeist, dem der junge Mensch, wie die Superintendantur anderweitig weiß, sich ergeben hat, von ihm noch nicht gewichen ist. Sollte daher beabsichtigt sein, dem p. Mai eine dauernde Stellung an der Fabrikschule zu geben, so kann die Superintendantur nur rathen, den jungen Menschen zuvor einer sorgfältigen Überwachung und einer längeren, scharfen Prüfung zu unterwerfen.“27
Diese Mitteilungen führten zu einer umgehenden Vorladung Mays durch Kohl, der ihm eröffnete „daß er [May] nur provisorisch und unter speciellster Controlle sein Amt als Fabrikschullehrer zu Altchemnitz verwalten kön(n)e, und daß er bey der geringsten Veranlaßung zu Unzufriedenheit mit ihm in Lehre, Lebens-Wandel seiner Stellung wieder werde entlassen werden.“28
Und tatsächlich erteilte der Superintendent Kohl dem Lokalschulinspektor Pfützner auch die aus Glauchau empfohlene „Anweisung, May nicht aus den Augen zu lassen“.29
Trotz dieses problematischen Einstieges erhielt der Bewerber die Stelle zugesprochen. Er hatte drei Klassen zu unterrichten, zwei in der Fabrikschule der Baumwollspinnerei von Julius Friedrich Claus (1816-1873) und eine in der Fabrikschule von C. F. Solbrig & Söhne. Seine Arbeitszeit sah 30 Wochenstunden mit zehn- bis vierzehnjährigen Kindern vor, die täglich noch zehn Stunden in den Fabriken arbeiten mussten.
Mit dem ebenfalls bei C. F. Solbrig angestellten Herrmann Julius Scheunpflug (1820-?) musste sich May die vertraglich vereinbarte freie Wohnung in Harthau, auf dem Werksgelände im Wohngebäude der Familien Mittländer und Claus, teilen. Über Scheunpflug konnte der May-Forscher Hainer Plaul30 erst vor Kurzem einige Einzelheiten in Erfahrung bringen, die belegen, dass es sich bei Mays damaligem Zimmergenossen um einen Expedienten (Ausschreiber im Versand) gehandelt hatte und nicht – wie May und seine Biografen später immer wieder angaben – um einen Buchhalter. Die Wohnung befand sich in fast halbstündiger Entfernung von der unteren Schule und war Bestandteil der Baumwollspinnerei von Julius Friedrich Claus.
„Hierdurch verlor er [Scheunpflug] seine Selbständigkeit und seine Bequemlichkeit; ich genierte ihn an allen Ecken und Enden, und so läßt es sich gar wohl begreifen, daß ich ihm nicht sonderlich willkommen war [...]“,31 empfand May später.
Der Junglehrer konnte sich angesichts seines bescheidenen Gehalts von jährlichen 200 Talern – nebst freier Wohnung
– keine eigene Uhr leisten.32 Nun kam es zu einer für ihn zunächst sehr günstigen Vereinbarung mit dem Zimmergenossen: Scheunpflug stellte May für die Schulstunden eine alte Taschenuhr zur Verfügung, die danach täglich an einen dafür bestimmten Nagel an der Wand wieder aufgehängt werden sollte.
„In der ersten Zeit hing ich die Uhr, sobald ich aus der Schule zurückkehrte, sofort an den Nagel zurück. Später unterblieb das zuweilen; ich behielt sie noch stundenlang in der Tasche, denn eine so auffällige Betonung, daß sie nicht mir gehöre, kam mir nicht gewissenhaft, sondern lächerlich vor. Schließlich nahm ich sie sogar auf Ausgängen mit und hing sie erst am Abend, nach meiner Heimkehr, an Ort und Stelle.“ 33
Am 24. Dezember 1861 beging May dann den schicksalhaften Fehler, der den weiteren Verlauf seines Lebens entscheidend prägen sollte: Anstatt die entliehene Taschenuhr zurückzuhängen, nahm er sie nebst einer Zigarrenspitze und einer Pfeife seines Zimmergenossen mit auf seine Weihnachtsheimreise nach Ernstthal. Scheunpflugs Utensilien stellten wichtige Requisiten zur Außendarstellung vor allem gegenüber der Familie dar. Nach einer Erlaubnis hatte er nicht gefragt. Ungefähr gegen 19.00 Uhr wird er vermutlich in Ernstthal eingetroffen sein.
Als der Zimmergenosse seine Habseligkeiten vermisste, erstattete er eine Strafanzeige. Am ersten Weihnachtstag wurde May im Hohensteiner Hotel ‚Drei Schwanen‘ beim Billardspielen verhaftet.
Bei der Chemnitzer Superintendantur trafen am 28. Dezember 1861 gleich zwei Briefe ein, die auf die Verhaftung Mays Bezug nahmen. So wandte sich der besorgte Vater an Robert Kohl und sprach in seinem Brief die Überzeugung aus, dass er „kaum glauben [könne], daß mein Sohn die Uhr in der Absicht an sich genommen hat, um einen Diebstahl begehen zu wollen, ich glaube vielmehr, daß er es gethan hat, besagte Uhr während der Feiertagsferien zu benutzen und sie dann stillschweigend wieder an den Ort ihrer Bestimmung hinzubringen.“34
Im zweiten Brief teilte das Gerichtsamt Chemnitz mit: „Der Fabrikschullehrer Mai in Altchemnitz befindet sich wegen Diebstahls hier in Haft, und hat die Ansichnahme einer Uhr, einer Tabakspfeife und einer Cigarrenspitze, seinem Stubengenossen gehörend, eingeräumt, wiewohl er läugnet, dieß in gewinnsüchtiger Absicht gethan zu haben. Die Königliche Superintendantur wird davon hierdurch vorgeschriebenermaaßen in Kenntniß gesetzt.“35
Die Untersuchungssache mündete in eine Anklageerhebung vor dem Gerichtsamt Chemnitz gegen „C. F. Mai in Ernstthal“.36
Auf Grund der damaligen Regelung war das Gerichtsamt und kein Bezirksgericht als erstinstanzliches Gericht zuständig. Die Bezeichnung ‚Gerichtsamt‘ ist insofern ein wenig irreführend, weil es sich dabei konkret um einen Einzelrichter handelte, der u. a. für Diebstähle und Delikte nach Art. 330 des sächsischen Strafgesetzbuches37 zuständig war. Die Hauptverhandlung fand im Februar 1862 (das genaue Datum ließ sich nicht ermitteln) statt. Da die Akten nicht mehr vorhanden sind und sich auch in der zeitgenössischen Presse kein Bericht über die Verhandlung finden lässt, kann an dieser Stelle lediglich berichtet werden, dass May „wegen eines zum Nachteil eines Amtsgenossen verübten Diebstahls einer Taschenuhr in Untersuchung kam und ungeachtet seines Läugnens für überführt erachtet und zu einer sechswöchigen Gefängnisstrafe 1862 verurtheilt wurde.“38
Die Berufung Mays gegen das erstinstanzliche Urteil wurde vom Oberappellationsgericht Zwickau abgewiesen. Zu jener Zeit hatten die Oberappellationsgerichte die Stellung der heutigen Oberlandesgerichte inne. Eine Abwendung oder Milderung der Strafe „nach Abschlagung der von ihm [May] und bez. seinen Eltern angebrachten Gnadengesuche“39 fand nicht statt. Die Entscheidung war damit rechtskräftig und unabänderlich geworden. Das Urteil muss auf Mays Psyche eine verheerende Auswirkung gehabt haben:
„Ob und womit ich mich verteidigt habe; ob ich zur Berufung, zur Appellation, zu irgend einem Rechtsmittel, zu einem Gnadengesuche, zu einem Anwalt meine Zuflucht nahm, daß weiß ich nicht zu sagen. Jene Tage sind aus meinem Gedächtnisse entschwunden, vollständig entschwunden. Ich möchte aus wichtigen psychologischen Gründen gern Alles so offen und ausführlich wie möglich erzählen, kann das aber leider nicht, weil Alles infolge eigenartiger, seelischer Zustände, [...] aus meiner Erinnerung ausgestrichen ist. Ich weiß nur, daß ich mich vollständig verloren hatte [...].“40
Diese erste Verurteilung wirft mancherlei Fragen auf. „Tatsächlich und rechtlich birgt der Fall viele Dunkelheiten“ – so Roxin – „Mays Behauptung, er habe die Gegenstände nach den Ferien zurückbringen wollen, ist glaubhaft. Denn da nach Lage der Dinge nur er die Gegenstände an sich genommen haben konnte, wäre er als Dieb von vornherein entlarvt gewesen.“41
Die Gesamtumstände lassen den Schluss zu, dass sich May allenfalls einer widerrechtlichen Benutzung fremder Sachen im Sinne des Art. 330 des sächsischen Strafgesetzbuches strafbar gemacht hatte. Dieses Delikt existierte einige Jahre später mit Einführung des Reichsstrafgesetzbuches von 1871 nicht mehr. Möglicherweise aber ist May auch wegen dieses Deliktes und eben nicht wegen Diebstahls verurteilt worden. Für diese Annahme spricht das ausgesprochene Strafmaß von sechs Wochen Gefängnis, das dem Höchstmaß nach § 330 Abs. 3 SächsStGB entspricht. Andererseits sprechen verschiedene behördliche Schreiben, vor allem ein noch erhaltenes des Gerichtsamtes Chemnitz ausdrücklich davon,
daß der Fabrikschullehrer Carl Friedrich Mai zu Altchemnitz durch den in zweiter Instanz bestätigten Bescheid des unterzeichneten Gerichtsamtes wegen Diebstahls zu 6 Wochen Gefängniß verurtheilt worden ist.42
Ob nun wegen Diebstahl oder doch wegen widerrechtlicher Benutzung fremder Sachen – die Verwirklichung beider Delikte erscheint jedenfalls zweifelhaft. Diese Zweifel werden zusätzlich durch das Verhalten anderer Beteiligter in diesem Fall genährt. Eine maßgebliche Rolle scheint die Schulbehörde beim Zustandekommen des ganzen Malheurs gespielt zu haben, vergegenwärtigt man sich, dass der ohnehin unter „speciellster Controlle“43 des Lokalschulinspektors Pfützner stehende May von diesem „nicht aus den Augen zu lassen“ war und „bei der geringsten Veranlaßung zu Unzufriedenheit mit ihm in Lehre, Lebens-Wandel seiner Stellung wieder [...] entlassen werden“ sollte. Und tatsächlich hatte Pfützer anlässlich einer Revision der Fabrikschule Solbrig weder May noch seine Schüler vorgefunden und sofort empört seiner vorgesetzten Stelle gemeldet:
Solch ein Benehmen und solch eine Untreue widerstreitet so sehr aller gesetzlichen Ordnung, daß ich diesen Fall sogleich zur Cognition der Königlichen Superintendantur bringen und um Vernehmung und respective ernstlicher Verwarnung des Fabriklehrers May bitte.44
Zwar klärte sich das Fehlen von Lehrer und Schüler schließlich als zulässig auf, doch zeigt schon dieser harmlose Vorgang, wie rasch der Kontrolleur Pfützner May ein ordnungswidriges Verhalten unterstellte. Und natürlich blieb May trotz der irrtümlichen Verdächtigung unter dem gestrengen wachsamen Auge dieses Diakons.
Nicht überliefert ist, an wen sich Scheunpflug als Erstes wandte, als er feststellte, dass die entliehene Taschenuhr am 24. Dezember nicht wieder an ihrem Haken hing und sein Stubengenosse schon in Richtung Heimat abgereist war. Die Vermutung liegt nahe, dass seine Mitteilung an Pfützner ging. In diese Richtung deutet auch eine kurze Beschreibung Mays von einem Wiedersehen mit Scheunpflug:
„Er gab mir die Hand und bat mich, ihm zu verzeihen. So, wie es gekommen sei, das habe er keineswegs gewollt. Es tue ihm unendlich leid, mir meine Karriere verdorben zu haben!“ 45
Es bleibt allerdings nur Spekulation, dass Scheunpflug gegenüber einem Vertreter der Schule, vielleicht Pfützner, die an sich harmlose, aber leichtsinnige Handlung eines – wie Ernst Bloch46 es später beschrieb – jungen und armen, verwirrten Proleten unnötig aufbauschte, bis sie zu einem Strafrechtsfall eskalierte.
Aus heutiger Sicht und unter Zugrundelegung der dargelegten Fakten stellte die Uhrenaffäre nur die unbesonnene Handlung eines Heranwachsenden dar, der keine strafrechtliche Relevanz zukommt. Das heutige Strafgesetzbuch kennt nur die strafbare unbefugte Benutzung bei Kraftfahrzeugen und Fahrrädern; für die von May benutzten Gegenstände sieht es keine Bestrafung vor. Aber auch unter dem Blickwinkel eines Diebstahlsvorwurfs gelangt man bei May zu keinem anderen Ergebnis, denn das entscheidende subjektive Element, der Vorsatz, sich die Gegenstände des Zimmerkollegen anzueignen, sie also auch nach den Weihnachtsferien nicht wieder zurückzugeben, lässt sich bei May nicht nachweisen. Alle Umstände lassen stattdessen nur den Schluss zu, dass May die Gegenstände von Anfang an zurückgeben wollte, also ohne kriminelle Intention handelte. Über den Grund, warum das Gerichtsamt Chemnitz sechs Wochen Gefängnis aussprach, lässt sich nur mutmaßen, doch es scheint wahrscheinlich, dass man auch Mays Verhalten in Waldenburg, die Meinhold-Affäre sowie seine gesamte Personalakte zur Beurteilung seiner Täterpersönlichkeit herangezogen hatte und zu einem ungünstigen Ergebnis gekommen war.
„Hätten für Karl May schon die Möglichkeiten bestanden, die das 1923 eingeführte Jugendstrafgesetz in seinen späteren Ausprägungen geboten hat und bis heute bietet, so wäre die kleine Verfehlung mit der Taschenuhr des Kollegen mit ziemlicher Sicherheit nur informell und ohne eigentliche Sanktion erledigt worden.“47
Dieser erste strafrechtlich geahndete Fall Karl Mays wurde zu seinem vermutlich entscheidensten Lebensereignis. Er floss in vielfacher Hinsicht auch in sein literarisches Werk ein. Bereits der erste Band des großen Orient-Zyklus, Durch Wüste und Harem (Gesammelte Werke Band 1, Durch die Wüste), lässt den Leser an Mays Reise ins Innere, seinem literarischen Verarbeiten dieser kriminologischen Urszene teilhaben. Der Ich-Erzähler Kara Ben Nemsi reitet, begleitet von seinem Diener Hadschi Halef Omar, durch die Sahara und entdeckt ein Verbrechen. Sie finden die Leiche eines ermordeten französischen Kaufmannes. Die Mörder haben die Leiche bis auf einen Ring ausgeraubt. Scheinbar arglos steckt sich Kara Ben Nemsi den Ring – ungeachtet der Gefahr, vielleicht selber für den Mörder gehalten zu werden – an den eigenen Finger. Kara Ben Nemsis Handlungsweise erinnert an den Leichtsinn des Lehrers Karl May, als dieser das für ihn so verhängnisvolle corpus delicti in den Weihnachtsurlaub mitnahm. Zu keinem Zeitpunkt fürchtet Kara Ben Nemsi das offensichtlich Kompromittierende seiner Handlung, ganz so, als wolle er plakativ das Rechtmäßige seiner Handlungsweise zum Ausdruck bringen. Es lassen sich noch weitere literarische Spuren dieser Glauchauer Urszene finden.
Mays Strafverbüßung erfolgte schließlich im Chemnitzer Bretturm. In dem heute nicht mehr vorhandenen Gebäude war der inhaftierte Karl May vom 8. September 1862 bis 20. Oktober 1862 untergebracht.