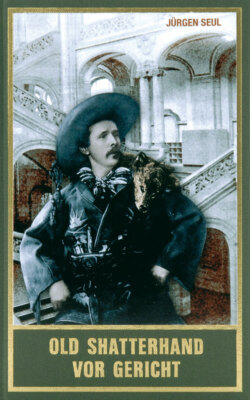Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Karl May im Arbeitshaus Schloss Osterstein (1865-1868) 1. Der sächsische Strafvollzug
ОглавлениеDas Arbeitshaus als Strafanstalt besaß in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts noch keine lange Tradition in Deutschland. Diese besondere Form der Inhaftierung von verurteilten Straftätern gehörte zu den Neuerungen des sächsischen Strafvollzugs, ausgehend von den Entwicklungen im Ausland. So bereisten der Geheime Regierungsrat George von Zahn und der Strafanstaltsdirektor Eugene d’Alinge (1819-1894) im Auftrag des Ministeriums des Inneren im Jahre 1856 eine Reihe deutscher und europäischer Strafanstalten, prüften die dortigen Bedingungen und Systeme, protokollierten die Erfahrungen der Direktoren und verschafften sich so einen durchaus repräsentativen Überblick über den Stand der Gefängnisreform und deren bisheriger Erfolge, den von Zahn in einem Bericht an das Ministerium, ergänzt durch Vorschläge für die weitere Gestaltung der Strafanstaltslandschaft in Sachsen, vorlegte.82
Die Vorschläge der beiden Beamten sollten die sächsische Gefängnislandschaft in den Jahren nach 1860 grundlegend verändern. Sie kamen auch den gesetzlichen Prämissen einer stärkeren Differenzierung der Haftstrafen, der Einführung der Einzelhaft sowie der Trennung weiblicher und männlicher als auch jugendlicher und erwachsener Straftäter entgegen. Daneben fanden auch andere wesentliche Prinzipien wie jenes des Besserungsgedankens – speziell gegenüber den Häftlingen der Arbeitshäuser – Eingang in den Strafvollzug. Das Arbeitshaus als spezielle Strafvollzugsart stellte eine Zwischenform zwischen Gefängnis und Zuchthaus dar. Grundlage für die jeweilige Zuweisung des Verurteilten an eine Vollzugsart bildete die Schwere der Tat und der Schuld, ebenso wie das Alter des Täters. Schwerste Verfehlungen zogen immer eine Zuchthausstrafe nach sich, die Gefängnisstrafe ereilte die Betreffenden bei minder schweren Vergehen.
„Deshalb sollte im Arbeitshaus zwar gleichermaßen wie im Zuchthaus strengste Disziplin gefordert und Zwangsarbeit geleistet werden, aber ohne die beschimpfenden Folgen der Zuchthausstrafe und ohne die Gemeinschaft mit den schwersten Verbrechern.“83
Die Einlieferung Mays in die sächsische Landesstrafanstalt Arbeitshaus Schloss Osterstein bei Zwickau erfolgte am 14. Juni 1865. Er war im laufenden Jahr einer von 1004 Neuzugängen84, während die Gesamtzahl der Insassen unter Abzug der Abgänge insgesamt 1956 Personen betrug. Einer der bekanntesten Inhaftierten in der Geschichte der Strafanstalt sollte in der Zeit zwischen dem 1. Juli 1874 und 1. April 1875 August Bebel (1840-1913) werden.
Die Zwickauer Anstalt gehörte zu den sieben im Königreich Sachsen existierenden Strafvollzugseinrichtungen: Waldheim, Zwickau, Sachsenburg, Hoheneck, Voigtsberg, Grünhain und Hohnstein. Es handelte sich seit 1838 um ein reines Männergefängnis. Die aufgeführten Namen zeigen die Präferenz im Sachsen des 19. Jahrhunderts, zur Unterbringung der Gefangenen vorzugsweise alte Burgen und Schlösser zu nutzen, die aber in vielen baulichen Belangen kaum noch den strafvollzugstechnischen, hygienischen und sozialen Anforderungen an moderne Vollzugseinrichtungen Stand halten konnten, wenn auch diese Situation durch eine Reihe von Um- und Ausbaumaßnahmen seit 1850 erheblich verbessert worden war.85
Die Zwickauer Strafanstalt war in dem am Nordostausgang der Stadt gelegenen, hoch umwallten Schloss Osterstein untergebracht. Seit 1775 fungierte Schloss Osterstein als Strafanstalt, in die in jenem Jahr die ersten 14 Gefangenen einzogen. 1829 war sie in eine Landesarbeitsanstalt und sieben Jahre später, im Zusammenhang mit der Einführung des sächsischen Kriminalgesetzbuches und der darin erstmalig vorgesehenen Arbeitshausstrafe, in ein Arbeitshaus für Männer umgewandelt worden. Aufgrund seiner Erkenntnisse, die er bei seiner mit George von Zahn durchgeführten Studienreise durch Europa und Deutschland gemacht hatte, setzte sich der damalige Direktor von Schloss Osterstein, Eugène d’Alinge, für das ‚Besserungsprinzip‘ ein. D’Alinge war zum Zeitpunkt der Einlieferung Mays bereits seit 14 Jahren Direktor des Arbeitshauses in Zwickau. Das von ihm propagierte ‚Besserungsprinzip‘ beschrieb er selber, wie folgt:
„Die Bessrung in unsrem Sinne erfordert doch, dass die fehlerhaften seelischen Gebilde, welche den Uebeltaten zum Grunde liegen, aufgelöst und die frei gewordene Kraft der Seele in eine normale Richtung der Entwicklung gebracht werde, dass aber auch zugleich die Kraft durch Uebung, in der gegebenen normalen Richtung zu verharren, gestärkt werde. Dies geschieht aber nicht direct durch Collectivhaft oder Einzelhaft. Die Mittel, welche hier angewendet werden müssen, sind Erziehung und Unterricht [...].“86
Daraus resultierte bei d’Alinge die Schlussfolgerung, dass Erziehung und Unterricht jeden einzelnen Gefangenen auf der Stufe erfassen sollten, auf der er eigentlich stand und die seinem Seelenleben eigentümlich war. Dieses Verständnis vom Sinn der Strafvollstreckung war zu Mays Inhaftierungszeit noch recht neu. Ein wesentliches Merkmal zur Erlangung dieser „Bessrung auf dem Wege der Individualisierung“ stellte der Strafvollzug in sogenannten Disziplinarklassen dar, der im Wesentlichen den direkten Vorläufer des Strafvollzugs in Stufen verkörperte. Dabei wurden die Häftlinge je nach ihrem Verhalten und ihrer bisherigen Verbrechensvita in unterschiedliche Disziplinarklassen mit verschiedenen Rechten und Erleichterungen eingeteilt. Je nach der Führung des Gefangen waren sowohl ein Aufstieg in eine günstigere als auch ein Abstieg in eine strengere Disziplinarklasse möglich. Mit der Einführung dieses Klassensystems hatte man um 1840 versucht, den Anforderungen der Strafvollzugsreform an eine individuellere Behandlung der Insassen mit deutlichen Anreizen zu einer Besserung schon im Gefängnis gerecht zu werden. Man entschied sich damals in Sachsen gegen das weithin akzeptierte sogenannte philadelphische System der unbedingten Einzelhaft ebenso wie gegen das sogenannte auburnsche System, das eine Gemeinschaftshaft bei der Erteilung eines Schweigegebots favorisierte. Es existierten drei Klassen. Die Gefangenen der einzelnen Klassen unterschieden sich sowohl in ihrer Kleidung, dem Grad der Freiheitsbeschränkung, der Gewährung von Vergünstigungen und Belohnungen, der Arbeitsgratifizierung, des freien Umgangs mit dem ersparten Geld als auch in der Anwendung von Disziplinarstrafen. Die normale Klasse war die sogenannte Mittelklasse. Ihr wurden in der Regel alle neu eingegliederten Strafgefangenen zugeordnet. „Die niederste und am schlechtesten gestellte Klasse, die dritte Klasse, nahm alle diejenigen Häftlinge auf, deren ‚sittlicher Zustand und deren Verhalten die Anwendung strengerer Zuchtmittel als angezeigt erscheinen‘ ließ und ‚insbesondere auch Diejenigen, welche im Verlaufe der Dentention Böswilligkeit oder leichtfertige Auffassung ihrer Bestrafung bez. Ihrer Correction‘ an den Tag legten. Zu diesen gesellte sich aus den Reihen der neuaufgenommenen Insassen noch jener Teil, welcher sich ‚schon bei der Aufnahme Böswilligkeit oder leichtfertige Auffassung der Bestrafung‘ anmerken ließ, ebenso wie ‚solche Eingelieferte, welche in der Absicht straffällig geworden sind, um in eine Straf- oder Correctionsanstalt zu kommen‘ und natürlich alle Rückfalltäter, die schon einmal Bekanntschaft mit Gefängnissen gemacht hatten.“87
Allerdings galt für Rückfalltäter das Recht eines Ausnahmefalls, wenn die letzte Haftzeit erheblich zurücklag oder der frühere Haftgrund nur von minderer Schwere gewesen war. Die Gewährung dieses Ausnahmerechts stand allerdings allein im Ermessen der Direktion.
Während die bereits bei der Einlieferung der dritten Klasse zugeteilten Insassen in der Regel bis zum Ende der Haftzeit in dieser Klasse verbleiben sollten, bestand für die ansonsten in der dritten Klasse befindlichen Strafgefangenen die Möglichkeit, sich durch gutes Betragen und bei deutlich gemachter Besserung in die Mittelklasse zurückversetzten zu lassen. Damit glaubte man, einen ausreichenden Ansporn zur Besserung für die Häftlinge geschaffen zu haben und zudem den renitenten Teil der Insassen unter sich abgeschlossen und damit einen verderblichen Einfluß dieses unverbesserlichen Kreises auf besserungswillige Insassen ausgeschlossen zu haben.88
D’Alinge beschreibt: „Aeusserliche Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Classen sind nöthig und werden dieselben am besten an der Kleidung angebracht. Diese Unterschiede dürfen aber durchaus nicht in der Form, Qualität und Quantität der Kleidung liegen, müssen überhaupt von der Art sein, dass sie nur den Beamten und Gefangenen erkennbar und verständlich sind [...]. Auf dieser Classification ruht die von uns geforderte Organisation wie auf einem Fundamente [...]. Die Classen sind zu betrachten als drei Stadien, die der Gefangne ganz oder theilweise zu durchlaufen hat und innerhalb deren alle Mittel angewendet werden, um seine sittliche Heilung zu vollenden.“89 Der Eintritt in die privilegierte erste Klasse konnte zunächst nur aus der Mittelklasse erfolgen, und zwar nur dann, wenn die Gefangenen nachdrücklich bewiesen hatten, dass sie ernstlich bestrebt waren, sich zu bessern, dabei sich längere Zeit hindurch vorzüglich gut betragen und fleißig gearbeitet haben. Bei Verfehlungen allerdings drohte die sofortige Rückversetzung in die Mittelklasse oder unter Umständen der Absturz in die dritte Klasse.
Wie André Thieme ausführt, befanden sich „Mitte der achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts [...] fast 2/3 der in den sächsischen Straf- und Korrektionsanstalten inhaftierten Personen in der dritten Disziplinarklasse. Freilich verhinderte diese hohe Bestandszahl in der dritten Klasse eine individuelle Behandlung der dort einsitzenden Häftlinge. Hier lag auch die offensichtliche Schwäche des sächsischen Disziplinarklassensystems, das mit seinen drei Stufen zu geringe Differenzierungsmöglichkeiten bot. Die Masse der Gefangenen war so einem gegenseitigen ‚verderblichen‘ Einfluß ausgesetzt, der die Rückfalltäterquote in dieser Klasse sicher potenzierte.“90
Um diesen Effekt aber zu vermeiden, bemühte man sich um die Isolierung wenigstens der jüngeren Gefangenen, die noch als verhältnismäßig unverdorben galten. Diese sollten soweit als möglich gesondert von den älteren Sträflingen untergebracht und auch während der Arbeitszeit isoliert gehalten werden.
Karl May wurde bei seiner Einlieferung der zweiten Disziplinarklasse zugeteilt. Der Ablauf jenes ersten Tages lässt sich nachzeichnen, verfolgte er doch ein bürokratisches Ritual, dessen sich jeder neue Häftling unterziehen musste. Nach Überprüfung der formellen Rechtmäßigkeit der Einlieferung Mays durch den Direktor d’Alinge erhielt er ein Exemplar der gedruckten Verhaltensregeln für Häftlinge ausgehändigt. Ab jetzt wurde er für die Dauer seines Aufenthaltes als ‚Sträfling‘ bezeichnet und mit ‚Du‘ angesprochen.91
Es folgten die verwaltungstechnische Visitierung und Registrierung. Im Hinblick auf die Vermögensverhältnisse des Neuhäftlings mit der laufenden Nr. 171 registrierte man kurz: „arm“.92
Anschließend wurden ihm alle Gegenstände, die er bei sich trug, „seine Kleider und sonstigen Effecten, soweit ihm dieselben nach Maaßgabe der ‚Verhaltensregeln‘ nicht zu belassen“ waren, abgenommen und verzeichnet. Verderbliche Gegenstände wurden verkauft und der Erlös ‚auf einem für ihn bei der Spargelder-Casse anzulegenden Conto gutgeschrieben‘. Hierauf folgten Vollbad mit gründlicher Körperwäsche und seine Einkleidung.“93
Bei den Kleidungsstücken handelte es sich im Einzelnen um: 1 Jacke, 1 Paar Hosen, 1 Weste, 1 Kappe und 1 Paar Hosenträger, sämtlich aus Tuch. Ferner: 1 Paar Hosen und 1 Weste von Zwillich und 1 Paar rindslederne Schuhe.
Binnen der folgenden 24 Stunden erfolgte pflichtgemäß die erste medizinische Untersuchung Mays durch den 1. Anstaltsarzt Dr. Emil Friedrich Heinrich Saxe (1827-?). Hierbei sollte auch festgestellt werden, für welche Tätigkeit sich May innerhalb der Strafanstalt eignen würde. Im Zusammenspiel mit weiteren Untersuchungen im Hinblick auf die individuelle Charakteristik und unter Beachtung der Verurteilungsgründe befanden die Zwickauer Verantwortlichen, dass Karl May im Schreibdienst der Strafanstalt eingesetzt werden sollte.94 Für einen ehemaligen Lehrer eine scheinbar ideale Beschäftigung.
„Man kann hieraus ersehen, wie fürsorglich die Verhältnisse der Gefangenen von der Direktion berücksichtigt werden“,95 befand der Schriftsteller später.
Fortan hatte der Neuhäftling Schreibarbeiten anzufertigen. Es handelte sich sowohl um Lohnarbeit für Auftraggeber außerhalb der Strafanstalt als auch um solche zum Nutzen der Anstalt selber. Dabei konnte die werktägliche Arbeit bis zu dreizehn Stunden dauern.
Wie alle Sträflinge unterstand auch May der Beobachtung – im Behördendeutsch: der Visitation – durch einen Aufseher. Obwohl May grundsätzlich gewiss zur Übernahme der ihm aufgetragenen Tätigkeit in der Schreibstube geeignet gewesen war, kam es zu einer auch für die Anstaltsleitung überraschenden Feststellung, die May so beschreibt:
„Ich versagte als Schreiber so vollständig, daß ich als unbrauchbar erfunden wurde. Ich hatte als Neueingetretener das Leichteste zu tun, was es gab; aber auch das brachte ich nicht fertig. Das fiel auf. Man sagte sich, daß es mit mir eine ganz besondere Bewandtnis haben müsse, denn schreiben mußte ich doch können! Ich wurde Gegenstand besonderer Beachtung. Man gab mir andere Arbeit, und zwar die anständigste Handarbeit, die man hatte. Ich kam in den Saal der Portefeuillearbeiter und wurde Mitglied einer Riege, in welcher feine Geld- und Zigarrentaschen gefertigt wurden.“ 96
Weder aus vorhandenen Akten noch anderen Quellen ist der Hintergrund und die Art des Versagens bei May überliefert. Mit der neuen Tätigkeit kam er gut zurecht. Als Portefeuillearbeiter wurde er fortan dem Aufseher Friedrich Eduard Göhler (1824-1890) unterstellt. Göhler arbeitete seit 1854 im Arbeitshaus Schloss Zwickau, seit dem 1. Juli 1861 als Aufseher der 1. Disziplinarklasse. Mit ihm verband May sehr rasch eine besondere Beziehung.
„Ich nenne seinen Namen mit großer, aufrichtiger Dankbarkeit. Er hatte mich zu beobachten und kam, obwohl er von Psychologie nicht das geringste verstand, nur infolge seiner Humanität und seiner reichen Erfahrung meinem inneren Wesen derart auf die Spur, daß seine Berichte über mich, wie sich später herausstellte, die Wahrheit fast erreichten. Göhler kam sehr rasch auf die Idee, mich in sein Bläserkorps aufzunehmen, um zu sehen, ob das vielleicht von guter Wirkung auf mich sei. [...] Ich trat in die Kapelle ein. Es war gerade ein Althorn frei. Ich hatte noch nie ein Althorn in den Händen gehabt, blies aber schon bald ganz wacker mit. Der Aufseher freute sich darüber. Er freute sich noch mehr, als er erfuhr, daß ich Kompositionslehre getrieben habe und Musikstücke arrangieren könne. Er meldete das sofort dem Katecheten, und dieser nahm mich unter die Kirchensänger auf. Nun war ich also Mitglied sowohl des Bläser- als auch des Kirchenkorps und beschäftigte mich damit, die vorhandenen Musikstücke durchzusehen und neue zu arrangieren.“ 97
Hartmut Kühne und Christoph F. Lorenz bedauern in ihrem Buch über Karl Mays Musik, „dass die Musikalien aus Schloss Osterstein wohl nicht mehr vorhanden sind: Vielleicht wären wir auf weitere Kompositionen oder wenigstens Arrangements aus Mays Feder gestoßen. Es ist jedoch ernsthaft zu erwägen, dass die Weihnachtskantante aus der Osterstein-Zeit stammt“.98 Das Notenmaterial der Kantate ist in zwei Fassungen überliefert, wobei eine mit ‚K. May‘ und die andere mit ‚K. F. May‘ autorisiert ist. Zur selben Zeit, als May musikalisch tätig wurde, wurde er auch in die erste Disziplinarklasse der Strafanstalt versetzt. Der Zeitpunkt lässt sich nicht genau datieren, doch dürfte es im Laufe des Jahres 1867 geschehen sein. Neben den Vergünstigungen, die May nunmehr in Anspruch nehmen konnte, gehörten die Erlaubnis zu weiterer Verwendung seines Arbeitserwerbes, Zugeständnisse bei der Bewegung im Freien oder auch die Gewährung größerer Selbstständigkeit innerhalb der Anstaltsmauern.
Für alle Gefangenen bestand im Übrigen ein Schweigegebot, dazu ein allgemeines Verbot für sinnliche Genüsse, wie die verschiedensten Möglichkeiten der Genussbefriedigung von besonderer Verpflegung, etwa durch Päckchen, bis hin zu allen Äußerungen der Sexualität.99 Lesen gestattete man den Insassen nur während festgelegter Zeiten und beschränkte den Lektürekanon auf die Bestände der Gefängnisbibliotheken. Die Gefangenenbibliothek in Schloss Osterstein verfügte über:
| Neues Testament | 250 Bände |
| Gesangbuch | 1041 Bände |
| Lutherische Catechismen und Spruchbücher | 222 Bände |
| anderweitige Bücher bildenden Inhalts | 2776 Bände |
| zusammen: | 4289 Bände100 |
Daneben existierte noch eine kleine Bibliothek für die Vollzugsbeamten, die vorwiegend Werke der Straf- und Gefängniswissenschaft sowie verwandter Wissenschaften enthielt. Der Bezug von besonderem Lesestoff über einen auswärtigen Bücherleihverkehr stand den Gefangenen nur auf Antrag und nach Genehmigung durch die Direktion zu. Ob May auch am auswärtigen Bücherleihverkehr teilnehmen durfte, kann zwar vermutet, aber nicht bewiesen werden. Zeitung waren für die Häftlinge im Übrigen tabu.
Restriktiven Einschränkungen unterlagen die Korrespondenz der Gefangenen, der Besuch durch Angehörige wie auch der Empfang von Geschenken durch die selbigen. Die eingehende oder von den Gefangenen abgehende Korrespondenz musste jeweils von der Direktion gelesen werden, die Bedenken gegen den Inhalt formulieren konnte. Zudem erhielt der Gefangene das nötige Schreibmaterial nur leihweise und musste alle unbenutzten Materialien später wieder zurückgeben. Das Entstehen umfangreicher Manuskripte muss daher auch im Falle Karl May bezweifelt werden. Besuche durften die Insassen nur bei längerer Inhaftierungsdauer und nach schriftlicher Genehmigung empfangen, wobei dann ein Beamter anwesend sein musste. Zudem existierte ein breit gefächtertes Instrumentarium von Sanktionsmöglichkeiten, angefangen von der Kostschmälerung bis zu Wasser und Brot über die verschiedensten Formen von Arresten bis hin zu körperlichen Züchtigungen.
Die Verhängung der Strafen oblag allein der Kompetenz des Direktors. Dieser konnte zur Verhinderung einer Flucht oder zur Verhütung absehbarer Gewalttätigkeiten noch besondere Sicherungsmittel verfügen. Zu diesen zählten die Zwangsjacke, der Zwangsstuhl, die Fesselung und ausschließlich für männliche Gefangene auch noch der Zwangsgurt, das Anschließen an die Kette sowie das Beineisen.
Neben dem Strafsystem existierten auch noch verschiedene Arten der Belohnung. Insbesondere waren damit bestimmte Vergünstigungen gemeint: Gestattung besonderer Extragenüsse aus dem Spargelde, Lob vor den versammelten Gefangenen, Versetzung in eine höhere Klasse und schließlich die Empfehlung zur Begnadigung oder Beurlaubung. Begnadigungen allerdings blieben allein bewährten Häftlingen der ersten Klasse vorbehalten.101
Entsprechend den oben genannten Ausführungen d’Alinges stand der Arbeitszwang für das Anstaltsleben gleichberechtigt neben den Disziplinarmaßnahmen. Allgemein erkannte man in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Bedeutung der Arbeit für die moralische Entwicklung der Strafgefangenen. Nicht zuletzt deshalb unterlag dieser Bereich auch in den Strukturen des sächsischen Strafvollzugs einer peniblen Reglementierung.
Eine Selbstbeschäftigung war in Ausnahmefällen und unter genauer Festlegung verschiedener Auflagen lediglich den Insassen der ersten und zweiten Disziplinarklasse gestattet. Diese selbstgewählte Beschäftigung durfte nicht bloß der Unterhaltung oder Zerstreuung dienen, sondern sollte eine Anstrengung seiner Arbeitskräfte enthalten. Zudem musste der Gefangene von seinem Arbeitslohn eine Vergütung an die Anstalt zahlen. Das Recht auf Arbeitslohn aber stand den Strafgefangenen keineswegs von vornherein zu, vielmehr betonte die Hausordnung ausdrücklich, dass Häftlinge eben keinen Anspruch auf eine Entlohnung ihrer Arbeit hätten. Ohne eigentliche rechtliche Handhabe wurde damit der Arbeitslohn ein Mittel des Disziplinarkatalogs und nur bei positiver Entwicklung war er geeignet, den ersten finanziellen Rahmen für eine Resozialisierung zu setzen. Mit der Verweigerung des Grundrechts auf Arbeitslohn blieb die sächsische Arbeitsgratifizierungsregelung hinter den Ansprüchen moderner Vollzugstheoretiker, aber auch -praktiker zurück. Zur Verwendung des Arbeitslohns schon während der Haft konnte es nur im Zuge einer Belobigung kommen, ansonsten blieb das Geld für die Insassen unantastbar und immer gefährdet. Eine Einziehung des gesammelten Arbeitslohns erfolgte so nicht etwa nur bei einer Flucht oder der Verweigerung von Angaben über den künftigen Aufenthaltsort bei der Entlassung, sondern auch im Todesfalle. Damit ging ein wesentlicher Anreiz für den Strafgefangenen, sich redlicher und fleißiger Arbeit zu bemühen, wie er in dem konsequenten Recht auf Arbeitslohn bestanden hätte, verloren und damit beraubte man sich auch eines wichtigen Mittels, die angestrebte sittliche Besserung zu erreichen.
Eine neben der Arbeit weitere wichtige Stütze auf dem Wege der moralischen Besserung sah man in konsequenter geistlicher Fürsorge und in einer verbesserten Bildung der Delinquenten, die sich somit auch einer ausgiebigen Regelung erfreuten: Die Gefangenen wurden dabei zur Teilnahme an den religiösen Abhaltungen verpflichtet. Täglich nach dem Frühstück und dem Abendbrot sollte so eine kurze Andachtsübung aller Häftlinge ohne Rücksicht auf Konfession oder Glaubensbekenntnis durchgeführt werden, die an besonderen Tagen von einem Geistlichen abgehalten werden musste. Für alle gesunden Insassen bestand eine Pflicht zum Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes, die nur mit besonderer Genehmigung des Direktors widerrufen werden konnte.
Unterricht billigte man all den Insassen zu, die ihrem Alter und ihrer sonstigen Beschaffenheit nach unterrichtsfähig waren. Allerdings durften nur dazu geeignete Gefangene an den Übungsstunden teilnehmen, die auf Vorschlag des Geistlichen durch die Direktion zu bestimmen waren. Der Unterricht bestand „aus einem regelrechten Schulbetrieb, durch den die Fortbildung der Detinierten in den sogenannten Elementarkenntnissen erreicht werden sollte.“102 Hierzu zählten Zeichnen, Schreiben, Rechnen usw.
Die drei Hauptmahlzeiten wurden von den Gefangenen gemeinsam eingenommen, was die Einhaltung des Schweigegebotes kaum befördert haben dürfte. Zudem stand den Häftlingen eine Brotportion zu, die je nach Körperbeschaffenheit und Arbeitsleistung individuell festzulegen war. Ebenfalls in schöner Ausführlichkeit ergingen sich die Regelungen der Hausordnung zur Körperpflege, der im Zeitalter verstärkter Hygiene besondere Aufmerksamkeit wohl nicht zu Unrecht gewidmet wurde. Die Aufsicht über die Reinigung und die Haftung für deren ordnungsgemäße Erfüllung oblag den Ältesten. Zugebilligt wurde den Gefangenen schlussendlich täglich noch eine Stunde Bewegung an der frischen Luft.