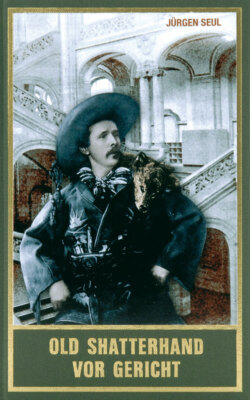Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Karl Mays Arbeitshauszeit
ОглавлениеMan wird davon ausgehen können, dass May ein vorzüglicher Gefangener war, jemand, der die geforderte sittliche Besserung zu erkennen gab. Dies wiederum führte dazu, dass ihn die Anstaltsleitung erneut als Schreibkraft einstellte. Er wurde besonderer Schreiber des Anstaltsinspektors Karl August Alexander Krell (1827-1896).
Der gebürtige Leipziger wirkte seit dem 1. Oktober 1863 als Anstaltsinspektor für das neu errichtete Isoliergebäude. In Mays Erinnerung nahm er eine sehr positive Stellung ein:
„Mein Inspektor war [...] neben seiner Direktion des Isolierhauses noch beruflich schriftstellerisch tätig. Diese seine Tätigkeit bezog sich auf die besondere Statistik unserer Anstalt und auf das Wesen und die Aufgaben des Strafvollzuges überhaupt. Er schrieb die hierauf bezüglichen Berichte und stand mit allen hervorragenden Männern des Strafvollzuges in lebhafter Korrespondenz. Meine Aufgabe war, die statistischen Ziffern zu ermitteln, sie auf ihre Zuverlässigkeit zu untersuchen, sie zusammenzustellen, zu vergleichen und dann die Resultate aus ihnen zu ziehen.“ 103
Tatsächlich handelte es sich bei Alexander Krell um einen außergewöhnlichen Vertreter seiner Zunft. In bester philanthropischer und pädagogischer Tradition plädierte er für mehr Mitgefühl mit den Gefangenen. Auf Veranlassung von d’Alinge und unter Mays Mitwirkung erarbeitete Krell den ‚Jahresbericht über Zustände und Ergebnisse bei der Strafanstalt Zwickau mit der Hilfsanstalt Voigtsberg während des Jahres 1867‘ wie auch ‚Das Zellenhaus bei der Strafanstalt Zwickau. Erfahrungen und Beobachtungen über die Einzelhaft‘ von 1869. Beide Berichte entstanden mehr oder weniger parallel und machten eine Hilfskraft an der Seite Krells notwendig. Die intensive Mitarbeit an der Seite Krells und die Kenntnisse, die er dabei über den Strafvollzug, speziell in Zwickau gewann, unterstützten Mays positive psychologische Entwicklung während der Haftzeit. Die Bevorzugung, die er durch die Einweisung in jene Vertrauensstellung empfinden musste, dürfte ebenso wie seine Versetzung in die erste Disziplinarklasse ein Übriges dazu beigetragen haben.
Mays Mitarbeit an Krells Berichten führte nicht nur zu einer Stabilisierung des Selbstwertgefühls, sondern schuf auch ein für die Geschichte des Strafvollzugs wertvolles Zeitdokument. Den Tag verbrachte May somit in der Schreibstube, nachts wurde er in einer isolierten Zelle untergebracht.
Über die Zellenunterbringung hieß es in einer Mitteilung aus dem Jahre 1866, dass die Sträflinge „theils in Gemeinschaftshaft, nur zum Theil mit nächtlicher Isolirung, theils in Einzelhaft“104 gehalten würden. Und noch in einer Statistik des Jahres 1873 waren lediglich angegeben: 83 Zellen für nächtliche Isolierung und 176 Zellen für Einzelhaft, wovon auf das zwischen 1862 und 1864 errichtete besondere Isoliergebäude 144 Zellen entfielen.
Zwar entsprachen diese Zellen aus heutiger Sicht nicht den Kriterien des modernen Strafvollzugs, zur damaligen Zeit jedoch stellten sie bemerkenswerte technische Fortschritte und gute hygienische Lösungen dar. May berichtet später davon, dass er schon zu Beginn seiner Inhaftierung von dem „Wunsch erfüllt“ gewesen sei, „isoliert zu werden.“ 105
Diesem Wunsch war jedoch nicht entsprochen worden, da die üblichen Gründe für eine Isolierhaft bei May nicht vorgelegen hatten. Solche Gründe waren etwa die Gemeingefährlichkeit des Inhaftierten oder wenn der betreffende Häftling etwa die übliche Kollektivhaft nicht als Strafe hätte empfinden können.106
Daneben existierte allerdings noch die Möglichkeit, dass „Isolirung [...] je nach dem individuellen Bedürfnisse als Heilmittel auf kürzere oder längere Zeit, oder auf die Dauer der ganzen Detention“107 gewährt werden konnte, also Isolierhaft nicht als Instrument der besonderen Bestrafung, sondern als Vergünstigung gehandhabt wurde. Allen bekannten Umständen zufolge, ist davon auszugehen, dass May auf Grund seines Gesamtverhaltens, seines persönlichen Wunsches und der guten Beziehung zu Göhler etwa ab Ende 1867 tatsächlich noch in dem neuen Isoliergebäude unmittelbar neben dem Arbeitszimmer des Inspektors einquartiert worden ist.108
Zu den bemerkenswertesten Äußerungen Mays über seine Inhaftierung in Schloss Osterstein gehört seine Einschätzung, dass sich die „Strafzeit in eine Studienzeit“109 verwandelt habe. Tatsächlich hat sich May wohl vor allem in der Zeit seiner Isolierhaft literarischen Studien zugewandt. So lässt sich bei ihm ein „intensives und zielbewußtes Bemühen“ erkennen, „sich zum Literaten zu bilden und als solcher künftig seinen Lebensunterhalt bestreiten zu wollen“.110
Da er als Lehrer nicht mehr arbeiten durfte, machte er sich notwendigerweise Gedanken über seine berufliche Zukunft. Die Hinwendung zum literarischen Fach lag auf Grund früher Neigung nicht fern. Planmäßig ging er bei der Umsetzung dieser Perspektiven vor:
„Ich legte mir eine Art Buchhaltung über diese Pläne und ihre Ausführung an; ich habe sie mir heilig aufgehoben und besitze sie noch heut. Jeder Gedanke wurde in seine Teile zerlegt, und jeder dieser Teile wurde notiert. Ich stellte sogar ein Verzeichnis über die Titel und den Inhalt aller Reiseerzählungen auf, die ich bringen wollte. Ich bin zwar dann nicht genau nach diesem Verzeichnisse gegangen, aber es hat mir doch viel genützt, und ich zehre noch heut von Sujets, die schon damals in mir entstanden.“ 111
Gemeint ist das Repertorium C. May.112 Auf „30 Folioseiten mit großem Zwischenraum in 137 Gruppen notiert, enthält das Verzeichnis über 200 Themenstichworte, wenige erläuternde Bemerkungen [...]. Tatsächlich sind in dem Titelverzeichnis zahlreiche Details vorweggenommen, so etwa die Frauencharaktere (Nr. 70), die später Eingang in die Kolportageromane, zum Beispiel den Verlorenen Sohn, fanden. Damals noch nicht entstanden war die Idee der großen Orient- und Amerikaromane, der Reiseerzählungen. Die Notizen legen eine kurzgefaßte Umfangsplanung nahe und lassen fast durchweg die Bestimmung für lokale Unterhaltungsblätter vermuten.“113
Die Inspiration zu dieser buchhalterischen Erfassung literarischer Ideen wird May durch seine aktuelle Schreibtätigkeit für Krell gekommen sein. Ähnliche Auflistungen aus seinem späteren schriftstellerischen Leben sind jedenfalls nicht überliefert. Ein weiteres inspirierendes Erlebnis fand außerhalb der Zwickauer Anstaltsmauern in Mays Elternhaus statt. Dort erschien im Laufe des Jahres 1867 der Dresdner Verleger Heinrich Gotthold Münchmeyer (1836-1892). Münchmeyer suchte Autoren für sein Unternehmen und May – als er von seinen Eltern informiert worden war – knüpfte sogleich große Hoffnungen für seine berufliche Zukunft. „Auch schriftstellerte ich fleißig“, berichtete er später über diese Zeit. „Ich schrieb Manuskripte, um gleich nach meiner Entlassung möglichst viel Stoff zur Verfügung zu haben.“ 114
Der Münchmeyer-Verlag war im Herbst 1862 als Verlagsbuchhandlung gegründet worden. Erste Lieferungswerke wie auch die Wochenzeitschrift Feierstunden am deutschen Herd waren seither erschienen; die Produktpalette des kleinen Verlags war noch sehr übersichtlich. Da das Geschäft klein war, hatte H. G. Münchmeyer zwischen 1864-1866 auch den Vertrieb wahrgenommen, wobei ihm seine zuvor in jahrelanger Erfahrung gewonnenen Erkenntnisse als Kolporteur zugute kamen. Die erzielten Geschäftserfolge mögen ihn und seinen vermögenden Bruder Friedrich Louis Münchmeyer (1829-1897) dazu bewogen haben, den gemeinsamen Betrieb auf eine breitere Kapitalgrundlage zu stellen. Beide lagerten im Laufe des Jahres 1866 ihr Geschäftslokal in ein Hintergebäude in der Dresdner Ammonstraße 33 aus; Anfang 1868 traten sie dann als ‚Gebrüder Münchmeyer‘ auch mit dem Buchhandel in Verbindung.115
Der zu jener Zeit noch in Schloss Osterstein inhaftierte Karl May begann mit der Skizzierung literarischer Arbeiten. So unternahm er mit dem Fragment Offene Briefe eines Gefangenen116 den Versuch, „das Zwickauer Strafvollzugssystem, mit dem ja durchaus etwas Neues versucht wurde, in populärer Form darzustellen und es auf diese Weise einem größeren Publikum einsichtig und verständlich zu machen. Das Schlagwort Besserung und der Hinweis auf verschiedene Haftsysteme läßt eine solche Absicht jedenfalls naheliegend erscheinen.“117 In Schloss Osterstein entstand vermutlich auch jenes Gedicht, das in einer Handschrift unter dem Titel Weihnachtsabend118 mit 16 Strophen erhalten geblieben ist und das leitmotivisch die Reiseerzählung Weihnacht! prägt. Bedeutsam für die Entstehungsgeschichte des Gedichtes ist die dritte Strophe, worin der Karl-May-Verleger Roland Schmid (1930-1990) die akustische Situation in Zwickau widergespiegelt sah. Das Indiz für diese Ansicht sah er darin, dass allein in der Nähe der Anstaltskirche ein Geläut von vier weiteren Glockentürmen ertönte.
Zur Unterstützung seiner literarischen Aktivitäten nutzte May die Möglichkeit, eine Stunde täglich in der Bibliothek des Arbeitshauses zu lesen. Dass May diese Literatur nicht nur als Leser konsumiert hat, sondern eigenen Angaben zufolge „die Bibliothek der Gefangenen zu verwalten“119 hatte, muss allerdings bezweifelt werden. „Eindeutige Belege dafür [...] liegen nicht vor. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, daß er während seiner Isolierhaft gewisse bibliothekarische Arbeiten in der separaten Bücherei für die Zellengefangenen verrichtet hat. Die eigentliche Verwaltung dieser Spezialbibliothek lag freilich in den Händen des ersten Anstaltskatecheten“120 und Organisten Carl Leberecht Reinhold Hohlfeld (1826-1904). Immerhin lässt sich konstatieren, dass May während seiner Zwickauer Inhaftierung ernsthaft an einer schriftstellerischen Laufbahn zu arbeiten begann – wenn auch von Winnetou noch nicht die Rede war.
Mays positive Entwicklung ließ sehr bald den Gedanken an ein Gnadengesuch entstehen. Eine Begnadigung konnte „nur solchen Gefangenen zu Theil werden, welche einen Theil, in der Regel sogar einen beträchtlichen Theil ihrer Strafzeit bereits verbüsst haben. Zu dieser Gnade muss der Detinirte empfohlen werden und sie ist es, die wir allein im Auge haben. Zu dieser Begnadigung dürfen nur solche Sträflinge empfohlen werden, welche der ersten Classe angehören und in derselben bereits längere Zeit durch ihr Betragen den Beweis geliefert haben, dass sie ihr Vergehen ernstlich bereuen und wirklich gebessert sind.“121 Ein solches Bereuen und Gebessertsein sah die Anstaltsleitung bei May als gegeben an.
„Das Schicksal schien mit meinen Vorsätzen einverstanden zu sein. Es spendete mir, als ob es mich für alles Leid entschädigen wolle, eine reiche, hochwillkommene Gabe: Ich wurde begnadigt. Die Direktion hatte für mich ein Gnadengesuch eingereicht, auf welches ich ein volles Jahr meiner Strafzeit erlassen bekam.“ 122
Die normale Strafzeit hätte bis zum 13. Juli 1869 gedauert. Sie verkürzte sich durch den Straferlass also um acht Monate und elf Tage. Originalbelege für den Gnadenakt König Johanns (1801-1873) gegenüber dem Häftling Karl May sind nicht überliefert. Erhalten geblieben ist immerhin die ‚Handtabelle der Strafanstalt Zwickau 1863-1865‘. Sie vermerkt über „Carl Friedrich May“ u. a.:
Am 2. November 1868 in Folge Allerhöchster Gnade entlassen.123
Und als May an jenem 2. November 1868 hoffnungsfroh die Anstaltsmauern von Schloss Osterstein hinter sich ließ, erfolgte auch eine Mitteilung der Zwickauer Anstaltsdirektion an das Polizeiamt Leipzig darüber, dass
der vormalige Lehrer Carl Friedrich May, eingeliefert vom Königl. Bez. Ger. Leipzig zur Verbüssung der ihm wegen Betrugs zuerkannten Arbeitshausstrafe von Vier Jahren 1 Monat [...] nach erfolgter Begnadigung am heutigen Tage wieder von hier entlassen worden (ist).124
Die Mitteilung erfolgte deshalb, weil das Polizeiamt Leipzig die polizeilichen Ermittlungen geführt hatte. May wurde bei seiner Entlassung mit einigen Dokumenten ausgestattet, das wichtigste darunter war das Vertrauenszeugnis. Es bestätigte, „dass der Gefangene durch längere tadellose Führung in der Anstalt sich des öffentlichen Vertrauens würdig gemacht hat. In der Regel können nur die Detinirten erster Classe dieses Zeugnis erhalten. Bei Ertheilung desselben ist natürlich sehr vorsichtig und mit grosser Auswahl zu verfahren. Der Director hat die endgültige Entscheidung, ob ein solches Zeugnis ertheilt werden soll oder nicht, wird aber die Meinung der Beamten in einem Berather- oder Beamtenconvente erst hören müssen. Mit diesem Zeugnisse ist der Entlassene nun von aller Polizeiaufsicht frei und ist ihm die Möglichkeit geboten, sich leichter einen rechtlichen Erwerb zu suchen und ihn zu finden.“125 Das Vertrauenszeugnis gestattete May, sich an einem Ort seiner Wahl niederzulassen. Außerdem erhielt er einen Dimissions- und Heimatschein sowie Reise- und Arbeitsentgelt in Höhe von 15 Taler ausgehändigt. So jedenfalls sagte er später bei einer Vernehmung am 3. Juli 1869 gegenüber dem Mittweidaer Staatsanwalt Taube aus.
Die Zwickauer Inhaftierungszeit hinterließ im Werk Karl Mays deutliche Spuren. Auffallend oft geraten die Romanhelden in die Hände ihrer Gegner und werden – aus eigenem Vermögen oder dank der Mithilfe anderer – daraus befreit. Die Häufigkeit dieses Motivs deutet auf ein Hafttrauma hin. Es dürfte kaum ein Zufall sein, dass gerade May Abenteuererzählungen verfasste, in denen vor allem die Ich-Figur mehrfach umfangreiche Weltreisen durch die Wüste bis zum Stillen Ozean unternimmt. „Das wäre wohl nie entstanden, wenn ihr Verfasser nicht acht Jahre seiner Jugend im Kerker hätte verbringen müssen.“126
Die literarischen Beschreibungen des Eingesperrtseins fallen bei May auf. Sie enthalten auch Schilderungen, in denen ganz konkret Inhaftierungen in heimischen Haftanstalten vorkommen. Neben den literarisch verwandelten Auftreten authentischer Personen schildert May in Der verlorene Sohn sein eigenes Schicksal, dramaturgisch aufgesplittet in mehrere Protagonisten, die in Konflikt mit dem Gesetz geraten. In diese Situation geraten sie – das ist auch für Mays Sicht auf seine eigenen Straftaten bedeutsam – zumeist unschuldig!