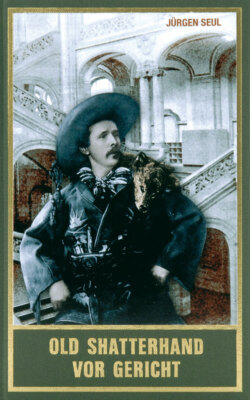Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. Verfehlungen und Straftaten (1859-1864) 1. Der Kerzendiebstahl
ОглавлениеWenn man von Karl Mays Straftaten spricht, wird man um die Schilderung jenes Waldenburger Vorfalls im November 1859 nicht herumkommen. Dieses Ereignis ist insofern von Bedeutung, weil es dem jungen May eine erste schwere Demütigung durch die Obrigkeit einbrachte. Der Vorfall deckt auch exemplarisch ein Verhaltensmuster des jungen Webersohnes auf, vor allem sein teilweises Ignorieren gesellschaftlich-konventioneller Gefahrensituationen, das ihn sein Leben lang begleiten sollte.
Waldenburg, im mittelsächsischen Hügelland gelegen, zählte Mitte des 19. Jahrhunderts etwa 3000 Einwohner. Am südlichen Ufer der Zwickauer Mulde erstreckte sich damals noch die selbstständige Gemeinde Altstadt Waldenburg. Auf Veranlassung des Landesfürsten Otto Victor von Schönburg war hier 1844 ein Lehrerseminar eröffnet, ein Jahr zuvor der Seminarbau fertiggestellt worden.
Für den jungen Webersohn setzten die materiellen Bedingungen des Elternhauses bei der Berufswahl enge Grenzen. Der einzige Sohn der Familie sollte nicht in die väterlichen Fußstapfen am Webstuhl treten, sondern eine bessere berufliche Zukunft haben. Aber es wurde sehr bald klar, dass die Mittel für das gewünschte Medizinstudium nicht vorhanden waren. Möglich blieb alleine ein bescheidenes Volksschullehrerstudium.
„Der Herr Pastor legte ein gutes Wort für mich bei unserm Kirchenpatron, dem Grafen von Hinterglauchau, ein, und dieser gewährte mir eine Unterstützung von fünfzehn Talern pro Jahr, eine Summe, die man für mich für hinreichend hielt, das Seminar zu besuchen. Zu Ostern 1856 wurde ich konfirmiert. Zu Michaelis bestand ich die Aufnahmeprüfung für das Proseminar zu Waldenburg und wurde dort interniert. Also nicht Gymnasiast, sondern nur Seminarist! Nicht akademisches Studium, sondern nur Lehrer werden!“ 10
Eine andere finanzielle Unterstützung, etwa durch das Ernstthaler Armenkomitee oder aus dem fürstlichen Fond für mittellose Seminaristen, blieb trotz Anträgen versagt. Die finanzielle Hauptlast hatte die Familie zu tragen. Die Aufnahmeprüfung absolvierte May am 29. September 1856 erfolgreich. Er tauchte in den bedrückenden Waldenburger Alltag ein, der zwischen täglichen Andachten reichlich Religions-, Bibel- und Gesangstunden bot. „Der Unterricht war kalt, streng, hart. Es fehlte ihm jede Spur von Poesie. Anstatt zu beglücken, zu begeistern, stieß er ab.“ 11
Mays Skizzierung von Waldenburg zeichnet ein Horrorszenario für einen jungen Menschen voller Fantasie und Wissensdrang. Trotzdem erwies sich der junge Webersohn als ein guter Seminarist, der zu Michaelis 1857 in das Hauptseminar (4. Klasse) aufrückte und auch diese Klasse erfolgreich durchlief. Er habe – so berichtet er später – in seiner Freizeit komponiert und bereits gedichtet. Seine Beziehungen zum Lehrkörper dürften stets gespannt gewesen sein. Wesentlich zum Unwohlsein in Waldenburg werden auch die Begleiterscheinungen der Pubertät beigetragen haben, die sich mit den strengen Regeln einer solchen Anstalt nur schwerlich vereinbaren ließen. Überhaupt zog es ihn, wann immer die Möglichkeit bestand, in das zwei Fußstunden entfernt gelegene heimatliche Ernstthal zurück.
Das Ungemach nahm für den jungen Seminaristen seinen Lauf, als er das harmlose Amt des ‚Lichtwochners‘ übertragen bekam. Diese Aufgabe bestand darin, verbrauchte Talgkerzen, die der Beleuchtung der Unterrichtsräume dienten, gegen neue auszutauschen. Eines Tages nahm er sechs Kerzen aus dem Vorrat der Anstalt an sich und versteckte sie in seinem unverschlossenen Koffer in einer Rumpelkammer. Selber spricht May von „Talgresten“12, die er an sich genommen hatte und in den Weihnachtsferien mit nach Hause nehmen wollte, um den armen Angehörigen damit eine Freude zu machen. Unglücklicherweise wurde dieser Vorgang jedoch von zwei Mitschülern entdeckt, die den geheimen Kerzenvorrat in einem unverschlossenen Koffer vorfanden und sie dem fungierenden Lichtwochner übergaben. Eine Mitteilung an die Seminarleitung unterblieb einstweilen. Das änderte sich erst im Rahmen einer Untersuchung, die den Diebstahl zweier Thaler aufzuklären versuchte. Jetzt wurde auch Mays ‚Kerzendiebstahl‘ der Seminarleitung zur Kenntnis gebracht. Damit schien auch der Gelddieb ermittelt zu sein. Die Seminarlehrer traten zur Konferenz zusammen, in der May Rede und Antwort zu stehen hatte. Ein Bericht13 über diese Konferenz gibt Auskunft: Mays Einlassung, „er habe die Rückgabe der Lichter nur vergessen“, wurde verständlicherweise kein Glauben geschenkt. Zur Beurteilung des Falles zogen die Pädagogen das bisherige Verhalten des Seminaristen heran.
„Die Lehrer haben“, so berichtet der Seminarleiter Friedrich Wilhelm Schütze (1807-1888),
bei diesem Schüler hie und da über arge Lügenhaftigkeit und über rüdes Wesen Klage zu führen gehabt. Wie schwach sein religiöses Gefühl sein müsse, geht unter Anderm aus folgendem Falle hervor. Als die Anstalt in der Fastenzeit dieses Jahres zum heiligen Abendmahl gewesen, hatte sich May von dem angeordneten Besuch des Nachmittagsgottesdienstes absentirt. Dem die Tagesinspection führenden Lehrer hatte er seine heimliche Entfernung anfänglich geleugnet und sogar Mitschüler genannt, neben denen er in der Kirche gesessen haben wollte.
Derlei Verhaltensauffälligkeiten eskalierten bei den Bildungs- und Erziehungswächtern der Lehranstalt rasch zur Feststellung, dass man bei dem Zögling May
die Verdorbenheit seines Gemüthes und Herzens gleichsam offen darlegen konnte.
Nicht beweisen ließ sich dagegen,
daß May die dem Proseminarist Schäffler abhanden gekommenen zwei Thaler an sich genommen habe.
Und obwohl der Gelddiebstahl nicht aufgeklärt werden konnte, genügte das gegen Karl May Vorgebrachte, um das Schönburgische Gesammtconsistorium in Glauchau zu bitten:
Hochdasselbe wollen geruhen, diesen Bericht mit thunlichster Beschleunigung an das Hohe Ministerium des Cultus und öffentlichen Unterrichts gelangen zu lassen und Hochdasselbe um eine Entschliessung darüber zu ersuchen, ob und in welcher Weise der Zögling unserer zweiten Seminarclasse, Carl Friedrich May, aus Ernstthal bei Hohenstein gebürtig, aus dem Seminar entlassen werden sollte.
Unterzeichner der Bitte war Seminarleiter Schütze, der May selber in den Fächern Biblische Geschichte und Pädagogik unterrichtete. Das Ministerium reagierte mit unnachgiebiger Härte und entschied mit Beschluss vom 17. Januar 1860,
den Zögling der zweiten Classe des Schullehrerseminars zu Waldenburg, Karl Friedrich May aus Ernstthal bei Hohenstein, wegen sittlicher Unwürdigkeit für seinen Beruf auf Grund von § 51 der Seminarordnung vom Jahre 1857 aus dem Seminar auszuweisen. Denn würde auch das von gen. May selbst eingeräumte Factum, daß er in der Zeit seines Lichtwochneramtes sechs Lichter zurückbehalten und in seinem Koffer länger als 14 Tage verborgen gehalten hat, obwohl dasselbe, bei der Unglaubhaftigkeit der von May hierunter vorgebrachten Entschuldigung, als eine Veruntreuung sich darstellt, an und für sich die Zuerkennung des letzten Strafgrades nicht nothwendig zur Folge haben müssen, so gebieten dies doch – wie das Geheime Consistorium ganz richtig bemerkt – die sonstigen über das sittliche Verhalten Mays seitens des Lehrercollegii vorgebrachten Klagen in ihrem Zusammenhange mit jenem Vergehen. Hiernach ist nämlich, da sich bei dem Angeschuldigten seither schon arge Lügenhaftigkeit, ein rüdes Wesen, Mangel an religiösem Sinn bemerklich gemacht und er auch sonst bei seinen Mitschülern in dem Verdachte der Unehrlichkeit steht, das Vorhandensein der Haupteigenschaften, die zu dem Berufe eines Lehrers befähigen, bei ihm nicht anzunehmen, und es wird dadurch seine Entfernung aus dem Seminar zur Nothwendigkeit.14
Das Ministerium hatte damit die höchstmögliche Strafe gegen Karl May ausgesprochen und das, obwohl das Vergehen „an und für sich die Zuerkennung des letzten Strafgrades nicht nothwendig zur Folge haben müsse“. Die Gründe für die ultimo-ratio-Entscheidung wurden offenbar mehr in Mays Gesamtverhalten als in dem Vorfall selber erblickt. Am 28. Januar 1860 erfolgte die entwürdigende Entlassung des siebzehnjährigen Karl May im Rahmen einer exekutorischen Prozedur. Die Kurzbeschreibung des Vorgangs lautete:
In Gemäßheit der Hohen Ministerialentschließung ist der seitherige Seminarist C. F. May s. Ernstthal heute vor versammeltem Lehrercollegio aus der Anstalt entlassen worden.15
Nach Auffassung von Claus Roxin würde „die Entscheidung des Ministeriums heutigen rechtlichen Maßstäben nicht standhalten“ und er begründet dies mit der unzureichenden Berufung der Behörde „auf einen völlig unbewiesenen Verdacht der Unehrlichkeit“.16 Der Entlassene reichte am 6. März des Jahres ein unterwürfiges Gnadengesuch ein:
„So wage ich es denn, einem Hohen Königlichen Ministerio die ganz unterthänigste Bitte vorzulegen, Hochdasselbe wolle in Gnaden geruhen, mir zu gestatten, daß ich mich entweder auf der Anstalt zu Waldenburg oder auf einem anderen Seminare des Landes fortbilden lassen dürfe, damit ich als gehorsamer Schüler und einst als treuer Lehrer im Weinberge des Herrn die That vergessen machen könne, deren Folgen so schwer auf mir und meinen Aeltern ruhen!“ 17
Der Ernstthaler Pfarrer Carl Hermann Schmidt (1826-1901), der sich schon für den Erhalt des Stipendiums eingesetzt hatte, schloss sich mit einem eigenen Gesuch der Bitte Mays an. Und tatsächlich zeigten die Gnadengesuche schließlich Erfolg, denn am 15. März 1860 geruhte das Ministerium, den Bitten zu entsprechen und „bewandten Umständen nach, auch in Folge der Verwendung des Pfarrer Schmidt, welcher dem Ministerio als ein völlig urtheilsfähiger und gewißenhafter Mann bekannt ist, geschehen lassen, daß May in ein anderes Seminar des Landes wieder aufgenommen werde [...].“18
Da keine Bedenken gegen eine Wiederaufnahme in ein anderes Seminar ersichtlich waren, entschied auch das Gesammtconsistorium am 21. März 1860 zu Gunsten Karl Mays auf Wiederaufnahme seiner Lehrerausbildung.19 Das Lehrerseminar in Plauen im Vogtland kam in Betracht. Die Aufnahmeprüfung bestand May am 2. Juni 1861 mit Bravour. Er absolvierte den Rest seiner Ausbildung ohne besondere Vorkommnisse und bestand die Kandidatenprüfung vom 9. bis 12. September 1861 mit der Gesamtnote ‚gut‘. Es fällt jedoch auf, dass Mays Abgangszeugnis in der Rubrik ‚sittliches Verhalten‘ nur die Beurteilung ‚zur Zufriedenheit‘ aufwies, während sich die Mitschüler meist ‚zur besonderen Zufriedenheit‘ verhalten hatten. Vielleicht waren Mays Eigenarten im Umgang mit den Seminargepflogenheiten – zumindest in harmloser Form – auch hier in Plauen zu Tage getreten.