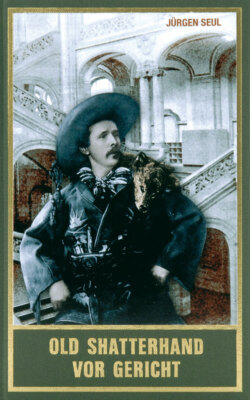Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI. Resozialisierung durch Schriftstellerei (1874-1878)
ОглавлениеNach seiner Haftentlassung kehrte Karl May zunächst einmal nach Ernstthal in sein Elternhaus zurück. Immerhin fand er trotz seiner Vorstrafen wieder die Aufnahme im vertrauten Kreis seiner Familie und ihrer Bekannten. Ausgrenzung oder Ächtung des Vorbestraften und seiner Angehörigen fand nicht statt, denn die Weber und Strumpfwirker, allesamt einfache Leute, ließen einen der Ihren nicht so ohne Weiteres fallen. Sehr deutlich wird diese tolerante Haltung auch durch die Selbstverständlichkeit, mit der in den Folgejahren in die Familie May eingeheiratet wurde.
Seit dem 3. Mai 1874 befand sich May nun unter der Aufsicht des Ratspolizeiwachtmeisters Christian Friedrich Dost (1828-1902), der fortan ein wachsames Auge auf den ehemaligen Zuchthäusler zu werfen hatte. Vergeblich beantragte dieser beim Bürgermeister einen Auslandspass. Dieses Bemühen zeigt an, dass May wenig Zuversicht in seine berufliche und persönliche Zukunft in der Heimat hatte.
Ob in der ersten Zeit der wiedererlangten Freiheit bereits Manuskripte veröffentlicht wurden, lässt sich heute nicht mehr feststellen, wenngleich überliefert ist, dass er literarisch tätig war. So soll ein Eckfensterplatz im Gasthaus ‚Zur Stadt Glauchau‘ ein bevorzugter Schreibort gewesen sein. Entsprechend äußerte er sich später anlässlich einer Vernehmung vor dem Landgericht Dresden vom 6. April 1908:
„Nach Verbüßung meiner letzten Strafe im Jahre 1874 bin ich wieder nach Ernstthal gegangen, habe dort bei meinen Eltern gewohnt, und bin ebenfalls wieder schriftstellerisch für mehrere Zeitungen tätig geworden.“ 205
Nähere Angaben zu den Zeitschriften machte er nicht, weshalb eine Nachprüfung des Sachverhalts schwierig ist. Dennoch muss man davon ausgehen, dass May in jedem Fall den literarischen Weg einschlagen wollte. Und erneut verband er seine beruflichen Hoffnungen mit dem Namen Münchmeyer. Der bereits früher bestandene Kontakt dürfte während der Zuchthauszeit vollends abgebrochen gewesen sein – vor allem auch bedingt durch den Umstand, dass ihm in Waldheim jegliche literarische Tätigkeit verboten war.
„Wollte er mit Münchmeyer oder auch mit anderen Verlagen, auf die ihn vielleicht die Produkte umherziehender Kolporteure hinwiesen, in Verbindung treten, so bestanden die größten Erfolgsaussichten freilich nur dann, wenn er gute Manuskripte anbieten konnte. Also hieß es arbeiten. Wir werden daher kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß einige von den erhalten gebliebenen Fragmenten aus der Frühzeit in den Monaten zwischen Mai 1874 und März 1875 entstanden sind.“206
Unter den Arbeiten jener Zeit findet sich auch auch der Versuch zu einem Gefängnisroman mit dem Titel Hinter den Mauern. Licht- und Schattenbilder aus dem Leben der Vervehmten von Karl May (in GW 79, Old Shatterhand in der Heimat). Wie Christoph F. Lorenz feststellt, sind hier „bereits die Grundzüge mancher Handlungsstränge erkennbar, die der Schriftsteller später im Verlorenen Sohn verarbeiten und ausführen sollte.“207
Im März 1875 erhielt May Besuch aus Dresden. Der bereits erwähnte Kolportageverleger H. G. Münchmeyer und sein Bruder sahen in ihm ihren neuen Mitarbeiter. Sie boten ihm eine Redakteursstelle im Verlag an und May nahm das Angebot dankbar an. Für ein jährliches Salär von 600 Talern sollte er fortan in Dresden leben und arbeiten. Am 8. März reiste er in die Elbmetrople ab. Schon vier Tage später erhielt die Kriminalpolizei in Dresden eine Anzeige darüber, dass „der unter Polizeiaufsicht stehende May daselbst eine Redakteursstelle angetreten habe und‚ daß derselbe neben dieser Funktion auch seine frühere verbrecherische Laufbahn teilweise wieder betreten dürfte.“208
Es handelte sich um eine schlichte Denunziation ohne sachlichen Hintergrund, ausgeführt vom Hohensteiner Gendarm-Brigadier Friedrich Frenzel (1833-1912), wobei der pflichtbewusste Staatsdiener irrtümlich nur von einem Jahr Polizeiaufsicht ausging.
Die Dresdner Polizei-Direktion verfügte daraufhin am 15. März die Ausweisung des Jungredakteurs. Es handelte sich hierbei um einen behördlichen Vorgang, der im ersten Moment das Ende der soeben begonnenen Resozialisation befürchten ließ. Deutlich klingt der Schock zwischen den Zeilen durch, die May in einer längeren Eingabe vom 16. März an die Dresdner Polizei-Direktion richtete:
„Wer da weiß, wie schwer es dem entlassenen Strafgefangenen wird, sich aus dem Schmutze emporzuarbeiten, der wird begreiflich finden, daß ich mit innigster Freude und Genugtuung dem Rufe gefolgt und in die gebotene Stellung eingetreten bin. [...] Die hohe Königliche Polizei-Direktion wolle in Rücksicht darauf, daß meine Stellung eine fixierte und sichere ist und mir nach Verlauf von fünf Wochen der Aufenthalt in Dresden doch gestattet sein würde, einmal gütige Nachsicht hegen und mich durch die Domicil-Verweigerung nicht in Not und neue Schande stürzen! Sollte diese Bitte erfüllt werden, so würde ich in steter Dankbarkeit der Humanität gedenken, welche meinen Eltern die bitterste Kränkung erspart und mir das Fundament läßt, auf welchem ich mir eine bessere Zukunft errichten möchte.“ 209
Die Humanität der Behörden ignorierte auch dieses Mal Mays Bitte. Man bestand höheren Ortes auf der Ausweisung und forderte May am 24. März auf, Dresden binnen drei Tagen zu verlassen. Am 27. März saß er wieder in Ernstthal. „Die Ausweisung war“ – wie Roxin befindet, „ungerechtfertigt und hätte leicht – wie frühere behördliche Überreaktionen – seine Laufbahn ein weiteres Mal zerstören können. Aber diesmal überwand May den Schock: Es gelang ihm, seine redaktionelle Tätigkeit von Ernstthal aus zu leiten und daneben auch literarisch zu arbeiten. Im August des Jahres gelang ihm jedoch eine Aufhebung des Ausweisungsbeschlusses zu erwirken, sodass er nun nach Dresden zurückkehren konnte. Gegen Ende des Jahres 1875 verlegte er sogar seine Wohnung in das Verlagsgebäude Münchmeyers, wo auch dieser selbst mit seiner Familie lebte.“210
Im Münchmeyer-Verlag betreute der Neuredakteur zunächst als Nachfolger von Otto Freitag (1839-1899) die Zeitschrift Der Beobachter an der Elbe, die er zum Herbst 1875 hin auslaufen ließ. An ihre Stelle traten ab September 1875 das Deutsche Familienblatt und Schacht und Hütte. Beide Blätter hatten keine sehr lange Laufzeit. Während Schacht und Hütte nur einen Jahrgang erlebte, erschien das Deutsche Familienblatt ein weiteres Jahr. Eine vierte Zeitschrift unter der redaktionellen Leitung Mays, die Feierstunden am häuslichen Heerde erschien von September 1876 bis September 1877.
Neben seiner Tätigkeit als Redakteur der genannten Zeitschriften versorgte May alle vier Publikationen mit eigenen Autorenbeiträgen. Hierunter zählt auch die Wildwesterzählung Old Firehand (in GW 71, Old Firehand), in der erstmalig der Apatschenhäuptling Winnetou auftritt, wenngleich sich die Persönlichkeit der berühmtesten Romanfigur hier noch deutlich von jener ausgereiften Gestalt des Edelindianers unterscheidet, als die May sie später schildern sollte. Auch in anderen Zeitschriften außerhalb des Münchmeyer-Verlages veröffentlichte er erfolgreich vereinzelte Novellen und Humoresken.
Es gelang May gleichermaßen, sich als Redakteur zu profilieren wie auch als Autor in der Literaturszene des damaligen Zeitschriftenmarktes Fuß zu fassen. Somit bot sich ihm, anders als nach seiner Entlassung aus Schloss Osterstein, tatsächlich die realistische Möglichkeit einer Resozialisierung durch die Ausübung eines existenzsichernden Berufes als Redakteur und Schriftsteller.
Die wichtigste Beziehung knüpfte er in jener Zeit jedoch zu Emma Pollmer (1856-1917), einer als Vollwaise im Haus ihres Großvaters Christian Gotthilf Pollmer (1807-1880) aufgewachsene Lokalschönheit aus Hohenstein. May hatte sie bei einem Besuch in der Heimat kennengelernt. Die Beziehung war von Anfang an problematisch, da sich Emma Pollmers Großvater wenig davon angetan zeigte. Dabei waren es weniger Mays Vorstrafen, die den alten Pollmer auf Distanz gehen ließen, als vielmehr die Aussicht, dass sich die Enkeltochter an einen hungerleidenden Literaten zu verschenken drohte.
Doch auch von neuen juristischen Verwicklungen blieb May nicht verschont. So meldeten die Dresdner Nachrichten vom 25. Mai 1875 über das Ergebnis einer „Oeffentliche[n] Gerichtssitzung am 21. u. 22. Mai [...] – Johann Schumann war wegen Beleidigung Carl May’s zu 15 Mark Strafe verurtheilt (worden), wogegen er erfolglos Einspruch erhob.“211 Die nachgewiesene Faktenlage zu diesem Fall erschöpft sich mit dieser Mitteilung. Es lässt sich lediglich daraus schlussfolgern, dass ein Beleidigungsverfahren vor dem Amtsgericht Dresden stattgefunden hatte, dessen Urteil nach eingelegtem Einspruch (Berufung) im anschließenden Instanzenweg vor dem Landgericht Dresden bestätigt worden war. Wer Johann Schumann war und mit was er Karl May beleidigt hatte, ist leider nicht bekannt.
Zu einer Zeit, als Karl May noch im Zuchthaus Waldheim einsaß, erschienen 1874 im Münchmeyer-Verlag zwei umfangreiche Lieferungsromane. Der umständliche und umfangreiche Titel des einen Werkes war:
Die Geheimnisse der Venustempel aller Zeiten und Völker oder die Sinnenlust und ihre Priesterinnen. Geschichte der Prostitution und ihrer Entstehung, sowie die Darstellung ihrer Folgen auf die Entwickelung der Menschheit.
Der zweite nicht weniger langatmige Titel lautete:
Die Geschlechtskrankheiten des Menschen und ihre Heilung. Mit besonderer Berücksichtigung der Syphilis, ihrer Entstehung und Folgen. Mit über 100 allopatischen, sowie homöopathischen Reception versehen, zur Heilung aller Krankheiten, welche die Geschlechtsorgane betreffen.
Wesentlich zum Entstehen dieser Lieferungswerke beigetragen hatte der seit 1873 im Verlag tätige Redakteur Otto Freitag. Nach Mays Darstellung soll Freitag zumindest das erste der beiden Aufklärungsbücher, den Venustempel, als Alleinverfasser in die Welt gesetzt haben. Und dieses Buch soll auch der Grund dafür gewesen sein, dass Freitag Anfang 1875 aus dem Verlag ausschied, weil man von Verlagsseite aus seinen Redakteur „an dem Gewinn, den das Werk brachte, nicht partizipieren ließ.“ 212
Tatsächlich handelte es sich um das recht dreiste Plagiat eines im Berliner Verlag von Dr. Langmann herausgegebenen Lieferungswerkes. Als verantwortlicher Verleger fungierte Friedrich Louis Münchmeyer.
Aus einer Pressemeldung geht hervor, dass „unmittelbar nach dem Erscheinen des ersten Heftes des in einzelnen Lieferungen erscheinenden Werkes die hiesige Polizei wegen dessen bedenklichen Inhalts mit der hiesigen Justizbehörde sich ins Vernehmen gesetzt [hat], man hat von Gerichtswegen aber die Schrift als eine unzüchtige nicht angesehen. Der entgegengesetzten Ansicht sind aber eine Anzahl anderer Gerichtsbehörden in Preußen und Baiern gewesen, in welchen Ländern das Werk im Colportirwege massenhaft vertrieben worden zu sein scheint. Diese Behörden haben dasselbe als unzüchtig verurtheilt und ist auf deren Requisition seiner Zeit mehrfach gegen dessen Verleger hier vorgegangen und auf Vernichtung der Platten und vorgefundenen Exemplare erkannt worden, wobei derselbe versichert hat, daß er das Werk nicht mehr vertreibe und noch vorhandene Exemplare selbst vernichtet habe.“213
Demnach hatte es im Laufe der Zeit Hausdurchsuchungen im Verlagsgebäude und alsbald Verbreitungsverbote gegeben, so in Bayern als auch bereits am 16. September 1874 in Preußen – noch bevor das Gesamtwerk komplett ausgeliefert worden war. Hinsichtlich beider Werke befand auch das K. K. Landesgericht am 16. Dezember 1874 in Wien als Preßgericht auf Antrag der K. K. Staatsanwaltschaft, dass ihr Inhalt „das Vergehen nach § 516 St. G. begründe, und es wird nach § 499 St. P. O. das Verbot der Weiterverbreitung dieser Druckschrift ausgesprochen.“214
Der Hauptgrund für die Einstellung Mays als Redakteur im Münchmeyer-Verlag lag im Weggang Otto Freitags. May sollte zwar primär als Zeitschriftenredakteur tätig werden, doch nicht auf diesen Bereich beschränkt bleiben. Vielmehr dachte man im Verlag an eine modifizierte Neuausgabe des verbotenen Materials. So verfasste May im Laufe des Jahres 1875 vermutlich auftragsgemäß anonyme Beiträge für das 1876 erscheinende Lieferungswerk Das Buch der Liebe. Wissenschaftliche Darstellung der Liebe nach ihrem Wesen, ihrer Bestimmung, ihrer Geschichte und ihren geschlechtlichen Folgen. Münchmeyers Absicht war es, Restbestände des 1874 verbotenen Aufklärungsbuches Die Geschlechtskrankheiten des Menschen und ihre Heilung wieder neu auf den Markt zu bringen. Es sollte versteckt Teil eines neuen Gesamtwerkes mit dem Titel Buch der Liebe (heute GW 87, Das Buch der Liebe) werden. May dürfte mit seinen Vorstudien im Sommer 1875 begonnen haben. Das verbotene medizinische Werk bildet als Zweite Abtheilung (Die Liebe nach ihren geschlechtlichen Folgen. Geschlechts-, Frauen- und Kinderkrankheiten, Wochenbett und Anleitung zur Selbstheilung) – wahrscheinlich von May geringfügig entschärft – den Hauptteil und sollte vermutlich 848 oder, einschließlich eines Anhangs, 894 Seiten umfassen. Von May stammen die erste Abteilung, in der die Liebe nach ihrem Wesen und ihrer Bestimmung behandelt wird (144 Seiten), und die abschließende Dritte Abtheilung (Die Liebe und ihre Geschichte. Darstellung des Einflusses der Liebe und ihrer Negationen auf die Entwickelung der menschlichen Gesellschaft), die wahrscheinlich auf 256, vielleicht auch 304 Seiten angelegt war und in der – von einem Dritten? – Teile des ebenfalls 1874 verbotenen Lieferungswerkes Venustempel eingearbeitet wurden. Was nun den Inhalt betrifft, so beschreibt May in der ersten Abteilung die verschiedenen Ausprägungen der Liebe.
„Das Hauptaugenmerk gilt der Geschlechtsliebe. Der Mensch, das Ebenbild Gottes, habe die Aufgabe, als Mann die göttliche Allmacht, als Frau die göttliche Liebe zu offenbaren; die Bedeutung der Ehe liege darin, daß sich hier aktive Männlichkeit und passive Weiblichkeit zum Menschen in Gottes Sinn ergänzten. Die Gegensätze strebten dabei zum Ausgleich.“215
Die dritte Abteilung wirkt durch die untergemischten Textteile des Venustempels uneinheitlich. „Schilderungen der gastlichen, religiösen und legalen Prostitution im Altertum oder des aktuellen Dirnenwesens kontrastieren zum Anliegen, ausgehend von der Identität der Liebe mit Gott die geschichtliche Entwicklung des Gottesbegriffs darzustellen.“216 Anschließend versuchte May, die Vereinbarkeit der modernen Evolutionstheorie mit der Vorstellung eines persönlichen Gottes zu beweisen.
Das Werk kam schließlich in Teillieferungen in 14-tägigem Erscheinungsrythmus ab Herbst 1875 auf den Markt. Nur wenige Monate nach Beginn des Erscheinens, am 23. Februar 1876, kam es erneut zu einer folgenschweren polizeilichen Aktion im Verlagsgebäude.
„Eine Tages veranlasste mich Münchmeyer, in die Stadt zu gehen und einige Aufträge für ihn zu besorgen. Er hatte das sehr eilig, obgleich es sich um gar nichts wichtiges handelte. Das fiel mir auf. Es schien, als ob er mich für einige Stunden aus dem Geschäft zu entfernen wünsche. Ich spioniere nie, beeilte mich also keineswegs, hielt mich aber auch nicht länger auf, als nötig war, und kam darum weit eher heim, als er erwartet hatte. Er geriet dadurch in hohe Verlegenheit, denn es gab da eine Menge Polizisten, die nach etwas suchten, was sie nicht finden sollten.“ 217
Die Dresdner Nachrichten vermeldeten in ihrer Nr. 55 vom 24. Februar 1876: „Gestern Vormittag erschienen in dem Hause Nr. 14 des Jagdwegs, worin sich die Münchmeyer’sche Verlagsbuchhandlung befindet, unvermuthet eine größere Anzahl Criminalpolizisten und nahmen alsbald gleichzeitig in allen zu der betr. Buchhandlung gehörigen Localitäten eine gründliche Durchsuchung vor. Dieselbe galt, wie uns mitgetheilt wird, einem im Verlage jener Buchhandlung erschienen Werke, ‚Die Geheimnisse der Venustempel aller Zeiten und Völker oder die Sinnenlust und ihre Priesterinnen‘, welches schon seit einigen Jahren in ganz Deutschland massenhaft im Colportagewege verbreitet worden sein soll, ohne daß man dasselbe früher beanstandet hat. Wir werden über die Sache an competenter Stelle weitere Erkundigung einziehen und deren Resultat mittheilen.“
May konstatierte später:
„Ich sollte nichts davon wissen, sollte es wenigstens erst dann erfahren, wenn es vorüber sei. Darum hatte er mir Aufträge gegeben, um mich fernzuhalten. Ausserdem traute er weder meinen Augen, noch meiner Ehrlichkeit.“
Die Staatsanwaltschaft Dresden erhob im Laufe des Frühjahrs vor dem Amtsgericht Dresden Anklage gegen Friedrich Louis Münchmeyer und Genossen. Amtliche Akten sind nicht mehr vorhanden. In den Findbüchern des Dresdner Staatsarchivs findet sich zu einem Verfahren vor dem Amtsgericht Dresden der Vermerk: „Karl May, Schriftsteller, schreibt angeblich unsittliche Bücher für Verlag Münchmeyer, 1875“.218 Festgehalten ist auch das Ergebnis: „Wird freigesprochen, klag- und straffrei.“ Demnach war May als einer der angeklagten Genossen nicht bestraft worden. Ein weiterer Vermerk besagt: „Hauptklage gegen Verlag Münchmeyer, Dresden, 1875“. Was war geschehen? Es hatte offenbar vor dem Amtsgericht Dresden ein Strafverfahren gegeben, bei dem Karl May, als Verfasser des Buchs der Liebe freigesprochen worden war. Über den Grund seiner Freisprechung berichtet eine vertrauliche Mitteilung des Verlegers Adalbert Fischer an seinen Rechtsanwalt Dr. Felix Bondi vom 5. Juli 1905: „Ferner fand ich ein Urteil, worin Karl May als Mitarbeiter bzw. Redakteur des Venustempels usw. angeklagt ist, des unsittlichsten Buches, was je im Verlage H. G. Münchmeyer erschien! Er wird aber schließlich freigesprochen, weil er einige Stellen gemildert hat usw.“219
Das Verfahren gegen andere Angeklagte war jedoch zu deren Ungunsten ausgegangen. Gegen die Verurteilung war Einspruch eingelegt worden. Eine Notiz in den Dresdner Nachrichten, Nr. 345 vom 8. Dezember 1876, kündigte an: „Einsprüche: Heute Vormittag 9 in geheimer Sitzung wider Friedrich Louis Münchmeyer u. Genossen wegen Vergehen gegen die Sittlichkeit.“
Dass es bei diesem Verfahren auch um Das Buch der Liebe ging, lässt sich dem Umstand entnehmen, dass nur in diesem Buch Friedrich Louis Münchmeyer als verantwortlicher Verleger auf der Titelseite kenntlich gemacht wurde. Eine Woche später wussten die Dresdner Nachrichten, Nr. 351 vom 16. Dezember 1876 über die Verhandlung zu berichten:
„Der hiesige Verlagsbuchhändler Friedrich Louis Münchmeyer und Friedrich Wilhelm Gleißner hier waren in erster Instanz wegen des Verkaufs von Büchern, deren Inhalt gegen die Sittlichkeit verstieß, zu Geldstrafen von je 200 Mark verurtheilt worden. Beide erhoben Einspruch, der in geheimer Sitzung verhandelt wurde und nach einer erfolgreichen Vertheidigung durch Herrn Adv. Dr. Kunath mit der völligen Freisprechung endete.“
Das Buch der Liebe wurde in Österreich am 9. Mai 1877 verboten, da das Buch nach Auffassung der Justizbehörden „durch bildliche Darstellungen [...] die Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit gröblich und auf eine öffentliches Ärgernis erregende Art“ im Sinne des § 516 des Strafgesetzbuchs von 1852 verletzte.
Verbote in Deutschland hat es dagegen offenbar nicht gegeben. Jahrzehnte nach Abfassung des Buches setzte sich May u. a. in seiner Kampfschrift Ein Schundverlag noch einmal mit dem Werk auseinander.
Eine Erwähnung der eigenen Verfassereigenschaft fehlt. Im Gegenteil! May gibt an, der Venustempel „existierte schon lange Zeit vorher, ehe ich die Redaktion übernahm, und wurde in den ersten Wochen sorgfältig vor mir geheimgehalten [...]. Der ‚Venustempel‘, später auch noch ‚Buch der Liebe‘ genannt, war ein Buch, welches auf die allergemeinste Sinnenlust spekulierte. Die jedem Hefte beigegebenen phrynischen220 Buntdruckbilder waren nackt und frech im höchsten Grade. Hunderte von Textzeichnungen illustrierten die Begattung und ihren Verlauf in jeder, sogar der unnatürlichsten Weise.“ 221
An anderer Stelle klagt der Schriftsteller ausdrücklich:
„Man hat mich aus prozessualen Gründen fälschlicher Weise beschuldigt, für Münchmeyer das ‚Buch der Liebe‘ geschrieben zu haben. Wie kann ich beweisen, daß dies unwahr ist?“ 222
Dass May entgegen seiner Aussage doch ein Mitverfasser des Buches war, geht u. a. aus dem Umstand hervor, dass er im Rahmen eines Prozessvergleichs mit dem Verleger Adalbert Fischer (des Käufers des Münchmeyer-Verlags) ein Buch der Liebe-Fragment, nämlich einen Druckbogen von 16 Seiten, ausgehändigt bekam. Auf einem neutralen Umschlag, in den der Bogen eingeheftet ist, befindet sich die handschriftliche Notiz Karl Mays:
„Das / ‚Buch der Liebe‘, / welches ich von Fischer / zurückerhalten habe. / K. May.“ 223
Der Schriftsteller bekannte sich damit eindeutig als Verfasser des Textes. Die Verleugnung der Autorenschaft war für die Auseinandersetzungen in den Gerichtsverfahren nach der Jahrhundertwende wichtig. Es ging May aus prozesstaktischen Gründen darum, die Unmoral des Münchmeyer-Verlags, seiner Verleger und Mitarbeiter darzulegen. Damit wollte er den gegen ihn vorgebrachten Vorwurf der Urheberschaft sittlich anstößiger Texte von sich weisen.