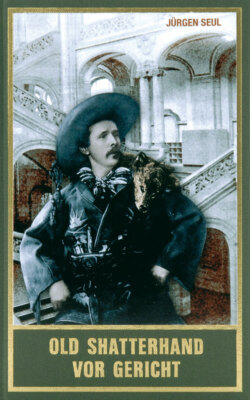Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
V. Karl May im Zuchthaus Waldheim
ОглавлениеDie Kleinstadt Waldheim verfügte nicht nur über die erste Zigarrenfabrikation, sondern auch über eines der berüchtigsten Zuchthäuser Deutschlands.
Karl May wurde am Dienstag, den 3. Mai 1870, vom Bezirksgerichtsgefängnis Mittweida in die Strafanstalt überführt. Das Zuchthaus Waldheim ist nicht nur die älteste Strafvollzugseinrichtung Sachsens, sondern ganz Deutschlands. Am 4. April 1716 war das erste sächsische Zucht-, Waisen- und Armenhaus in dem zuvor leerstehenden, renovierten Schloss in Waldheim eröffnet worden.174
Waldheim genoss schon in den Jahren der Inhaftierung Mays einen besonders üblen Ruf. Die Maigefangenen des Dresdner Aufstandes von 1849 verbüßten hier fast vollständig ihre Haftstrafen. Als im Jahre 1862 der letzte von ihnen frei kam, begann eine Pressekampagne gegen die angeblich unhaltbaren Zustände in Waldheim. Es kursierten Vorwürfe, wonach in Waldheim eine überdurchschnittlich hohe Sterblichkeit in Folge der überaus schlechten Verwaltung und einer grausamen Behandlung durch das Personal herrsche. Als Antwort auf diesen Vorwurf stellte das preußische statistische Büro eine Zahlenübersicht vor, aus der für Waldheim die Durchschnittszahl von 36 Toten auf 1.000 Häftlinge für die Jahre 1840 bis 1863 hervorging. Dies entsprach dem Durchschnitt deutscher Zuchthäuser. Allerdings konnte festgestellt werden, dass ausgerechnet für die Jahre 1871-73 in Waldheim eine deutlich erhöhte Sterblichkeit vorlag, also genau in jener Zeit, in der May dort inhaftiert war. Demnach stieg der Prozentsatz der Todesfälle von zuletzt 1,81% wieder auf 4,58% an. Als Grund für diese Erhöhung wurde die in jenen Jahren zu verzeichnende Überfüllung des Zuchthauses vermutet.175
Karl May war der einzige Neuling, der an jenem 3. Mai 1870 in das Zuchthaus Waldheim eingeliefert wurde. Das Einlieferungsschreiben an die Zuchthausdirektion wies ausdrücklich auf Mays „Gefährlichkeit“176 hin. Die Waldheimer Aufnahmeprozedur wird in Die Juweleninsel (GW Bd. 46) von May authentisch wiedergegeben:
„Die Schlösser klirrten und die Riegel rasselten, dann war es still. Die fürchterliche Umgebung verfehlte ihren Eindruck nicht auf den Gefangenen. Es war ihm, als hätte ihm jemand vor den Kopf geschlagen. Er ließ sich auf dem alten, hölzernen Schemel nieder und legte das Gesicht in beide Hände. So saß er lange Zeit, bis die Schlösser wieder klirrten und die Riegel abermals rasselten. Der Aufseher öffnete zum zweiten Mal.
‚Komm!‘
Er folgte willig aus der Zelle heraus und durch mehrere Gänge bis in einen größeren von Wasserdunst erfüllten Raum, welcher durch niedrige, dünne Holzwände in mehrere Abteilungen geschieden war. In jeder derselben stand eine Badewanne und ein Schemel dabei. Auf einem dieser Schemel lagen einige Kleidungsstücke und dabei stand ein schmächtiger Mann, der Schere und Kamm in der Hand hielt. Er trug eine Jacke und Hose von braunem Tuch und hatte harte rindlederne Schuhe an den Füßen. Die Haare waren ihm kurz geschoren, dennoch aber sah man es ihm an, daß er früher gute Tage gesehen haben musste.
‚Nummer Zwei, hier kommt Zuwachs!‘, meinte der Aufseher. ‚Kleide ihn ein! Ich habe jetzt anderweitig zu tun! Aber macht mir keine Dummheiten! In einer halben Stunde bin ich wieder hier.‘
Er ging und schloss hinter sich ab. Die beiden befanden sich allein in dem Raum.
‚Vierundsiebzig, setze dich!‘
‚Wer?‘
‚Du! Du hast jetzt keinen Namen mehr, sondern die Nummer vierundsiebzig: Nur bei dieser wirst Du genannt!‘
‚Donnerwetter, das ist hübsch!‘
‚Fluche nicht!‘, flüsterte der Mann. Dann fügte er lauter hinzu: ‚Setzen sollst du dich, habe ich gesagt. Oder hörst du schwer?‘
Hartmann ließ sich auf dem Schemel nieder. Der andere griff zu Kamm und Schere.
‚Was soll denn das werden, he?‘, fragte der Schiffer.
‚Die Haare müssen herunter. Dann badest du dich und ziehst die Anstaltskleidung an. Die deinige kommt in diesen Sack, der deine Nummer hat, und wird aufgehoben, bis du wieder entlassen wirst.‘
‚Na, dann zu, wenn es nicht anders möglich ist!‘
Das Schneiden des Haares begann.“ 177
Mays Bekleidungsnummer war die Nr. 402.178
Als Nächstes erfolgte eine erste Unterredung mit einem der beiden Anstaltsgeistlichen. Anschließend kam es zur ärztlichen Untersuchung. In Waldheim fungierten zu diesem Zeitpunkt als erster und zweiter Anstaltsarzt Dr. Theodor Zillich (1815-1872) und Dr. Carl Hermann Marhold (1822-1897). Über die Einzelheiten dieser Untersuchung ist nichts bekannt. Als Rückfalltäter wurde der Neuankömmling in die dritte, strengste Disziplinarklasse eingestuft. Hinzu kam, dass er als ein raffinierter und gefährlicher Verbrecher angekündigt worden war. Im Einlieferungsschreiben des Bezirksgerichts Mittweida vom 2. Mai 1870 heißt es:
Die Mutter lebt noch. Er hat 4 Geschwister, von denen 2 verheiratet sind. – May ist von 1856 bis 1859 auf dem Seminar in Waldenburg und von 1859 bis 1861 auf dem Seminar in Plauen zum Lehrer ausgebildet worden und hat nicht nur in Plauen das Schulamtscandidatenexamen bestanden, sondern als Lehrer einige Zeit fungirt in Glauchau und Altchemnitz. May ist am 26. Juli 1869 bei Gelegenheit einer von H. Staatsanwalt Taube unternommenen Expedition, bei welcher er nach Bräunsdorf transportirt wurde, obwohl gefesselt, dem Transporteur entsprungen und hat lange Zeit nicht wiedererlangt werden können. Endlich ist er Anfang d. J. in der Nähe von Tetschen i. B. aufgegriffen und nachdem er die Behörden über seine Persönlichkeit längere Zeit zu täuschen versucht hatte, an das unterzeichnete Gericht ausgeliefert worden.
Schon sehr bald nach seiner Einlieferung in Waldheim etwa von Mitte 1870 bis längstens Mitte 1871 hielt sich May in Isolierhaft auf. Die Isolierung stellte zu diesem Zeitpunkt eine reine Disziplinierungsmaßnahme dar. Als Verschärfung der Zuchthausstrafe war sie schon 1868 durch das Revidierte Strafgesetzbuch abgeschafft worden. Über den Grund dieser Disziplinierungsmaßnahme ist nichts bekannt. In einer Aufstellung179 des Zellenhausinspektors Gottlob Friedrich Tunger (1829-?) vom 15. Februar 1871 findet sich am Schluss der Eintrag:
Außer obenbezeichneten Züchtlingen befinden sich noch wegen Verdachts des Entweichens und Neigung zu grobem Unfug, Widersetzlichkeit und Gewaltthaten in Isolirung die Züchtlinge: [...] May [...], welche jedoch gegenwärtig noch nicht drei Jahre lang isolirt sind. (2 Jahre, absteigend bis zu 1 Monat).180
Diese Aufstellung erfolgte auf Beschluss des sächsischen Innenministeriums vom 4./11. Februar 1871 und erfragte insbesondere, welche und wie viele Züchtlinge sich zu diesem Zeitpunkt bereits drei und mehr Jahre in Isolierhaft befanden.
Anders als noch in Schloss Osterstein verbrachte May seine Isolierhaft nicht auf Grund eines eigenen Antrags, sondern wegen eines unbekannten Vergehens. Isolierung bedeutete für May jedoch nicht die absolute Isolierung, die nur in Ausnahmefällen zulässig war. Gemeint war nur der nächtliche Aufenthalt eines Häftlings in seiner Zelle. Aber auch diese Einschränkung ließ sich in der Waldheimer Strafvollzugspraxis jener Jahre nicht durchgehend verwirklichen. Von den 1.093 männlichen und 298 weiblichen Züchtlingen der Anstalt Ende Oktober 1872 konnte lediglich die Hälfte des Nachts in einer Einzelzelle untergebracht werden.
Auch ein Häftling in Isolierhaft musste arbeiten, so auch May. Anfang der 70er-Jahre des 19. Jahrhunderts untergliederten sich die Arbeitsbereiche in Möbeltischlerei, Schneiderei, Tuchschuh- und Militärtuch-Macherei, Weberei baumwollener Schirmstoffe, Leineweberei, Zigarren-Fabrikation, Strumpfwirkerei, Serpentin-Schleiferei und anderes mehr.
„Man teilte mich derjenigen Beschäftigung zu, in der grad Arbeiter gebraucht wurden. Ich wurde Zigarrenmacher.“ 181
Die Zigarrenproduktion in Waldheim belief sich allein für das Jahr 1872 auf stolze 15 Millionen Zigarren.182 Dabei erforderte die Tätigkeit für den einzelnen Arbeiter „dieselben Handgriffe täglich, wöchentlich in hundert-, ja tausendfacher Wiederholung, daher bald zur Routine geworden und zu einem automatisch ablaufenden Bewegungsrhythmus erstarrt“183 – nicht die ideale Tätigkeit für einen fantasiebegabten Menschen wie May.
Isolierhaft bedeutete „strengste Kontrolle, absolutes Schweigegebot, fast völlige Abgeschiedenheit, monotone Arbeit und weitgehende geistige Abschirmung. Eine Abwechslung boten lediglich der Besuch kirchlicher Veranstaltungen (sonntäglicher und wöchentliche Betstunden), die ohnehin seltenen Gespräche mit den Geistlichen, die (bestimmt schon weniger angenehmen) Auftritte der kontrollierenden Beamten, die Ablieferung der Arbeitsergebnisse bzw. die gleichzeitige Übernahme neuen Arbeitsmaterials, sowie – nach erfülltem Pensum – die verordnete Sonn- bzw. Feiertagslektüre. Am Schulunterricht hat er [May] als gemaßregelter Rückfalltäter nicht teilnehmen können.“184
Der bereits erwähnte Isolierhausinspektor Krell berichtet über die Folgen einer beinahe totalen räumlichen und geistigen Isolierung:
„Die an dem Gefangenen zuerst ersichtliche Wirkung der Zelle, der sich kein Einziger entziehen kann, ist eine mehr oder weniger vortretende Abmagerung. [...] Diese Abmagerung erfolgt bis zu einem gewissen Grade, etwa bis zum 4ten beziehendlich 6ten Monate. Es erfolgt ein Stillstand, wohl wieder ein Zunehmen der Körperfülle und ein normales Auftreten des Hungers [...]. Es zeigt sich an dem Zellengefangenen ferner eine grosse Neigung der Haut zu erhöhter Transpiration. [...] Mit der Zeit nimmt diese übergrosse Transpiration etwas ab, allein die Haut fühlt sich stets feucht an. Die Hände der Zellengefangenen fühlen sich immer feucht und kühl an. Vielerlei Arbeiten werden dadurch sehr erschwert. Aus dieser Wirkung erklärt sich die überaus grosse Empfänglichkeit der Isolirten für jeden Wechel der Witterung. Alle Zellengefangenen sind sehr geneigt, sich zu verkühlen und rheumatische Schmerzen kommen ausserordentlich häufig vor [...]. Eine weitere Folge ist erhöhte Reizbarkeit des Nervenlebens. [...] Die Aeusserungen dieser Wirkung sind ausserordentlich mannigfaltig. Sie zeigt sich durch übergrosse Aengstlichkeit, namentlich Zittern in den Knieen; durch heftiges Weinen; durch Seufzen und Stöhnen; durch heftiges Träumen; durch Schlaflosigkeit, durch eingebildete Krankheitserscheinungen, sogar durch Hallucinationen [...].“185
Das Entstehen psychischer Störungen war vorprogrammiert.
Es ist anzunehmen, dass sich bei May während der Isolierhaft die ersten Symptome einer aufkommenden Haftpsychose zeigten. Dass es nicht zu einem offenen Ausbruch der Krankheit kam, lag nach Hainer Plaul an mindestens drei Faktoren. „Zunächst seine noch rechtzeitige Rückversetzung in Kollektivhaft“, was vermutlich im Sommer 1871 erfolgte. „Zum anderen, sofern er hin und wieder einen Relaps186 – selbst in milder Form – erlegen gewesen sein sollte, ist es vielleicht der Fürsorge jenes Arztes zu danken, der im August 1872 als zweiter Anstaltsarzt nach Waldheim kam: Adolf Emil Knecht. [...] Der dritte Faktor endlich, der bei May den offenen Krankheitsausbruch mit verhindern half, dürfte in den Hafterleichterungen zu sehen sein, die ihm schon relativ früh zuteil wurden.“187
Der von Plaul angesprochene Adolf Emil Knecht (1846-1915) war als psychiatrisch vorgebildeter Arzt 1872 in den sächsischen Staatsdienst übernommen und als zweiter Anstaltsarzt am Zuchthaus Waldheim eingesetzt worden.188 Knecht vertrat vor allem im Hinblick auf die Behandlung von psychisch kranken Rechtsbrechern eine sehr eigenständige psychiatrische Auffassung. Die Anwendung mechanischer Zwangsmittel, auch die Isolierung der erkrankten oder bereits krank eingelieferten Gefangenen traten bei ihm deutlich in den Hintergrund. Bei Knecht lag auch die Zahl der als psychisch krank erkannten Strafgefangenen deutlich höher als bei seinen Berufskollegen, da er eher bereit war, die ärztliche Position in den Vordergrund zu stellen. Mehr als andere Anstaltsärzte ging Knecht den Ursachen der psychischen Erkrankungen und ihrer Auswirkungen auf das kriminelle Verhalten auf den Grund. So schätzte er die Häufigkeit von psychischen Störungen im Zuchthaus Waldheim auf ca. 3%, von denen nur ein Teil wirklich erkannt und behandelt werden könne.189 Bei zwei Dritteln der in Haft Erkrankten sei es in den ersten zwei Jahren ihrer Strafzeit zum Krankheitsausbruch gekommen. 42% aller Kranken hätten an sekundären Seelenstörungen gelitten. An zweiter Stelle in der von Knecht angegebenen Diagnosenhäufigkeit stand mit 22,5% ‚Melancholie‘, an dritter die ‚Seelenstörung mit Epilepsie‘ (13,1%), gefolgt von ‚Idiotie und Imbezillität‘ (10,1%), ‚Manie‘ (6,6%) und ‚paralytischen Seelenstörungen‘ (6,5%). Die Delikte, deretwegen die Kranken zu Zuchthausstrafen verurteilt worden waren, hätten zu 56,5% in ‚Eigenthumsvergehen‘ bestanden, zu 10,1% in ‚Unzucht mit Kindern‘, zu 8,9% in ‚Brandstiftung‘, zu 7,7% in Mord oder Mordversuch, zu 4,7% in Raub, zu 3,6% in Meineid, zu je 3% in ‚Todtschlag und Körperverletzung‘ bzw. ‚Desertion oder schwerer Insubordination‘ usw. Die Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen sowie der 30- bis 40-Jährigen seien in einem bedeutend höheren Prozentsatz als bei Gesunden vertreten gewesen.
Ob bei May eine schwere psychische Erkrankung vorlag, lässt sich aus keinen Unterlagen ersehen. Er selber weist später aber darauf hin. Die Rückgliederung in die Kollektivhaft brachte ihn wieder in den Kontakt mit anderen Häftlingen, eine Sozialisierungsmaßnahme, die trotz bestehenden, aber in der Praxis durchbrechbaren Redeverbotes wichtig war. Neben dieser Rückversetzung ergab sich für May eine weitere günstige „Schickung“190, die er in seiner Autobiografie eingehend beschrieb:
„Die Anstaltskirche in Waldheim hatte eine protestantische und eine katholische Gemeinde. Der katholische Katechet (Anstaltslehrer) fungierte während des katholischen Gottesdienstes als Organist. [...] Der Katechet kam in meine Zelle, unterhielt sich eine Weile mit mir und ging dann fort, ohne mir etwas zu sagen. Einige Tage später kam auch der katholische Geistliche. Auch er entfernte sich nach kurzer Zeit, ohne daß er sich über den Grund seines Besuches äußerte. Aber am nächsten Tage wurde ich in die Kirche geführt, an die Orgel gesetzt, bekam Noten vorgelegt und mußte spielen. Die Herren Beamten saßen unten im Schiff der Kirche so, daß ich sie nicht sah. Bei mir war nur der Katechet, der mir die Aufgaben vorlegte. Ich bestand die Prüfung und mußte vor dem Direktor erscheinen, der mir eröffnete, daß ich zum Organisten bestellt sei und mich also sehr gut zu führen habe, um dieses Vertrauens würdig zu sein. Das war der Anfang, aus dem sich so sehr viel für mich und mein Innenleben entwickelte.“ 191
Das Orgelspiel bewertete May selber später als eine Art Therapeutikum:
„Bei den Klängen der Orgel fand ich mich wieder zu mir zurück. [...] Als ich entlassen wurde, war ich geheilt, vollständig geheilt! Nur durch den Orgelklang.“ 192
Der erwähnte Katechet war der in Bautzen-Niederseide geborene Johannes Peter Kochta (1824-1886). Kochta hatte am 1. Juli 1866 unter Erteilung der Staatsdienereigenschaft und im Range eines Oberbeamten seine Tätigkeit als katholischer Anstaltskatechet am Zuchthaus Waldheim begonnen.
„Er war nur Lehrer, ohne akademischen Hintergrund, aber ein Ehrenmann in jeder Beziehung, human wie selten Einer und von einer so reichen erzieherischen, psychologischen Erfahrung, daß das, was er meinte, einen viel größeren Wert für mich besaß, als ganze Stöße von gelehrten Büchern.“ 193
Im katholischen Sprachgebrauch wird die Bezeichnung Katechet vor allem für die nicht im Schuldienst tätigen Religionslehrer gebraucht, die etwa als Seelsorgehelfer[innen] oder auch Beicht- und Firmkatecheten tätig sind.194
Kochtas besondere Bedeutung bestand darin, dass er für eine Versetzung Mays in die zweite Disziplinarklasse sorgte, was vermutlich Ende 1871 oder Anfang 1872 erfolgte.
Diese Versetzung, aber vor allem auch weitere positive Bewertungen Mays durch den Katecheten, möglicherweise auch dessen Anregungen veranlassten den Häftling schließlich im Frühjahr 1872 zur Stellung eines Gnadengesuchs. Am 30. April 1872 wurde jedoch vom Sächsischen Justizministerium in Person des Ministerialrats Christian Wilhelm Ludwig Abeken im Namen des sächsischen Kronprinzen Friedrich August Albert (1828-1902), der ab 1873 König von Sachsen wurde, entschieden:
S. Kg. Hoheit der Kronprinz im Auftrag und Stellvertretung Sr. Maj. des Kgs haben auf Anrufen Allerhöchster Gnade sich nicht bewogen gefühlt [...] Begnadigung eintreten zu lassen.195
Nachdem sich die Hoffnung auf eine vorzeitige Haftentlassung zerschlagen hatte, galt es für May noch mehr, sich in den allgemeinen Anstaltsbetrieb einzupassen. Ohne dass bislang amtliche Belege dafür vorliegen, berichtete May über seinen Kontakt zu dem Visitationsaufseher Carl August Leistner (1818-?), damals Dirigent des Waldheimer „Sträflings-Musikchor, dem etwa 30-40 Sänger und 12 Blechbläser angehörten“.196
„Ich erzählte ihm von meiner musikalischen Beschäftigung in Zwickau. Da brachte er mir schleunigst Noten, um mir eine Probeaufgabe zu erteilen. Ich bestand auch diese Prüfung, und von nun an war dafür gesorgt, daß ich nicht verhindert wurde, in meiner freien Zeit nach meinen Zielen zu streben.“ 197
Möglicherweise kam es 1873 zu einer Mitgliedschaft Mays im Bläserkorps der Anstalt. Ein weiteres Amt bekleidete der junge Ernstthaler Häftling für wenige Woche zu Beginn des Jahres 1874 in der Betreuung der Gefangenen-Bibliothek. Während seiner Beschäftigung im Bibliotheksdienst kam es im Frühjahr zu einem Vorfall, der in erhalten gebliebenen Akten198 nachzulesen ist. So gab am 1. März der
Züchtling No. 153, Hering, [...] ein neues Buch beschmutzt
zurück. Am 3. März, als man bei der Durchsicht und Rückordnung der abgegebenen Bände die Sache bemerkte, brachte der Katechet August Leopold Barth (1823-1884), dem die Verwaltung der Gefangenen-Bibliothek oblag, den ‚Fall‘ zur Kenntnis. Es erfolgte zunächst eine Rücksprache bei dem Häftling Karl Julius Hering (1839-?), der
glaubte, daß das Buch, als er’s bekommen, rein gewesen. Er soll’s nicht beschmutzt haben. Zunächst noch Züch. No. 402 zu befragen, der den Bücherwechsel mit zu besorgen hat.
Nun musste May zu dem Vorfall Stellung beziehen.
Züchtling, No. 402, Mai giebt an, daß das Buch bereits schmutzig gewesen sei, wie es pp. Hering erhalten habe,
ergab die Nachfrage bei May, der sich mit dieser Auskunft in einen inhaltlichen Widerspruch zu Hering setzte. Das Ergebnis war, dass man Hering Glauben schenkte und entschied,
Züch. No. 402 ist fernerweit nicht mehr mit dem Austheilen der Bücher zu beschäftigen.
Der erste protestantische Anstaltsgeistliche Christian Gottlob Fischer (1855-1893), der auch die Oberaufsicht über Barth und die Verwaltung der Gefangenen-Bibliothek innehatte, urteilte wenig später – vermutlich motiviert durch die Buch-Affäre – über Karl Mays moralische Befähigung:
kalt, gleichgiltig, glatt, hochmüthig.199
Neben den nachgewiesenen Beschäftigungen Mays stellt sich natürlich auch anlässlich der Waldheimer Inhaftierung die Frage nach seiner literarischen Tätigkeit. Diese ist jedoch so gut wie ausgeschlossen. Allerdings erschienen während Mays Zuchthauszeit nachweislich im Neuen deutschen Reichsboten200 erste literarische Zeugnisse. Es handelt sich um die vermutlich bei einem Preisausschreiben eingereichten Gedichte Meine einstige Grabschrift, Mein Liebchen und Gerechter Tadel.201 Der in ihnen sich spiegelnde biografische Hintergrund lässt auf eine Entstehungszeit von 1869 schließen.202
Am 2. Mai 1874 wurde May schließlich aus dem Zuchthaus entlassen. Anders als noch bei seiner Entlassung aus Schloss Osterstein, entließ man ihn dieses Mal als Angehörigen der zweiten Disziplinarklasse ohne Vertrauenszeugnis. Da May unter anderem wegen Diebstahls mit Zuchthaus bestraft worden war, stellte man ihn – entsprechend auch den Regelungen des Bundes- und Reichsstrafgesetzbuchs – zudem für die nächsten zwei Jahre unter Polizeiaufsicht. Über deren Dauer, die maximal fünf Jahre betragen konnte, entschied damals die höhere Landespolizeibehörde, in Sachsen die Kreisdirektion Leipzig. Etwa Mitte April 1874 wurde von der Waldheimer Anstaltsleitung ein Gutachten erstellt und der Kreisdirektion Leipzig eingereicht, auf dessen Grundlage dann die zwei Jahre Polizeiaufsicht für Karl May verhängt wurden. Im Demissionsschein, der zugleich die Stelle des Passes vertrat, war die genaue Marschroute angegeben, von welcher der Entlassene nicht abweichen durfte. May wurde angewiesen „spätestens den 4n. Mai 1874 in Ernstthal einzutreffen“.203 Ferner erhielt May noch einen Heimatschein ausgehändigt, zudem ein Signalement204 zwecks Identifizierung.