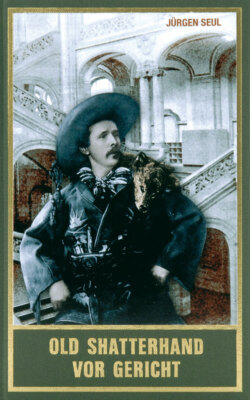Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Die zweite Tatserie
ОглавлениеWiederau, 29. März 1869: Ungefähr 20 Kilometer nördlich von Ernstthal liegt – fernab von großen Verkehrswegen – das Dorf Wiederau. Aus dem unscheinbaren Ort stammte die zu dieser Zeit erst zwölfjährige Clara Zetkin, die später noch eine wesentliche politische Rolle spielen sollte. Der Ort verfügte auch über eine Gastwirtschaft mit Namen ‚Zum Hirsch‘ in der Hauptstraße 169, deren Betreiber der Materialwarenhändler und Strumpfwirker Carl Friedrich Reimann (1830-1877) war. Es war der Morgen des 2. Osterfeiertages, als in der Gastwirtschaft ein Fremder erschien. Über das, was sich im Folgenden abspielte, berichtete das Leipziger Tageblatt und Anzeiger in seiner Nr. 94 vom 4. April 1869: „Ein arger Schwindel ist an dem Krämer in Wiederau bei Mittweida ausgeführt worden. Zu demselben kommt ein Mann in anständiger Kleidung, welcher sich für einen Leipziger Polizeimann ausgiebt, und theilt dem Krämer mit, er hätte Auftrag, bei ihm Nachsuchung zu halten, weil man Verdacht schöpfte, er gehöre einer Falschmünzerbande an, und verlangt, das Papiergeld des Krämers zu sehen. Derselbe erklärt, weiter nichts, als einen 10-Thaler-Schein zu haben, und holt diesen herbei; der Fremde prüft den Schein genau und behauptet, er sei falsch, er müsse ihn wegnehmen. Eine an der Wand hängende Taschenuhr will er auch als gestohlen erkennen, verlangt auch das Silbergeld zu sehen, weil auch falsche Thaler im Umlauf wären; auf Vorzeigen dessen steckt er einige davon zu sich mit dem Bemerken: ‚das sind auch falsche‘, und nun machte er dem Krämer bekannt, daß er ihn mit nach Clausnitz nehmen müßte, wo ein Verhör stattfinden solle, weil in Clausnitz ebenfalls einige der Falschmünzerei verdächtige Leute wohnten. In Clausnitz angekommen, bezeichnet er dem Krämer auch das Haus, wo das Verhör stattfinden soll, und bedeutet ihn, er solle einstweilen in den Gasthof gehen; er würde gerufen werden, wenn es nöthig sei. Es vergehen nahe an zwei Stunden, es kommt Niemand, da wird dem Wartenden doch die Zeit zu lang, und er fragt im Gasthof, ob Jemand von dem fraglichen Verhör etwas wisse, aber leider mußte der arme Wiederauer nun erfahren, daß er ein Geprellter sei, denn der angebliche Leipziger Polizeimann war mit 10-Thaler-Schein, Uhr und einigen Silberthalern verschwunden; bis jetzt konnte man auch seiner nicht habhaft werden.“
Der auch in diesem Fall für die Ermittlung zuständige Staatsanwalt Taube fahndete anschließend im Sächsischen Gendarmerieblatt nach einem „Unbekannte(n), 28-32 J(ahre) alt, ca. 72” lang, schmächtig, blasser Gesichtsfarbe, dunkelbraunen Haares, ohne Bart, bekleidet mit Rock, Weste und Hosen von braunem gelblich schimmernden Stoffe, die Hosen mit schwarzem Gallon versehen, ferner braunen spitzen Filzhut, Siegelring und knotigen Stock tragend“.131
Fünf Tage später, am 6. April 1869, ergänzte Taube die Fahnung dahingehend, „daß der angebl[iche] v[on] W[olframsdorf] kurz verschnitt[enes] Haupthaar, längliches Gesicht und Nase, gelbe Gesichtsfarbe gehabt, daß er blauseidenen Schlips u[nd] umgeschlag[enen] Hemdenkragen getragen [habe]. Er ist bereits am Sonnabend vor den Ostertagen in Wiederau gesehen worden, scheint sich also mehrere Tage in der dortigen Gegend aufgehalten zu haben.“132
Über die Identität des Täters herrschte bei den Behörden völlige Unklarheit. Zunächst wurde ein bekannter Krimineller im Sächsischen Gendarmerieblatt als mutmaßlicher Täter in Betracht gezogen.
Ponitz, 10. April 1869: Unweit von Wiederau lag Ponitz, ein Dorf mit seinerzeit ca. 1.600 Einwohnern. Knapp zwei Wochen nach dem Wiederauer Vorfall erschien ein junger Mann im Hause des Seilermeisters August Krause (1828-1896). Das Haus, am Hang vor der Ponitzer Kirche gelegen, war ein einstöckiger Fachwerkbau, erbaut um 1800, und diente als Seilerwerkstatt. Der junge Mann gab sich gegenüber dem Seilermeister als ‚Mitglied der geheimen Polizei‘ aus. Über das, was er von Krause wollte, berichtete die Leipziger Zeitung vom 14. April 1869 später:
Bekanntmachung.
In hiesiger Gegend hat heute ein unbekannter, nachstehend soweit möglich beschriebener Mensch einen Betrug in der Weise ausgeführt, daß er sich als Mitglied der geheimen Polizei ausgegeben, welches Recherchen nach falschem Papiergeld anzustellen habe, sich unter diesem Papiergeld anzustellen habe, sich unter diesem Vorwand in Besitz von circa 30 [Zeichen für Taler] Geld gesetzt hat und mit diesem geflohen ist. Auf der Flucht hat er die Nacheilenden durch Vorhalten eines Pistols an seiner Arretur verhindert.
Der Betrüger ist jedenfalls identisch mit dem unterm 1. l[etzten] M[onats] von der Königl[ichen] Staatsanwaltschaft Mittweida Verfolgten. Auf der Flucht ist demselben eine kleine Marke von Pappe entfallen, auf welcher mit blauem Stempel die Namen:
Julius Metzner, Oberlungwitz aufgedrückt sind.
Signalement.
Der Unbekannte ist mittlerer Größe, mit braunem dünnen Schnurrbart und braunem langen Haupthaar, trug breitkrämpigen hellbraunen Filzhut, hellbraunen Rock und Weste, Beinkleider von gleicher Farbe mit schwarzen Galons.
Crimmitschau, den 10. April 1869.
Das Königliche Gerichtsamt.
Beyer.
Die Bekanntmachung gibt nur verschwommen wieder, was tatsächlich geschehen war. Der angebliche Geheimpolizist hatte 30 vermeintlich falsche Taler konfisziert. Anschließend hatte er Krause aufgefordert, ihm nach Crimmitschau auf das Gerichtsamt zu folgen. Auf dem Weg dorthin hatte der vermeintliche Falschgeldfahnder plötzlich vorgegeben, seine Notdurft zu verrichten, um sich seitwärts ins Gebüsch zu schlagen. Er wurde jedoch von Krause und einem Helfer verfolgt. Als die Verfolgung zu heikel wurde, warf der Flüchtende das erschwindelte Geld fort und wehrte die Verfolger mit einem ‚Doppel-Terzerol‘ ab. Bei der anschließenden Flucht verlor er ein kleines Stück Pappe (ob absichtlich oder versehentlich, ist ungewiss), auf dem der Name ‚Julius Metzner Oberlungwitz‘ stand. Der Name des kleinen Oberlungwitz ließ die Behörden sofort an das angrenzende größere Ernstthal denken, von dem Wiederau wie Ponitz fast gleich weit entfernt liegen. So ahnte die sächsische Gendarmerie, wer hier den falschen Polizisten gespielt hatte.
Obergendarm Karl Gottlieb Prasser (1815-1874) aus Rochlitz, der May 1865 als ‚Dr. Heilig‘ entlarvt hatte, wurde eingeschaltet. Er suchte Mays Eltern auf und vermeldete am 12. April:
„May hält sich bei seinen Eltern in Ernstthal auf. Entschuldigt sich angeblich mit litterarischen Arbeiten, verreist zeitweilig [...]“133
In Prassers Augen war May jedenfalls der gesuchte Täter, wie eine redaktionelle Fußnote zu einem Steckbrief im Sächsischen Gendarmerieblatt, Nr. 56 von 1869, verriet:
„Der Kreisobergend[arm] Schwarzenberg u[nd] der Obergend[arm] Prasser halten den von Mittweida aus verfolgten Betrüger für den früher als angebl[ichen] Dr. med. Heilig aufgetret[enen] vormal[igen] Schullehrer Carl Friedr[ich] May [au]s Ernstthal, 28 J[ahre] alt (…), dessen Signal[ement] mit dem des Betrügers vollständig übereinstimmt.“
May ahnte wohl, dass man ihn verdächtigte, denn er ließ sich kaum noch in Ernstthal sehen. Am 13. April schlich er sich nachts heimlich ins Haus seiner Eltern und hinterließ einen Brief, worin er angab, zu einem Neuanfang nach Amerika auswandern zu wollen: „Ich traf nämlich zwei nordamerikanische Herren, Vater und Sohn, welche von einer Vergnügungs- und wohl auch halb und halb Geschäftsreise kamen und über Leipzig, Frankfurt, Amsterdam nach Hause wollten. In Prag hatten sie ihren Hofmeister zurückgelassen und machten mir den annehmbaren Vorschlag, an dessen Stelle zu treten, mit nach Pittsburg zu gehen und dort die jüngeren Geschwister zu unterrichten, ev. Sie auf ihren Reisen zu begleiten. Ein guter Schriftsteller muß die Welt kennen, muß Erfahrungen gesammelt, muß seine Anschauungen erweitert und berichtigt haben, und da ich zudem kein Mensch bin, der an seinem bißchen Scholle klebt, so griff ich natürlich mit beiden Händen zu. Bei der Eile, welche die beiden Herren haben, ist es natürlich nicht möglich, heute nach hause zu kommen, wie ich Euch versprochen hatte. Ich bin gestern erst mit ihnen zusammengetroffen, heute sind wir in Leipzig, bis Sonnabend in Amsterdam und dann in 9-10 Tagen in Pittsburg. Paßscheerereien, wie sie bei uns in Deutschland an der Tagesordnung sind, habe ich auch nicht zu befürchten, da auf dem Passe des Mr. Burton die einfache Bemerkung steht: ‚Reist mit Sohn und Gesellschafter‘, und so kann ich gleich mitreisen, ohne mir erst Papiere holen zu müssen.“ 134
Unwillkürlich fühlt man sich an den Ich-Erzähler des ersten Bandes der Winnetou-Trilogie erinnert, der seine Old-Shatterhand-Karriere im Wilden Westen auch als Hauslehrer in St. Louis beginnt. Mays Brief an die Eltern wurde später zu den Ermittlungsakten genommen. Zweifel am Wahrheitsgehalt dieses Briefinhaltes drängen sich auf. Andererseits deutet die Eintragung „Burton’s Amerik. Dolmetscher“ in der Anleitung, die englische Sprache in kurzer Zeit ohne Lehrer zu lernen in Mays Bibliothek auf eine möglicherweise tatsächlich stattgefundene Begegnung hin.135 Beweise lassen sich bis heute nicht erbringen. Wenige Tage später fuhr May nach Schwarzenberg zu seiner Geliebten Auguste Gräßler, die zu jenem Zeitpunkt offenbar noch nichts von seinen Aktivitäten wusste. Das Zwickauer Wochenblatt vom 17. April 1869 vermeldete unterdessen:
„Das Gerichtsamt Crimmitschau verfolgt einen Betrüger, der sich in dortiger Gegend ‚als Mitglied der geheimen Polizei‘ ausgegeben, welches Recherchen nach falschem Papiergeld anzustellen habe, sich unter Vorwand im Besitz von 30 Thaler Geld gesetzt hat und mit diesem geflohen ist. In der Gegend von Mittweida ist bekanntlich Aehnliches vorgekommen.“
Die Behörden zogen offenbar bereits eine Parallele zur Reimann-Episode in Wiederau. Mittlerweile verdichtete sich der Verdacht, dass hinter der Identität des Polizeileutnants von Wolframsdorf und des ominösen Mitglieds der geheimen Polizei der aus Zwickau entlassene May stecken musste. So ließ Taube am 20. April im Sächsischen Gendarmerieblatt mitteilen: „Da der Verdacht sich mehrt, daß der an mehreren Orten als Polizeibeamter aufgetretene unbekannte Betrüger der May gewesen sei, und des letzteren Aufenthalt unbekannt ist, so wird gebeten, auf denselben allerorts zu invigilieren und ihn im Betretungsfall zu verhaften.“
Auch Taube fahndete somit fortan nach einem alten Bekannten. In der May-Forschung wird die Vermutung vertreten, dass May in den nächsten Wochen versucht habe, nach Amerika auszuwandern.136 Infolge von Passschwierigkeiten sei er jedoch nur bis Bremen gelangt, um ergebnislos wieder nach Sachsen zurückzukehren. In Jöhstadt wurde er Anfang Mai gesehen. Der Gendarm Heinrich Hermann Grundig (1820-1907) wurde auf ihn aufmerksam gemacht, worüber das Sächsische Gendarmerieblatt am 14. Mai 1869 berichtete:
„Der vormal[ige] Schullehrer Karl Friedrich May hat sich l[au]t Anzeige des Gend[arms] Gruppenf[ührer] Grundig in Hohenstein, wie diesem glaubh[aft] mitgetheilt worden, vom 4. bis 5. M[onat]s. in Jöhstadt umhergetrieben, seiner in Falken bei Hohenstein erschwind. Kleider (Rock, Hosen u. Weste) sich entledigt und trägt gegenwärtig wahrscheinl[ich] grauen Turneranzug und braunes, kleines Hütchen.“
Der Hinweis auf einen Kleiderschwindel traf allerdings nicht zu. Vielmehr hatte der Schneider Johann Ferdinand Hoppe (1821-1894), ein Bruder von Mays Schwager Friedrich August Hoppe, den Vaganten freiwillig mit neuer Kleidung versorgt und dann nur deshalb angezeigt, um nicht in den Verdacht der Begünstigung zu geraten. Eine Stoffprobe trug später zu einer Identifizierung Mays bei seiner Festnahme bei. Ende des Monats wandte er sich wieder nach Ernstthal, wo er sich heimlich in der Mietwohnung seiner Schwester Auguste Wilhelmine und seines Schwagers Friedrich August Hoppe im Haus seines Taufpaten Weißpflog aufhielt.
Ernstthal, 27./28. Mai 1869: Es gab nicht viele Menschen, denen May in jener Zeit vertrauen konnte. Neben seinen Familienangehörigen war dies vor allem aber sein Taufpate Weißpflog. In der Nacht vom 27. Mai erhielt er von ihm und seiner Frau Emilie einige Gegenstände, die auf den ersten Blick seltsam anmuten: einen Kinderwagen, wahrscheinlich als Transportgerät, eine Schirmlampe, zwei Geldtäschchen mit zwei Talern Inhalt, zwei Bunde Sperrhaken (Dietriche) und eine Brille mit Futteral. Über die Freiwilligkeit der Aushändigung aller Gegenstände könnte man angesichts einer später erfolgten Strafanzeige wegen Diebstahls durch Weißpflog Zweifel hegen. Auf der anderen Seite fällt auf, dass die besagte Anzeige erst am 3. Juni, also gut eine Woche nach dem vermeintlichen Diebstahl beim Gerichtsamt Hohenstein erstattet wurde. Das lässt wiederum an der tatsächlichen Begehung einer Straftat ernste Zweifel aufkommen. Genährt werden diese Zweifel dadurch, dass May von Nachbarn des Schmieds beim nächtlichen Davonbringen der Gegenstände beobachtet wurde. Weißpflog musste möglicherweise Anzeige gegen sein Patenkind erstatten, um nicht selber verdächtig zu erscheinen. Die Anzeige der vermeintlichen Tat wurde in der Leipziger Zeitung vom 8. Juni 1869 öffentlich bekannt gemacht:
Bekanntmachung.
In der Nacht vom 27. zum 28. des vorigen Monats sind, muthmaßlich mittels Einschleichens, aus einer Wohnung in der Stadt Ernstthal die nachverzeichneten Gegenstände spurlos entwendet worden, was zur Ermittelung der Thäterschaft und behufs Wiedererlangung des Gestohlenen andurch öffentlich bekannt gemacht wird.
Fürstlich und Gräflich Schönburg’sches Gerichtsamt Hohenstein-Ernstthal, den 3. Juni 1869.
Seyler.
Verzeichnis der gestohlenen Gegenstände.
1) Ein Kinderwagen mit schwarzgrauem Korb und Hängefedern, an dessen einem Rade ein neuer Reifen aufgezogen war,
2) eine schwarzlederne Geldtasche in Buchform mit Stahlbügel, in welchem sich 2 [?] Silbermünzen in 1/6 Thalerstücken befanden,
3) eine Schirmlampe mit Porzellainfuß, genärbtem Milchschirm und dergl[eichen] Kugel,
4) eine Brieftasche, außen von braunem, innen von grünem Leder, mit eingeheftem Notizbuch, in welchem sich eine auf den Glaser Kühnert in St. Egidien lautende Rechnung für gelieferte Fensterbeschläge im Betrage von 21 [?] 10 [?] und einigen Pfennigen, und einige Notizen über Außenstände bei Personen in Glauchau, St. Egidien und Callenberg befanden,
5) eine neue stählerne Brille mit schwarzem Futteral,
6) ein Geldtäschchen von violettem Leder mit genärbtem Stahlbügel,
7) 13 [?] in einzelnen Kupfermünzen,
8) ¼ Pfund gewöhnliche Waschseife und
9) 60 bis 70 Stück Dittriche in verschiedenen Formen.
Der Ort, zu dem May die Gegenstände brachte, ist bekannt. Seinen seinerzeitigen Schlupfwinkel bildeten „zwei Höhlen, ungefähr 2 km von der nördlichen Peripherie Hohensteins entfernt im Wald im Kiefernberg gelegen. Diese ‚Eisenhöhlen‘, eigentlich Stollen, deren Entstehung auf Schürfarbeiten im 17. Jahrhundert zurückging, hatten 1771 einer Räuberbande unter einem gewissen Christian Friedrich Harnisch (geb. 1744) aus Hohenstein als Unterschlupf gedient. Deshalb waren sie zu Recht im Volksmund als ‚Eisenhöhlen‘ verschrien. Mays Vater soll 1869 beobachtet worden sein, als er dem in diesen Höhlen kampierenden Karl May Lebensmittel etc. hinschaffte.“137
Ob der Aufenthalt Mays in den ‚Räuberhöhlen‘ mit dazu beitrug, dass er, der Einzeltäter, in der Legende der Einheimischen später als Mitglied und gar Anführer einer Räuberbande wie Harnisch gehandelt wurde, ist durchaus möglich. Der Hohenstein-Ernstthaler Lehrer, Stadtbibliothekar und Heimatforscher Hans Zesewitz (1888-1976), der in den 1920er-Jahren viele Einzelheiten aus Mays Leben und dem seiner Vorfahren erkundete, erinnerte sich später, wie noch um 1920/30 gerade solche Zerrbilder in der Heimatstadt kursierten. Die Karl-May-Höhle inspirierte den späteren Schriftsteller auch zur literarischen Verarbeitung, namentlich in der heimatlichen Erzählung Die Rose von Ernstthal (vgl. GW 43, Aus dunklem Tann und den Sonderband Karl May auf sächsischen Pfaden).
Limbach, 31. Mai 1869: Für kurze Zeit wurden die ‚Räuberhöhlen‘ Ausgangspunkt für geheime Ausflüge Mays in die nähere Umgebung. Am Morgen jenes Tages wagte sich May zu der am Ortsausgang von Limbach gelegenen Restauration von Viktor Reinhard Wünschmann (1820-1908). Zwischen der Höhle und dem Gasthaus lagen gerade einmal 4 km. Im Gasthaus verlangte er von dem alleine anwesenden Schankmädchen Minna Clara Fiedler ein Glas Wein und entfernte sich schließlich unbemerkt mit einem Satz von fünf Billardkugeln. Mit der bescheidenen Beute „floh May auf direktem Weg zu Fuß nach Chemnitz (14 km) – eine Eisenbahnlinie Limbach–Chemnitz wurde erst gebaut – und verkaufte die Billardbälle über einen Dienstmann an einen Drechsler für 5 Taler (Wert: 20 Taler). May erhielt auch das Geld, mußte aber sofort die Flucht ergreifen [...].“138
Zwei Chemnitzer Polizeidiener hatten von dem Verkauf der Billardbälle erfahren und den Täter gestellt. Als sie seine Ausweispapiere verlangten, setzte er seine Flucht erfolgreich in die angrenzenden Wälder fort.
Bräunsdorf, den 3./4. Juni 1869: Etwa acht Kilometer nördlich von Hohenstein-Ernstthal liegt Bräunsdorf. Zu jener Zeit lebten hier um die 1.000 Einwohner. In der Nacht zum 4. Juni näherte sich Karl May dem zur Erbschänke des Ortes gehörenden Bauernhof des Gasthofbesitzers Johann Gottlieb Schreyer (1823-1892).
Er vollführte hier einen Coup, den man Jahre später von den Abenteuerromanen her als gängiges Motiv kennt. So vermeldeten die Dresdner Nachrichten in ihrer No. 161 vom 10. Juni 1869: „Ein unbekannter Gauner hatte in der Nacht vom 3. zum 4. d. M. in frechster Weise aus dem unverschlossenen Stalle des Gasthofs in Bräunsdorf ein Pferd im Werthe von 200 Thalern und ein Peitsche gestohlen und war mit seinem Raube flüchtig geworden. Das Pferd wurde, wie wir soeben erfahren, in einem Dorfe bei Meerane, wo es der Dieb hat verkaufen wollen, wiedererlangt. Der Letztere selbst aber hat sich flugs aus dem Staube gemacht und es soll seine Habhaftwerdung noch nicht gelungen sein.“
May wandte sich mit dem gestohlenen Pferd nach Remse, einem 10 km südwestlich von Bräunsdorf gelegenen Ort. Vergeblich bot er das Pferd dort zum Verkauf an. „In Höckendorf, 4 km von Remse entfernt, fand er schließlich in der Person des Pferdeschlächters Voigt einen Interessenten, der das Pferd für 15 Taler zu kaufen gewillt war. [...] Zu einer Aushändigung des Kaufgeldes kam es jedoch nicht, weil – wieder einmal – die Verfolger aus Bräunsdorf dem Pferdedieb so dicht auf den Fersen waren, daß dieser schleunigst in Richtung auf Schindmaas zu Reißaus nahm.“
Im Gendarmerieblatt heißt es u. a.: „Das Pferd wurde in Höckendorf bei Meerane, wo es der Unbekannte hatte verkaufen wollen, wieder erlangt, letzterer ist aber nach Schindmaas zu geflüchtet und nicht zu erlangen gewesen.“139
Gendarm Grundig nahm irrtümlich an, dass es sich bei dem Pferdedieb um den steckbrieflich gesuchten Handarbeiter Johann Gottlieb Franke aus Dänkritz handelte. Die Identifizierung Mays als Täter fand noch nicht statt.
Mülsen St. Jacob, 15. Juni 1869: Während Staatsanwaltschaft und Polizei nach ihm fahndeten, entwickelte May weitere Pläne. Er änderte seine Vorgehensweise für die Durchführung weiterer Delikte, indem er sich Urkunden eigenhändig anfertigte, um sie zu Täuschungszwecken bei künftigen Unternehmungen einzusetzen. So stattete er sich „mit einem selbst gefertigten Schriftstück aus, ‚Acta, betreffend in Sachen der Erbschaft des Particuliers140 ... ‘ [der Name war offen gelassen worden], am 24. Mai 1869 in Dresden vom ‚Vereinigten deutsch-amerikanischen Consulat‘ ausgestellt und vom ‚amerikanischen General-Consul‘ G. D. Burton sowie vom ‚sächsischen General-Consul‘ Heinrich von Sybel unterzeichnet.“141
Ein ‚vereinigtes deutsch-amerikanisches Consulat‘ existierte nicht. Leiter des ‚Consulats für die Vereinigten Staaten von Nordamerika‘ war nicht G. D. Burton, sondern der Consul William S. Campbell. Heinrich von Sybel (1817-1895) war ein bekannter Historiker und Abgeordneter des Norddeutschen Bundes, jedoch kein sächsischer General-Consul.
Die Vollmacht ermächtigte einen gewissen „Dr. Schaffrath, Advokat aus Dresden“ nach den unbekannten sächsischen Erben eines in Cincinnati verstorbenen Partikuliers zu recherchieren. Diesmal hat die Person des Dr. Schaffrath ein reales Vorbild: Dr. jur. Wilhelm Michael Schaffrath (1814-1893) lebte 1869 als Advokat, Notar und ehemaliger Stadtrichter in Dresden, Johannisplatz 1. Dass May die beschriebenen Schriftstücke verwendet hat, bestritt er später vor Gericht nachdrücklich. Es konnte ihm auch keine missbräuchliche Benutzung nachgewiesen werden.
Am Vormittag des 15. Juni 1869 erschien Karl May in Mülsen St. Jacob, 12 km südwestlich von seiner Heimatstadt entfernt im Hause des Webermeisters und Bäckers Christian Anton Wappler (1816-1879). Er stellte sich Wappler als Expedient des Advokaten Schaffrath vor und tischte ihm eine fantastische Geschichte auf, die Tage später in den Dresdner Nachrichten, Nr. 172 vom 21. Juni 1869, nachzulesen war:
„Ein ähnlicher Schwindel, wie er in letzter Zeit an verschiedenen Orten des Landes verübt wurde, ist vor einigen Tagen auch in Mülsen St. Jacob vorgekommen. Dort kam nämlich ein junger Mann zu einem Bäcker und spiegelte dem letzteren vor, daß er beauftragt sei, ihn, den Bäcker und seine drei Söhne in das Gericht nach Glauchau zu bestellen, woselbst sie Geld aus dem Nachlasse eines Verwandten in Empfang nehmen sollten. Der Bäcker und seine drei Söhne schenkten dieser frohen Botschaft ohne Weiteres vollen Glauben und begaben sich ohne Verzug selbander auf den Weg nach Glauchau. Nunmehr stellte sich der Fremde der allein zurückgebliebenen Bäckersfrau als einen Beamten der höheren geheimen Polizei vor, der beauftragt sei, nach falschem Gelde zu recherchieren. Er verlangte das Geld der Bäckersfrau zu sehen, diese brachte ihre Baarschaft auch gutmütig herbei und nachdem der Herr Polizeibeamte 40 Thaler zu sich gesteckt und die Bäckersfrau in die Kammer, in der sie sich befand, eingeschlossen hatte, machte er sich schleunigst aus dem Staube. Der aus Glauchau zurückkehrende Bäcker wird seiner Ehefrau keine großen Vorwürfe darüber, daß sie sich so plump hatte täuschen lassen, gemacht haben, da er sich ja auch selbst hatte betrügen lassen, denn daß man bei dem Gerichte in Glauchau von Geldern, die er und seine Söhne geerbt haben sollten, nichts wußte, daß brauchen wir nicht erst hinzuzufügen.“
Den Behörden war klar, dass „dieser Gauner der May, Carl Friedrich, vormaliger Schullehrer aus Ernstthal [ist], welchen Obergendarm Franke aus Glauchau auch für den unbekannten Pferdedieb in Bräunsdorf [...] hält.“142
Der hier erwähnte Ernst Martin Franke (1817-?) befand sich erst seit dem 1. Mai im Glauchauer Gendarmeriedienst. Mit dem ‚Fall Karl May‘ verdiente sich Franke die ersten Sporen in seiner neuen Dienststelle. Ungeachtet der allgemeinen Fahndungssituation plante May weitere Delikte. So fertigte er sich „eine ‚Polizeiliche Legitimation‘ an, ausgestellt ‚Dresden, am 19. Juni 1869‘, unterschrieben ‚Dr. Schwarze, Generalstaatsanwalt‘. Danach sollte der Inhaber dieses Dokuments, der Assessor des Königlichen Bezirksgerichts Dresden Anton Clemens Laube, ‚zu Recherchen nach falschem Papier- und Silbergeld‘ ermächtigt sein.“143
Während ein Assessor Laube nicht existierte, griff May bei dem Namen Dr. Schwarze auf den damals im Amt befindlichen sächsischen Generalstaatsanwalt zurück. Dr. jur. Louis Schwarze (1816-1888) fungierte daneben auch als Abgeordneter des Norddeutschen Bundes und profilierte sich als Autor eines sächsischen Strafrechts-Kommentars. Noch bevor May die angefertigten Legitimationspapiere einsetzen konnte, kam es zu seiner nach Art und Weise ungewöhnlichen Festnahme. Im Zwickauer Wochenblatt, Nr. 158 vom 10. Juli 1869, war zu lesen:
„Es wurde s(einer) Z(eit) von einem Menschen berichtet, der sich unter dem Namen v[on] Wolframsdorf, Polizeilieutnant aus Leipzig, bei einem Krämer in Wiederau des Diebstahls schuldig gemacht hatte, indem er sich einen Zehnthalerschein, den er für unecht, und eine Taschenuhr, die er für gestohlen erklärte, aushändigen ließ – auf Nimmerwiedersehen; ähnliche Schwindeleien beging er in einem Orte bei Crimmitschau und zuletzt in Wülfen bei Zwickau. Heute Morgen 3 Uhr ist es endlich gelungen diesen Industrieritter zu verhaften. Der Restaurateur Engelhardt fand ihn in seinem Kegelschub, wo er nach kurzem Kampfe überwältigt wurde. An das dortige Gerichtsamt abgeliefert, wurde in ihm der ehemalige Lehrer May aus Ernstthal, ein längst berüchtigtes und verfolgtes Subject, erkannt. Außer einer scharf geladenen Pistole und einem Bund Dittriche war er auch im Besitz eines gefälschten Passes, auf den Namen eines hohen Staatsbeamten in Dresden lautend.“
Bereits Ende Juni hatte May eines Nachts aus dem Kegelhaus des Restaurateurs Christian Friedrich Engelhardt (1805-1878) in Hohenstein ein Handtuch und ein Zigarrenpfeifchen entwendet. Es erscheint aus heutiger Sicht unverständlich, weshalb er sich ausgerechnet im Kegelhaus versteckt gehalten hat, wo er mit Entdeckung rechnen musste. Jedenfalls wurde er dort in jener Nacht schlafend vorgefunden und von dem Gastwirt mit Hilfe seines Schwiegersohnes Friedrich Wilhelm Gündel und des herbeigerufenen Polizeiwachtmeisters Dankegott Laukner überwältigt. „Diese Überrumpelung muß einigermaßen dramatisch vor sich gegangen sein. Der aus dem Schlaf gerissene May setzte sich zur Wehr, zog während der Auseinandersetzung sein erprobtes Doppelterzerol und spannte die Hähne; die Zündhütchen waren aufgesetzt, wie die Akten zu melden wußten. Ob das Terzerol aber mit Kugeln geladen war, ist ungewiß. May bestritt es später nachdrücklich vor dem Untersuchungsrichter, und man hat ihm auch nicht das Gegenteil nachweisen können.“144
Die Feststellung der Identität erwies sich dabei als schwierig: May war ziemlich gut verkleidet und nur mit Hilfe eines Stoffmusters konnte man ihn identifizieren. Die Presse frohlockte, dass „der vor kurzem in Wiederau als amtlicher Polizeilieutnant von Wolframsdorf aufgetretene Schwindler ergriffen und als vormaliger Schullehrer May aus Ernstthal entlarvt worden sei.“
Unter Bewachung und in Handschellen wurde der Festgenommene dem Bezirksgericht Mittweida zur Untersuchung überstellt. Dort verbrachte er seine erste Nacht im Bezirksgerichtsgefängnis, in dessen Hof seit dem 16. Juni 1997 eine von dem Schriftsteller Erich Loest gestiftete Gedenktafel aufgestellt ist. Das Chemnitzer Tageblatt und Anzeiger, Nr. 163 vom 9. Juli 1869, berichtete: „Von Hohenstein bei Chemnitz brachte man unter gerichtlicher Bedeckung einen Mann hierher, welcher als derjenige bezeichnet wurde, der an dem Wiederauer Krämer die seiner Zeit auch hier erwähnte Cassenschein-Schwindelei ausgeführt haben sollte, auch von demselben bei Vorführung als solcher erkannt worden sein soll. Sein Name ist Mai und hat er schon früher eine mehrjährige Zuchthausstrafe verbüßt. Von hier wurde er nach Werdau transportiert.“
In Mittweida hatte Staatsanwalt Taube am 3. Juli 1869 den Verhafteten erstmalig vernommen. Im Rahmen dieser Vernehmung stritt dieser alle Vorwürfe ab, sodass Taube die Gegenüberstellung des Tatverdächtigen mit den geschädigten Personen am jeweiligen Tatort anordnete.
Wiederau, 5. Juli 1869: An jenem Tag begann der Transport des festgenommenen Karl Mays zwecks Gegenüberstellungen zu allen Tatorten. Der erste Lokaltermin fand in Wiederau statt. Dort wurde Karl May von dem Krämer Reimann mit den Worten begrüßt: „Da sind Sie ja, Herr Polizeileutnant!“ May entgegnete nur kurz: „Ich kenne Sie nicht!“145 Doch das Leugnen half nicht. Auch die übrigen Mitglieder der Familie Reimann erkannten May ohne zu Zögern wieder. In Chemnitz fand unterdessen am 10. Juli 1869 bei Auguste Gräßler eine ergebnislose Hausdurchsuchung statt. Sie gab an, May seit Pfingsten nicht mehr gesehen zu haben, und wusste vermutlich auch nichts von seinen Straftaten.
Zehn Tage später erfolgte der nächste Lokaltermin in Mülsen St. Jacob mit Wappler. Auch hier leugnete May die Tatbegehung. Das gleiche Ergebnis ergab die Konfrontation mit den Zeugen in Limbach. Für Montag, den 26. Juli, ordnete Staatsanwalt Taube eine erneute Expedition des Gefangenen an. Das Ziel sollten Bräunsdorf und Höckendorf wegen des Diebstahls sein. Was an jenem denkwürdigen Tag dann geschah, rekonstruierte der May-Forscher Hans-Dieter Steinmetz: Danach war Staatsanwalt Taube am Morgen jenes Tages „vermutlich in Begleitung seines Expedienten und mit einem Wagen, von Mittweida aus über Burgstädt und Limbach in das benachbarte Bräunsdorf aufgebrochen und konnte so vor Ort, noch vor dem geplanten Eintreffen Mays [...] Zeugen vernehmen.“146
Die Bräunsdorfer Zeugenvernehmung ist in einer auszugsweisen Abschrift147 erhalten geblieben. Die vollständige Abschrift findet sich im Sonderband Karl May auf sächsischen Pfaden.
Der erste Zeuge, den Taube an jenem 26. Juli 1869 vernahm, war der Bräunsdorfer Gastwirt Johann Gottlieb Schreier (1823-1893), mit dessen Pferd May das Weite gesucht hatte. Aus den Untersuchungsakten geht Schreiers Aussage hervor:
Aus meinem Stalle ist mir in der Nacht zum 4. v[origen] M[onats] mein Pferd gestohlen worden. Der Stall war auch des Nachts unverschlossen, auch war derselbe von aussen zugänglich, da mein Gehöfte nicht geschlossen ist. In dem Stalle stand bloss dieses Pferd. Ein Knecht schlief nicht in demselben, es konnte also der Diebstahl ohne Schwierigkeit ausgeführt werden, zumal ich auch keinen Hund besitze und mein Gasthof ziemlich isoliert am Ende des Dorfes liegt. Abends war das Pferd in den Stall gebracht worden und am andern Morgen gegen 4 Uhr, als es gefüttert werden sollte, war es verschwunden. Ebenso fehlte aus dem Stalle eine ordinäre schwarze Reitpeitsche sowie eine Trense und ein Halsriemen. Die Halfter [Halsriemen] war die, mit welcher das Pferd im Stalle angehangen war. Die Reitpeitsche lag im Stalle auf dem Futterkasten u. die Trense war im Stalle aufgehangen. Das Pferd war ca. 9 Jahre alt, ein Brauner mit einem weissen Streifen auf der Stirn und weissen Hinterfüssen. Als wir das Pferd vermissten, verfolgte ich die Spur desselben ein Stück hinaus bis ans Holz, dann verlor sich die Spur. Ich eilte sofort nach Penig und zeigte den Diebstahl dem Gendarmen an. Von dem Kutscher Friedrich in dem Gasthof zum Zeisig bei Penig erfuhren wir, dass dieser dem Diebe mit meinem Pferde bei Waldenburg begegnet war. Ferner erfuhren wir, dass der Dieb das Pferd in Remse an den Pächter hat verkaufen wollen und in Höckendorf ermittelten wir, dass es beim Pferdeschlächter Voigt stehe. Dort kamen wir gegen 5 Uhr Nachm[ittag] des 4. v[origen] M[onats] hin und trafen auch unser Pferd an.
Ich nahm mein Pferd mit Einwilligung Voigts, der dasselbe noch nicht bezahlt hatte, wieder an mich und besitze es noch. Sein Werth ist z[ur] Z[ei]t noch der frühere. Der Dieb hatte sich, ohne Bezahlung abzuwarten, entfernt. Weder ich noch meine Leute können angeben, wer den Diebstahl ausgeführt hat. Ich selbst bin am 3. Juni gar nicht zu Hause gewesen. Meine Frau hat aber die entfernte Vermutung, dass ein Fremder, der den Nachmittag vor der Tat bei uns eingekehrt ist, der Thäter sei. Dieser Mensch hat eine Schwuppe [Rute] bei sich gehabt, und eine solche hat der Dieb im Stalle zurückgelassen. Die zurückgelassene Ruthe hat der Gendarm aus Hohenstein an sich genommen. [...]
Der Einnehmer in Jerisau bei Glauchau soll, wie ich gehört habe, auch Pferd und den Dieb gesehen und wahrgenommen haben, dass letzterer das Pferd geritten hat. Dafür, dass letzteres geschehen, spricht auch der Umstand, dass der Dieb eine Trense und Reitpeitsche mitgenommen. Hier im Dorfe hat auch unsere Semmelfrau Vogel mit dem Fremden, der am 3. Juni bei uns eingekehrt war, gesprochen. Ob und wo der Dieb mit dem Pferd auf dem Wege von hier nach Höckendorf eingekehrt ist, ist mir unbekannt.
Der zweite vernommene Zeuge jenes Tages war die Ehefrau des bestohlenen Gastwirtes, Rosine Johanne Schreier (1827-1910):
Am 3. Juni nachmittags gegen 2 Uhr kam von der Kirche her ein Fremder in unsren Gasthof, trank ein Glas Schnaps und entfernte sich sehr bald wieder auf dem Wege nach Limbach zu. Ich habe mir den Fremden nicht weiter angesehen und kann nur sagen, dass er einen braunen Rock anhatte und anständig gekleidet war, sowie dass er eine kleine Ruthe bei sich hatte, mit der [er] öfter wedelte. Der Umstand, dass wir am andern Morgen eine solche Ruthe im Stalle fanden, so sie der Dieb zurückgelassen, brachte mich gleich auf die Vermutung, dass der Fremde der Dieb gewesen sei. Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen, habe ihn auch nicht im Gesichte gesehen, habe auch nicht gesehen, ob sich der Fremde in unserem Gehöfte umgesehen, vielleicht gar in den Stall gegangen ist. Ich befand mich gar nicht in der Gaststube, sondern in unserem Grützegarten. Mein Sohn, der 15jährige Wilhelm, hat den Fremden bedient. Ausserdem ist nur noch unsere Semmelfrau Vogel in der Gaststube gewesen.
Die erwähnte Semmelfrau Beate Rosine Vogel (1813-1880) gab als dritte Zeugin in der Bräunsdorfer Pferdediebstahlssache folgende Aussage zu Protokoll:
Ich bin am Nachmittage des 3. Juni hier in der Schreierschen Gaststube gewesen und habe mit dem Fremden gesprochen, auf den sich die Angabe der Frau Schreier bezieht. Er trat in die Gaststube und trank ein Gläschen Nordhäuser, blieb nur wenige Minuten und entfernte sich dann wieder.
Der Fremde war ein langer Mensch, mittlerer Statur, ein Zwanziger, trug meines Erinnerns einen braunen Rock, ob er Bart hatte, weiss ich nicht, auch seine sonstige Kleidung kann ich nicht mehr angeben. Der Mann erzählte mir, dass er den vorigen Morgen bei der Schurich (wer das ist, weiss ich nicht) in Altstadt Waldenburg gewesen sei und auch den nächsten Morgen wieder zu derselben gehen wolle. Zugleich fragte er mich nach dem Wege nach Limbach und äusserte, er wolle zum Musikdirektor Richter. Deshalb dachte ich mir, es sei ein Musiker. Der Fremde entschuldigte seine Kleidung damit, dass er 12 Wochen auf Reisen sei. Er ging gleichwohl nicht schlecht angezogen.
Nun fehlte lediglich noch der Tatverdächtige zwecks Gegenüberstellung. May sollte inzwischen vom Beifrohn Posselt mit der Eisenbahn bis St. Egidien und von da zu Fuß nach Bräunsdorf transportiert werden. Einen nicht unwesentlichen Umstand bildete die Tatsache, dass es sich bei jenem Beifrohn Posselt um einen unbewaffneten Hilfsdiener des Bezirksgerichts Mittweida handelte. Der Transport von Gefangenen war zu jener Zeit nicht Aufgabe der Gendarmerie. May und sein Bewacher fuhren also von Mittweida nach Chemnitz und stiegen dort in einen Zug Richtung Zwickau um. Hätte man bereits vom Bahnhof Wüstenbrand aus den Fußmarsch aufgenommen, dann wäre die zu überwindende Distanz bis Bräunsdorf zwar kürzer gewesen, doch wollte man offensichtlich nicht den Forst östlich vom Oberwald durchqueren. Denn in dem Gebiet hatte sich May erst wenige Wochen zuvor dem polizeilichen Zugriff entziehen können. Also verließen Beifrohn Posselt und May erst eine Station nach Hohenstein-Ernstthal, in St. Egidien, den Zug. Der nach einer Fluchtgelegenheit Ausschau haltende Gefangene besaß genaue Ortskenntnis und wusste demzufolge auch, dass auf dem Weg nach Bräunsdorf über Kuhschnappel, Obercallenberg, Reichenberg und Langenchursdorf nur zwei Waldgebiete berührt werden: noch vor dem Ortseingang Kuhschnappel, nur etwa 800 Meter vom Bahnhof St. Egidien entfernt, rechter Hand der Forst um den Heidelberg, und oberhalb des Dorfes, in der Nähe des Gasthauses ‚Zur Katze‘, an der Kreuzung mit der nach Glauchau führenden Landstraße ein Ausläufer des Oberwaldes. Völlig überraschend für den Transporteur zerbrach May plötzlich durch einen gewaltsamen Ruck die eiserne Brezel148, mit welcher ihm die Hände zusammengeschlossenen waren, und entfloh sofort in den an die Straße grenzenden Wald. Beifrohn Posselt versuchte zunächst mit Hilfe herbeigerufener Arbeiter May wieder einzufangen. Erst als nach Stunden dieser Versuch gescheitert war, habe er sich auf den Weg nach Bräunsdorf gemacht, wo er gegen 14 Uhr mit der Hiobsbotschaft von Mays Flucht eintraf.
Umgehend wandte sich Taube nach Hohenstein und benachrichtigte von dort aus telegrafisch die Redaktion des Sächsischen Gendarmerieblatts. Auf dem Postweg übermittelte er einen Steckbrief vom 27. Juli 1868 des Flüchtigen mit der Aufforderung „Alles zu seiner Wiedererlangung aufzubieten.“149 Drei Tage später erließ der Untersuchungsrichter Heinrich Paul Scheuffler (1841-1909) einen weiteren Steckbrief, der in der Leipziger Zeitung, Nr. 180 vom 31. Juli 1869, abgedruckt wurde:
Der unten signalisirte vormalige Schullehrer Karl Friedrich May aus Ernstthal, wider welchen wegen zahlreicher Eigenthumsverbrechen hier Voruntersuchung eingeleitet worden ist, ist unterm 26. d. M. auf dem Transport von St. Egidien nach Bräunsdorf unter Zerbrechung der Fesseln entsprungen, und werden alle Behörden ersucht, May’n im Betretungsfalle zu verhaften und Nachricht davon anher gelangen zu lassen. [...] May ist 27 Jahre alt, 72 Zoll lang, schlank, hat längliches Gesicht und Nase, dunkelblondes, nach hinten gekämmtes Haar, schwachen Bartwuchs (trägt auch falsche Bärte), graue Augen, starren stechenden Blick, krumme Beine, ist geschlechtlich krank. Er spricht langsam, in gewählten Ausdrücken, verzieht beim Reden den Mund, hat auch oft ein Lächeln um den Mund. Bei der Entweichung trug er ein schwarzseidenes, runddeckliges Sommerhütchen, einen braunen, ins Gilbliche schimmernden, jupenartigen Rock mit breiter Weste und dergl[eichen] Hosen mit breiten schwarzen Streifen.
Obwohl auch die anderen sächsischen Blätter über den Fall berichteten und die Bevölkerung umfassend über den „berüchtigten ehemaligen Lehrer May“, diesen „höchst gefährliche[n] Mensch[en]“150 informiert wurde, blieb der Flüchtige verschwunden. Er verbarg sich „in seiner Höhle und soll nur nachts – wie Frau Selbmann (seine Schwester) zu berichten wußte – ein- oder zweimal nach Hause gekommen sein. Der eigentlichen Fessel, der eisernen Bretze, wird sich May mit Hilfe des Schmiedes Weißpflog rasch entledigt haben, sollte er sie bei seiner Flucht überhaupt noch getragen haben.“151
Die sensationelle Flucht sorgte innerhalb der heimischen Bevölkerung für großes Aufsehen. Sie führte dazu, dass „[g]estern Nacht (6. August 1869) [...] hier gegen 25 Gendarmen, die Polizeimannschaften der Umgegend und die Steiger-Section der Ernstthaler Turnfeuerwehr aus[rückte], um in den Hohensteiner Wäldern dem berüchtigten wegen einer Menge Diebstählen und Betrügereien inhaftirt gewesene May auf die Spur zu kommen. Derselbe ist [...] mehrmals in genannten Wäldern hier und da gesehen worden, muß sich aber wohl in eine andere Gegend gezogen haben, da bei der genauesten Durchsuchung der Hölzer keine Spur von ihm zu finden war. Hoffentlich gelingt es bald, diesen schlauen und raffinirten Freibeuter zu ergreifen.“152
Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. Karl May blieb verschwunden. Seine spektakuläre Flucht erinnert an die zahlreichen Szenen seines Romanwerkes. Ein frappierendes Beispiel dafür ist die Flucht des Gustav Brandt in Mays Kolportageroman Der verlorne Sohn. Der Förstersohn Brandt wird fälschlicherweise des Doppelmordes bezichtigt und soll zwecks Zeugengegenüberstellung von Ort zu Ort transportiert werden. Bei einem dieser Transporte per Bahn kann er entfliehen. Während im realen Vagantenleben Karl May der Huf- und Waffenschmied Weißpflog beigestanden hatte, ist es bei der Romanfigur Gustav Brandt der Schmied Wolf aus Tannenstein.
Nachgewiesen ist ein Aufenthalt Mays Mitte November in Plößnitz. Dort besuchte er Malwine Wadenbach (1819-?). Ihr und ihrer erwachsenen Tochter Alwine (oder Alma) war er vermutlich schon in der Zeit zuvor nähergetreten. Möglicherweise kannte May die Wirtschafterin und ihre Tochter von seinem Leipziger Aufenthalt im März 1865 her. Bei einer späteren Vernehmung sagte die Mutter aus, May habe sich ihr gegenüber als ‚Schriftsteller Heichel‘ und den natürlichen Sohn des Prinzen von Waldenburg ausgegeben. Malwine Wadenbach findet sich in Mays Erzählungen Der Giftheiner (in GW 43, Aus dunklem Tann) und Die Fastnachtsnarren (in GW 72, Schacht und Hütte) gespiegelt wieder. May hat beiden Frauen eine starke Zuneigung entgegengebracht.