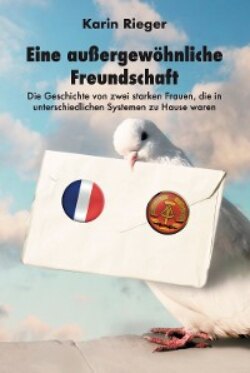Читать книгу Eine außergewöhnliche Freundschaft - Karin Rieger - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Schulzeit in Auma
ОглавлениеAm ersten Schultag bekam ich die gefüllte Schultüte, die noch von meinem Bruder stammte. Meine Mutter tröstete mich, als ich fragte, warum das Nachbarskind seine riesige Tüte nicht tragen konnte: „Siehst du, Hannelore kann ihre Zuckertüte nicht einmal selbst tragen. Außerdem sind bei ihr Schuhe drin. Es ist nicht wichtig, die größte Tüte zu haben. Wichtig ist, was du in der Schule lernst.“ So war es dann auch. Ich strengte mich an. Die anderen Kinder kamen häufig am Nachmittag zu mir nach Hause und wollten wissen, wie man die Hausaufgaben richtig erledigt.
Als ich zur Schule kam, begann mein Bruder eine Ausbildung in Weimar an der Musikhochschule im Schloss Belvedere. So wuchs ich fast wie ein Einzelkind auf. In der Wohngegend gab es aber mehrere Schulkinder, mit denen ich spielen konnte.
Zu berichten ist über jene Zeit, dass wir in den ersten Jahren auf Schulbänken saßen, die beim Aufstehen hochklappten. So wie heute im Kino, allerdings ohne Polster. Zur Konzentration beim Zuhören und wegen der Körperhaltung mussten wir oft die Hände auf den Rücken nehmen. Das hieß dann so: „Wir sitzen gerade!“
Zu Beginn einer Unterrichtsstunde standen alle auf. Der Lehrer sagte nach der Begrüßung erst dann „setzen“, wenn alle richtig ruhig waren. Während eines Lehrervortrages hatten wir gerade zu sitzen und wegen der Aufmerksamkeit die Hände auf dem Rücken zu verschränken. Das hieß dann: „Hände auf den Rücken.“ Die Klassen waren mit etwa 30 Kindern voll besetzt. In den ersten Wochen schrieben wir mit dem Griffel auf der Schiefertafel. Darauf waren auch die Hausaufgaben zu erledigen. Später hatten wir Schönschreibhefte mit drei Linien pro Zeile. So konnte man die Proportionen der Buchstaben gut erkennen. Nach einigen Monaten verwendeten wir Tinte. Oben auf den Klappbänken war eine Aussparung für das Tintenfass. Mit dem Federhalter musste man erst einmal zurechtkommen. Dann diese Kleckse! Später gab es Füller, die man nachfüllen konnte. Das war noch vor den Patronenfüllern. – Ja, was sich seit dieser Zeit in den fünfziger Jahren alles verändert hat!
Ein besonderer Feiertag war in jedem Jahr der 1. Mai. Ich erinnere mich, dass wir Ende der fünfziger Jahre die Fähnchen zu diesem Anlass wechseln mussten. Vorher waren sie schwarz-rot-golden, dann musste das Emblem der DDR mit Hammer und Zirkel im Ährenkranz in der Mitte sein. Das Beste an diesem Feiertag war immer, dass ich nach dem langen Festumzug mit der Schulklasse durch den Ort auf dem Marktplatz, dem Zielpunkt des jährlichen Maiumzuges, auf meinen Vater wartete, der uns beiden dann eine echte köstlich duftende Thüringer Rostbratwurst spendierte.
Wegen der musikalischen Ausbildung meines Bruders hatten ihm unsere Eltern eine teure Geige und ein Klavier gekauft. Als ich in der dritten Klasse war, meldete mich meine Mutter in der Nachbarstadt zum wöchentlichen Klavierunterricht an. Die Klavierlehrerin wohnte direkt am Markt, was günstig mit dem Bus zu erreichen war.
So begann ich mit neun Jahren, täglich Klavier zu üben. Das gelang ganz gut. Was mich beim Unterricht allerdings störte, waren die zahlreichen Hunde, die diese Lehrerin züchtete. Ständig schwärmte sie von den Vorbereitungen für eine Rasseschau, putzte den Hunden sogar deren Zähne und band ihnen Schleifen ins Fell.
Meine Eltern wollten, dass es uns Kindern einmal besser geht im Leben als ihnen. Sie hatten sich zur gesunden und ausreichenden Ernährung nach dem Krieg mehrere Gärten angeschafft. Das hieß aber auch für mich, dass ich am Nachmittag dort beim Ernten und Unkraut ziehen zu helfen hatte. Am schwierigsten war das Zupfen von Kamillenblüten. Wir tranken die getrockneten Blüten als Tee, auch bekam ich davon warme Umschläge bei den alljährlichen Gerstenkörnern, die mich regelmäßig befielen. Kaum war ein Auge wieder verheilt, so schwoll das andere an.
Ab der vierten Klasse meldete mich meine Mutter in der Musikschule in Gera an. Das bedeutete jeweils eine längere Busfahrt. Einmal pro Woche fuhr ich also mit meiner Aktentasche, in der sich die Noten und das Portemonnaie befanden, in die damalige Bezirkshauptstadt. Manche Nachbarn bewunderten mich, weil ich ja allein über dreißig Kilometer in die Großstadt fuhr und mich dort zurechtfand. Am Abend bummelte ich auch manchmal an den Schaufenstern der Einkaufsstraße entlang, bevor der nächste Bus zurückfuhr. Die Auslagen waren dort wesentlich umfangreicher als in meiner Kleinstadt. So drückte ich mir Woche für Woche am Fenster vom Spielzeugladen in der Hauptgeschäftsstraße namens Sorge die Nase platt. Den größeren Teddy mit den freundlichen Augen, den ich dort monatelang begrüßt hatte, kaufte ich mir schließlich von meinem zusammengesparten Taschengeld. Ja, das war dann schon Ende der vierten Klasse.
Die Zeit als Jungpionier war recht abwechslungsreich. Zu größeren Veranstaltungen wurde das blaue Halstuch getragen. Da musste die weiße Bluse gebügelt sein. Das gehörte dazu. Ansonsten halfen wir häufig älteren Menschen, ohne dafür etwas bekommen zu wollen. Wettbewerb gab es damals beim Sammeln von Altstoffen. Im Ort befand sich eine Sammelstelle, das sogenannte Rumpelmännchen. Jeder Einzelne trug seine Wertstoffe dorthin und bekam ein wenig Geld dafür. Das waren gebündelte alte Zeitungen, Pappe, Lumpen, alte Knochen und gesäuberte Flaschen. Plasteverpackungen gab es noch nicht. In der DDR wurden diese Sekundärrohstoffe in hohem Maße wiederverwendet, auch weil wir nicht so reich mit Bodenschätzen gesegnet waren. Schon allein deshalb finde ich es heute unverschämt, wenn Kinder und Jugendliche auf den Straßen nur schreien, die Alten hätten nichts für die Umwelt getan. Sie sollten lieber selbst etwas dafür tun, als nur Forderungen zu stellen.
Den Wert von Ernteerträgen lernte ich ebenfalls von Kindheit an kennen. Im Garten meiner Eltern durfte ich Erdbeeren naschen, auch Johannisbeeren usw. Wenn ich auf den Kirschbaum geklettert war, sollte ich immer pfeifen. Na ja – das war dann wohl doch nicht so ernst gemeint. Freude machte auch die Kartoffelernte. Auch das fehlt den meisten Kindern heute, sonst würden nicht so viele Lebensmittel weggeworfen. Wie viel Energie und Wasser für eine gute Ernte benötigt wird! So viele Ressourcen!
Mein Bruder blieb allerdings nicht beim Geigenspiel. Er lernte in Leipzig nach abgebrochener Musikausbildung den Beruf eines Fernmeldemechanikers. In dieser Zeit besorgte er mir auch ein Fahrrad aus der großen Stadt, denn in meiner Kleinstadt gab es keine zu kaufen. In Leipzig lernte er auch seine Frau Heidi kennen. Später schlug er die Offizierslaufbahn ein und war lange Jahre in Bernau tätig.
Mit der Schulklasse unternahmen wir jedes Jahr einen Wandertag. Da brauchte man feste Schuhe, denn es wurde tatsächlich gewandert. Einmal wanderten wir bestimmt dreißig bis vierzig Kilometer. Es ging durch ein kleines Flusstal, das damals noch unter Naturschutz stand. Später wurde dort das Wasser der Talsperre bei Zeulenroda angestaut. Zahlreiche alte Mühlen wurden trotz des Protests der Bevölkerung in dieser Senke vom Wasser überdeckt. Auch heute denke ich noch an dieses Tal, wenn wir bei einem Ausflug über die Brücke des späteren Staudamms fahren.
Wegen meiner schönen Handschrift bestellte mich einmal sogar mein Klassenlehrer ins Lehrerzimmer. Dort sagte er mir die Zensuren an und ich musste sie auf das jeweilige Zeugnis der Kinder in meiner Klasse schreiben. Da war ich ganz schön aufgeregt, weil ich mich nicht verschreiben wollte. Schließlich waren auch die Zeugnisvordrucke in der DDR Mangelware. Zu Hause gab mein Vater dazu seinen Kommentar: „Wer viel kann, muss im Leben auch viel machen. Wenn du etwas besonders gut beherrschst, dann wirst du eben auch gebraucht.“ Das erinnerte mich wieder an die vielen zusätzlichen Aufgaben, die auch mein Vater im Betrieb erledigen musste.
In den meisten Schulfächern erreichte ich gute Lernerfolge. Ab der achten Klasse nahm ich jährlich an der überschulisch organisierten Mathematikolympiade teil. Ich hatte gleich beim ersten Mal 40 Punkte erreicht, die Höchstzahl. So wurde ich das erste Mal in unserer Tageszeitung „Volkswacht“ abgedruckt. Ich war ganz stolz über das große Foto, ärgerlicherweise schrieb der Journalist einen falschen Vornamen darunter. Schon damals knobelte ich gern an kniffligen und komplexen Aufgaben. Heute setze ich dies mit meiner Enkeltochter fort.
Die Monatszeitschrift „FRÖSI“ (Abkürzung für: „Fröhlich sein und singen“), in der jedes Mal ein Gemäldenachdruck dabei war, las ich mehrere Jahre. Es gab viele Anregungen zum Basteln und Knobeln. In diesem Zusammenhang nahm ich auch noch zusätzlich an „Professor Zirkelmanns Fernakademie“ teil. So erhielt ich jeden Monat einen Lernbrief mit mathematischen Aufgaben. Ich erinnere mich besonders an die Aufgaben zum Technischen Zeichnen. Zuerst musste man Zahlen und einzelne Wörter mit Tusche und Federhalter in Normschrift zeichnen, das heißt in einem genormten Schrägwinkel. Das Ergebnis der Aufgaben ging dann per Post zurück. Danach war der Grundriss vom Wohnzimmer ebenfalls mit Tusche und Normschrift sowie mit richtigen Maßangaben und Abständen zu zeichnen. An diese Mühe habe ich nach der Wende beim Betrachten der Unterlagen von unserem ersten Haus häufig gedacht, da diese auch noch per Hand gezeichnet waren, weil es noch keine Computer gab. Schließlich erhielt ich wegen meiner genauen Arbeitsweise das angestrebte „Diplom“ in dieser Fernakademie.
Amüsant war auch das damals angesagte „Poesiealbum“. Die beste Freundin durfte zuerst einschreiben. Wichtig waren auch die Abziehbilder oder auch die Glitzerblümchen, mit denen jeder „seine“ Seite gestaltete. Aber es gab auch sehr tiefsinnige Sprüche, wie: „Richte nicht den Wert des Menschen schon nach einer kurzen Stunde. Oben sind beschwingte Wellen, doch die Perle liegt am Grunde.“ An diese Weisheit hatte ich mich häufig im Leben erinnert.
Über die Geschichte meiner Heimat erhielt ich durch die häufigen Ausflüge mit meiner Mutter einen großen Einblick. Wir besuchten mehrmals die Burg Ranis, auch mit Nachbarskindern. Sie ist hochgelegen und man hat deshalb eine großartige Aussicht in die Ferne. Eine sehr anschauliche Dauerausstellung stellte die harte Arbeit der einfachen Leute vor Jahrzehnten dar. In ein Burgverlies konnte man hinabsteigen, aber später wurde es gesperrt. Früher war es als Gefängnis genutzt worden.
Mit der Eisenbahn fuhren wir manchmal vom damals noch gut frequentierten Bahnhof in Auma auch nach Remptendorf, dem Geburtsort meiner Mutter. Die lange Reise in Richtung Lobenstein führte durch mehrere Tunnel, in denen wir meistens das Volkslied „Auf der Schwäb’schen Eisenbahne“ sangen. Das bereitete uns viel Freude. Vor Ort besuchten wir den Friedhof, der sich weit oben im Dorf befand, zu dem man deshalb über einen recht steilen Weg laufen musste. Dann erzählte mir Mutti die Geschichte ihrer Kindheit. Der Mann einer ihrer Großmütter war um 1900 nach Amerika ausgewandert, nachdem er an einem Abend, ohne seine Frau vorher zu informieren, für die Passage übers Meer sein Haus verkauft oder besser gesagt verwettet hatte, sodass sie dann mit den drei Kindern bei Verwandten unterkommen musste. Sein Versprechen, die Familie nachzuholen, löste er nie ein. Nur wenige Briefe hatte er nach seiner Ankunft geschrieben.
Erlebnisreiche Ausflüge führten auch zu meinen Tanten: Anni hatte eine Tochter, mit der ich dann lange spielen konnte. Einmal gingen wir auch gemeinsam Heidelbeeren sammeln. Bei Tante Liesbeth in Weida waren wir auch immer herzlich willkommen. Ihr Mann Otto verwöhnte im Alter seinen Hund seltsamerweise mit Schokolade. Er war Kupferschmied gewesen und hatte all die Jahre als Selbstständiger in der DDR mit den Vorschriften zu kämpfen, auch mit dem Materialmangel.
Es war die Zeit, als in der DDR die Firmenchefs und Handwerker fürchterlich bestraft wurden, weil sie sich nicht den staatlichen Firmen angeschlossen hatten. Der Chef der Landmaschinenfabrik, in der mein Vater Meister geworden und schon seit 1928 angestellt war, musste sogar ins Gefängnis. Man hatte ihn durch einen fadenscheinigen Grund belastet. Durch eine Reihe solcher Maßnahmen stagnierte die Wirtschaft der DDR.
Auch meine Tante Hilde im Nachbardorf besuchten wir oft. Dorthin mussten wir allerdings laufen, weil kein Bus fuhr und wir auch kein Auto hatten. Es war das Elternhaus meines Vaters. Für eine Radtour waren die Berge zu steil. Als wir dann zu Fuß ankamen, waren die fünf Kilometer Fußmarsch vergessen. Es waren die familiären Bindungen, die uns so wichtig waren, dass wir den Weg nicht als Strapaze ansahen.
Neben der Gartenarbeit ging ich mit meiner Mutter im Sommer häufig in die Pilze. Sie erklärte mir alle ihr bekannten essbaren Arten. Es machte viel Spaß, einen „richtigen“ Pilz zu finden. Dazwischen sang sie gern Lieder mit mir, besonders nahe ging mir ihre wunderbare Stimme beim Volkslied „Im schönsten Wiesengrunde“. Da bekomme ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es waren ausgiebige Waldwanderungen. Wir hatten auch einige Lieblingsecken, wo wir häufiger Pilze fanden. Einmal schnitten wir uns auch Schilfrohr ab. Das wurde getrocknet und daraus ein kleiner Vorhang gebastelt.
Interessant war auch, wie ich mich in unserem großen Wald zu orientieren lernte. Es gab damals noch einen hohen Schornstein vom Kraftwerk in Auma. Den sah man an lichten Stellen im Wald herausragen. In diesem Werk gab es riesige Turbinen. Wir hatten dort in einem Extraraum Werkunterricht. Einmal in der Woche bearbeiteten wir Holz. Ich stellte einen bis heute erhaltenen Untersetzer mit lackierter Intarsie her.
Meine Heimatstadt mag ich noch heute. Der Marktplatz und die Postsäule, die mit goldverzierter Schrift die Entfernungen der damaligen Postkutschfahrten anzeigt, wurden erneuert. Meine große altehrwürdige Grundschule und das Rathaus mit dem großen Glasfenster stehen noch am Platz. Die Besonderheit der Stadt lag auch darin, dass die Hauptstraße zum ehemaligen Stadttor steil nach oben führte. Im Winter konnten wir bei Glatteis auf dem Schulweg die rutschenden Lastkraftwagen beobachten. Es war aufregend, weil die Gehwege sehr schmal waren.
Im Frühjahr fand immer die Friedensfahrt durch Warschau, Prag und Berlin statt. Das war ein großes Etappenrennen der sozialistischen Bruderstaaten. Die Strecke führte auch häufig durch unsere Stadt mit dieser steilen Berganfahrt. In der unteren Kurve postierten sich viele Zuschauer, weil man die schnellen Radsportler dann länger beobachten konnte. Wir riefen laut „Täve, Täve“ als Ansporn. Das galt dem Idol unserer Mannschaft, Gustav Adolf Schur. Er gewann viele Einzeletappen, aber auch die gesamte Tour, später wurde er sogar Weltmeister.