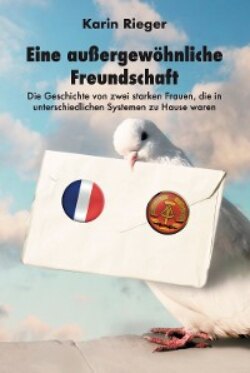Читать книгу Eine außergewöhnliche Freundschaft - Karin Rieger - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Studium in Leipzig 1970 bis 1974
ОглавлениеDie ersten Wochen waren besonders aufregend. Zuerst besorgte ich mir einen Stadtplan von Leipzig, um mich an den verschiedenen Standorten unserer Sektion zurechtzufinden. Wegen der Leipziger Messe im September begann der Studienbetrieb erst Ende des Monats. Im Franz-Mehring-Haus an der Goethestraße erhielten wir die ersten Informationen: Veranstaltungsplan der Einführungswoche, das Anmeldungsformular für den Internatsplatz, den Studentenausweis und den Stundenplan. Bald fand die Immatrikulationsveranstaltung im Audimax der Karl-Marx-Universität statt. Dort hatten sich sämtliche Erstsemester eingefunden. Wir erfuhren etwas zur Geschichte der Universität und zur Bedeutung der Hochschulausbildung in der DDR.
Die Seminargruppen fanden sich schnell bei weiteren Zusammenkünften: Erläuterungen zu den einzelnen Standorten, die weit auseinander lagen, Möglichkeiten der Straßenbahnnutzung, um von einer Veranstaltung zur nächsten zu gelangen. In diesem Zusammenhang freundete ich mich mit einer Studentin aus Dresden an, die anfangs Probleme mit der Zuordnung der Straßenbahnlinien hatte. Sie studierte Musikwissenschaft, kannte sich dafür bestens mit den zahlreichen Anekdoten über die Leipziger Musikwelt aus, und ich wurde Lehrerin für Musikerziehung und Deutsch. Einige Vorlesungen und Seminare hatten wir gemeinsam auf dem Plan, so Musikgeschichte, Instrumentenkunde und auch Russisch. Ja, für mich war es verwunderlich, weshalb wir nach all den Jahren erneut am Russischunterricht teilnehmen mussten. Wir hatten Texte zu übersetzen, schriftlich und mündlich, und Vorträge in Russisch über das eigene Leben und einige Komponisten wie Tschaikowsky und Schostakowitsch zu halten, auch über Leningrad (heute Petersburg).
Meine Studienfreundin wohnte im gleichen Internat in der Straße des 18. Oktober in Leipzig. Ich fand es dort aufregend, vom neunten Stockwerk über ein Häusermeer der Stadt schauen zu können. Es gab mir ein erhabenes Gefühl. Die Internate waren Neubaublöcke mit Zimmern, die wie in einer Wohnung angeordnet waren: drei Zimmer und dazu ein Bad bzw. Dusche mit WC und Waschbecken. Die Küche jedoch befand sich am Ende des Ganges. Es wurde von uns im Wechsel nach einem Plan gesäubert, wie in einer Wohngemeinschaft. Allerdings waren die Zimmer heillos überfüllt, anstatt der drei Betten, die neu aufgestellt waren, musste jeweils noch ein weiteres Feldbett dazwischengeschoben werden. Bettenbau, Rücksichtnahme beim Einschlafen und Warten beim Toilettengang gehörten letztlich zum Alltag. Die anderen drei Mädchen in meiner Wohnung studierten Medizin und besuchten andere Einrichtungen der Universität, sodass wir uns schließlich je nach Vorlesungszeiten aufeinander abstimmten.
Anfang Oktober fand in der DDR eine Volkszählung statt. Meine Kommilitonin fuhr an jenem Wochenende nach Hause. Ich bat sie, mir ihr bereits ausgefülltes Formular zu geben, damit ich nicht so lange überlegen musste. In diesem Moment stellte ich fest, dass sie am gleichen Tag wie ich Geburtstag hatte. Das war eine Überraschung! Das verbindet! So hatten wir fortan öfter einen Grund, gemeinsam über manche Themen nachzudenken. Ihr Fachwissen in Musikgeschichte gab sie gern weiter.
Im Sommer vor dem zweiten Studienjahr lud sie mich zu sich nach Dresden ein. Ich fühlte mich großartig, denn sie zeigte mir ihre Heimatstadt. Im Elternhaus lebten drei Frauengenerationen: Großmutter, Mutter und jüngere Schwester. Die Großmutter wollte ihr einen Pelzmantel schenken, sie mochte aber lieber eine echte Querflöte. Die Mutter schuftete als Verkaufsstellenleiterin im Konsum, also der Lebensmittelverkaufsstelle. Die jüngere Tochter war sehr schwierig. Sie hatte ständig Extrawünsche, war total verzogen. So wurde von allen vorgeschlagen, weil ich doch Lehrerin werden wollte, dass ich als Begleitung zur ärztlichen Untersuchung vor Schulbeginn mitkommen sollte. Als die Ärztin den berühmten Spatel in deren Mund steckte, war es gut, dass ich die Kleine festhalten konnte. Welche Heldentat! Es war gut gegangen. Ihrem Schulbeginn stand nichts mehr im Wege.
Meine Freundin fuhr mit mir auch nach Pirna und zeigte mir die Innenstadt von Dresden mit der damals noch als Ruine stehenden Frauenkirche, die im Krieg zerstört worden war. Wir hörten uns ein virtuoses Orgelkonzert in der nahe gelegenen katholischen Kirche an und besuchten die Aufführung des „Freischütz“ in der Felsenbühne Rathen. Diese einmalige Atmosphäre muss man einfach erlebt haben. Einen unvergesslichen Ausflug unternahmen wir auch zum Schloss Moritzburg. Wunderbare Architektur, von Wasser umgeben. Es fanden am Vortag gerade Dreharbeiten für einen Film statt, in dem das Schloss als großartige „Kulisse“ diente. Zu erkennen war das an dem hohen Mast für den Galgen, der sonst natürlich nicht dort stand. Als weiteren Höhepunkt in Dresden führte sie mich in die Welt der großen Oper ein. Da wir Semesterferien und damit viel Zeit hatten, schauten wir uns die „Meistersinger von Nürnberg“ an, eines der längsten Musikwerke überhaupt. So war ich vollends in der Welt der klassischen Musik angekommen. In Gera hatte ich mir vier Jahre vorher den „Fliegenden Holländer“ allein angeschaut, ebenfalls von Wagner.
Mich faszinierte im Studium an der Universität die Rhetorik einiger Dozenten. So war es ein regelrechter Genuss an Wortwahl und Satzbau, die Vorlesungen über Goethes Faust von Professor Dr. Dietze zu hören. Einsame Spitze. Wer dabei keine Stichpunkte notierte, fiel dem Dozenten unweigerlich auf. Wer allerdings schwatzte, wurde hinausgeschickt. Wegen der bildhaften Formulierung: „Für Sie hinten in der letzten Reihe hat der Zimmermann dort in der Wand ein Loch gelassen!“, mitten in der Vorlesung, waren diese Studenten erst verblüfft, verstanden aber dann doch, dass sie an diesem Tag zu gehen hatten. Fortan war stets konzentrierte Ruhe im Saal. Keiner wollte mehr so peinlich berührt den Saal verlassen müssen.
Interessant waren für mich auch die Seminare in Lexik, also Grammatik pur. Wir analysierten Texte verschiedener Schriftsteller nach Wortarten und Satzbau. Musikgeschichte interessierte mich ebenso wie Volksliedkunde, Harmonielehre und Werkanalyse von Musikstücken. Die bezog sich auf die Aussagekraft von einzelnen Segmenten bis hin zur gesamten Komposition berühmter Komponisten. Instrumentenkunde wurde im Grassi-Museum gelehrt. Dort kann man noch heute viele alte und neue Instrumente bewundern.
Ab dem zweiten Studienjahr war ich dort auch als Hilfsassistent tätig und konnte auf diese Weise mein Stipendium aufbessern. So kam ich wegen der billigen Miete recht gut zurecht. Meine Aufgabe bestand dabei darin, sämtliche Abschnitte vom Zeitungsausschnittdienst der DDR zu systematisieren, und zwar alphabetisch und chronologisch. Sämtliche Ausschnitte waren aus Zeitungen außerhalb der DDR, jeweils mit Erscheinungsdatum und der Quelle der Information beschriftet. Dabei erfuhr ich ganz nebenbei, was beispielsweise in Graz zu den Festspielen aufgeführt worden war. Ansonsten durften wir ja in der DDR keine Westpresse lesen.
Außergewöhnlich gestaltete sich der Unterricht im Fach Chorleitung. Wir trafen uns als Seminargruppe und lernten nicht nur taktieren, sondern auch die entsprechende Körperhaltung vor der Gruppe zu entwickeln. Im zweiten Studienjahr wechselte der Dozent, es kam der Sänger Hans-Joachim Rotzsch. Der Unterricht fand am frühen Morgen statt. So war da meist auch noch die Stimmung. Man musste also alle entsprechend aktivieren. Während des Semesters wurde Herr Rotzsch zum Professor an der Universität und anschließend als Thomaskantor berufen.
Der Studienalltag bestand für mein Studienfach aus Vorlesungen innerhalb der ganzen Sektion, aus Seminaren im Gruppenverband, verbunden mit ausgiebigen Diskussionen im Fach Politische Ökonomie des Sozialismus, sowie im Einzelunterricht beim Musizieren. Für das Gitarrespielen erreichte ich zu wenig Fertigkeiten. Das Fach Gehörbildung war recht anspruchsvoll.
Besonders amüsant war die Sprecherziehung. Meinen Thüringer Dialekt schleiften mir zusätzlich einige Kommilitonen ab. Das Wörtchen „gä“, was so viel bedeutet wie „nicht wahr“, hat sich seitdem verflüchtigt. Der Höhepunkt in diesem Gruppenunterricht war die Übung der Aussprache vom „tschechischen Streichholzschächtelchen“ und der variantenreiche Ausdruck mit dem Satz: „Ich liebe dich.“
Richtig gute Diskussionen kamen beim täglichen Fahren mit der Straßenbahn zustande und auch in der Mensa. Das Wahlessen war recht abwechslungsreich. Leider war meist zu wenig Zeit vorhanden. Einmal in der Woche fand der Sportunterricht statt. Ich entschied mich zu Beginn für das Schwimmen. Das war richtig anstrengend. Ich hatte mir vorher in Zeulenroda geschworen, in Leipzig unbedingt sicher schwimmen zu lernen. Aber es war falsch gedacht. In der Studenten-Schwimmgruppe waren fast nur Fortgeschrittene, sodass ich stets die Letzte in der Bahn war. Die Ausbilderin verlangte schließlich Kraulen, Rückenschwimmen, Tauchen und dann auch Schmetterling. Das war unter meinen Voraussetzungen nicht mehr zu schaffen.
Notgedrungen musste ich in eine andere Sportart wechseln. Beim Handball versuchte ich es, bekam allerdings als Torwart ständig die straffen Würfe zu spüren. So meldete ich mich beim Rudern an, ständig mit der Angst, ins Wasser zu fallen. Aber ich hatte Glück. Dieser Unterricht fand am frühen Morgen statt, und zwar im Elsterkanal in Leipzig. Zuerst lernten wir das Einsteigen ins Boot. Wichtig war die Koordination im Vierer. Im Zweier war ich nur einmal. Das war noch wackliger! Häufig musste ich als Steuermann (damals sagte keiner Steuerfrau) agieren. Überaus schwierig waren die Übungen auf der Wasserfläche, z. B. erinnere ich mich an den Platzwechsel vom letzten Sitz vorn zum Steuerplatz. Besonders gruselig war es, als eines Morgens bei Nebel ein Toter angeschwommen kam und sich auf das naheliegende Wehr hin bewegte. Nachdem wir die Ausbilderin informiert hatten, konnte dieser noch vorher aus dem Wasser gezogen werden. Das sind schon Ereignisse, die man nicht vergisst.
Nach dem ersten Semester zogen wir dann in ein neu fertiggestelltes Gebäude, das ebenfalls kleine Wohneinheiten enthielt. Ich bekam mit Marion und Chris eine solche Wohnung mit Miniküche und Duschbad. Wir verstanden uns sehr gut. Wieder wohnten wir im 9. Stockwerk. Diesmal in der Gerberstraße, in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof. Das hatte den Vorteil, dass man mit dem Gepäck vom Zug aus schnell zu Hause war. Problematisch waren im Sommer die recht laut zu hörenden Zugansagen (Türen schließen! Vorsicht an der Bahnsteigkante!). Manchmal nutzten wir dazu Ohrstöpsel.
Im ersten Winter fand in Jöhstadt im Erzgebirge ein Chorlager mit allen vier Jahrgängen statt. Es wurde gesungen, neue Lieder einstudiert. Als Festprogramm studierten wir mit professoraler Klavierbegleitung „Die vier Jahreszeiten“ von Händel ein. Dieses Oratorium führten wir später zu verschiedenen Anlässen auf. Für das Programm der Arbeiterfestspiele erinnere ich mich noch an das polarisierende Lied „Die Partei hat immer recht“. Besondere Freude kam beim Singen von Mozarts Kanon „Die Speisekarte“ auf und natürlich beim Rodeln am Nachmittag oder beim Wandern im Schnee. In kleineren Gesprächsrunden erfuhren wir von den Älteren, worauf man im Studium noch so achten sollte. Einige waren dabei, die noch die Sprengung der ehemaligen Universitätskirche miterlebt hatten. Es hatte auch Ärger gegeben, als sich einige Studenten dagegen aufgelehnt hatten. Aber das war mittlerweile schon nach wenigen Jahren Geschichte.
Im nächsten Winter hatten wir für fünf Wochen eine Pflichtausbildung im Lager für Zivilverteidigung. Das fand für uns an der Ostsee in einem Kinderferienlager in Glowe statt. Vorher war ich noch nie an der Ostsee gewesen. Schon deshalb bewegte mich der Anblick des Meeres besonders an dem Morgen, als wir während eines nächtlichen Alarms mit Gasmaske auf dem Kopf die Sonnenstrahlen über dem Wasser mit den zarten Wellen erblickten.
Wir übten dort jeden Tag Exerzieren, Crosslauf mit dem Überwinden einer Eskaladierwand und schnellem Lauf über einen Balken, Anlegen des Schutzanzuges mit Gasmaske und die Kommandosprache als Zugführer. Da ging es um Tempo, um Sekunden! Zur Tortur wurde auch der Geländemarsch zum Strand und anschließend mit kleinster „Wanderkarte“ und Kompass kilometerweit durch die uns unbekannte verschneite Gegend. Wie ein Schicksalszeichen empfand ich dann den Fund eines großen Hühnergottes. Das war ein etwa drei Kilogramm schwerer Stein am Hang vor der Küste, in dessen Mitte sich ein wunderschönes Loch befand. Den schickte ich damals gut verpackt nach Hause zu meiner Mutter. Er sollte viel Glück bringen.
Volleyball am Strand war bei winterlichem Wind und mit schwerem Medizinball nicht gerade erholsam. Wir übernachteten in Baracken mit Doppelstockbetten. Am Abend las eine Studentin gern aus einem Buch gruselige Geschichten vor. Mein Beitrag zur Unterhaltung in dieser Zeit war mein Overall. Zur Einkleidung gab es in meiner Größe nur noch diesen Overall. Während der Seminare über ABC-Waffen und beim Exerzieren mussten wir die Koppel tragen. Zu den Mahlzeiten aber nicht, sodass dann alle, die hinter mir liefen – und das waren nicht wenige – stets einen Lachkrampf bekamen: Der Gesäßteil meines Overalls landete dann mangels stützenden Gürtels fast am Knie.
Es gab auch andere heitere Stunden. Im Herbst des zweiten Studienjahres mussten wir zum Einsatz bei der Kartoffelernte für wenige Groschen Lohn pro voll gesammeltem Korb. Trotzdem machte es an der frischen Luft Spaß. Ich glaube, das können sich die Studenten heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Ein weiterer Schwerpunkt im Musikstudium war der Klavierunterricht. So wie vorher an der Musikschule in Gera bekam ich auch in Leipzig die klassische Ausbildung im Einzelunterricht: Etüden und Sonaten waren zu üben und dann in der nächsten Woche vorzuspielen. Ich mochte besonders die Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach. Die waren zwar technisch sehr komplex, aber mir gefiel diese polyphone Melodieführung.
Schwierig war in diesem Zusammenhang die Möglichkeit des Klavierübens. Da ich wegen des langen Fahrweges nicht jedes Wochenende nach Hause fahren konnte, blieb ich oft in Leipzig. Wir hatten den Einzelunterricht in der Bernhard-Göring-Straße, dem heutigen Gebäude des Landgerichtes. Damals war im hinteren Teil dieses Gebäudekomplexes ein Gefängnis untergebracht. Wegen der Akustik durften wir die Räume mit den Instrumenten auch nur bis zum frühen Abend nutzen. So suchte ich mir eine andere Möglichkeit zum Üben. Ich sprach in der zentral gelegenen Kirche vor und bekam den Schlüssel vom Gemeinderaum, ganz uneigennützig, um dort am Klavier zu proben. Einige fanden das originell.
Insgesamt fand ich das Studium mit all seinen Fächern sehr interessant. Ich lernte fleißig, sodass ich nach einigen Monaten von den anderen in die FDJ (Freie Deutsche Jugend)-Leitung gewählt wurde. Daraus ergab sich auch, dass ich auch auf Studenten aus anderen Studienrichtungen innerhalb der Sektion Musikerziehung – Germanistik traf. Leider war dabei keine Kontinuität zu erreichen, weil in Leipzig alles räumlich so auseinander gelegen war. Man hatte zu wenig Möglichkeiten, sich konkrete Projekte vorzunehmen. Ich war auch noch viel zu schüchtern für eine Eigeninitiative.
Nachdem aus unserer Seminargruppe Annegret in die SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) eingetreten war, stellte ich ebenfalls den Antrag dafür. Ich sah den Beweggrund darin, in der DDR später als Lehrerin Kinder im sozialistischen Sinne zu bilden und zu erziehen, nämlich jeden nach seinen Fähigkeiten. Dazu suchte ich mir zwei notwendige Bürgen: Frau Professor Brock und den Dozenten und Komponisten Dr. Treibmann (später Professor).
Als Würdigung meines vorbildlichen Studiums wurde ich mit einigen Kommilitonen zum Studienaufenthalt nach Krakau an die Jagielonski-Universität für zwei Wochen delegiert. Das zentrale Universitätsgebäude war von feinster Architektur, mit Kassettendecken, von deren Quadraten jeweils ein weißer Kopf eines der zahlreichen Gelehrten aus der polnischen Wissenschaft herabschaute. Ein großartiger Anblick!
Wir waren mit polnischen Studenten in Internaten untergebracht. Sie studierten Germanistik und wir hatten jeweils fünf bis zehn Schützlinge, mit denen wir in dieser Zeit viel in der Stadt unternahmen und uns auf Deutsch unterhielten. Ich freundete mich mit Iwona aus Poznań an. Sie konnte schon recht gut Deutsch sprechen und half den anderen aus ihrer Gruppe bei der täglichen Unterhaltung. Wir besuchten in der wunderschönen Stadt Krakau den großen Marktplatz, die Markthallen, in denen ich mir farbige Vasen kaufte, den Wawel, das Weichselufer und auch einige Eiscafés.
Einen großen Ausflug unternahmen wir an die tschechische Grenze. Dort fuhren wir, geleitet von einem Goralen, auf dem Grenzfluss zu Tschechien in einem sehr flachen Boot, das mehr einem Floß ähnelte. An einem anderen Tag ging es per Bus zu einem Salzbergwerk, in dem es sogar eine Kirche unter Tage gab.
Es war der 14. Juli 1973. Am späten Nachmittag hatten wir noch einen Auftritt für die Dozenten des Lehrgangs für Romanistik vorbereitet. Ich sang als Solo das von Thea am Klavier begleitete Lied „Männer lieben stets zu naschen“. Der Auftritt kam sehr gut an, aber es war kein freudiges Ereignis für uns geworden, weil wir vorher das KZ in Auschwitz besucht hatten. Wir hatten noch all die Bilder im Kopf von den Baracken, in denen die Menschen untergebracht waren, den Gaskammern mit den seltsamen Aufschriften an deren Türen, den großen Glastruhen mit Gebissen, mit Haaren und auch die Schirme aus Menschenhaut. Anblicke von Unmenschlichkeit, die man nie vergisst! Ein Besuch am französischen Nationalfeiertag!
Mit Iwona hatte ich mich noch längere Zeit geschrieben. Sie wollte gern einen deutschen Mann heiraten.
Im gleichen Sommer wurde ich auch nach Berlin delegiert. Direkt aus Krakau kommend ging es zu den Weltfestspielen der Jugend und Studenten. Aus meiner Seminargruppe war ich die Einzige. Es herrschte eine großartige Atmosphäre, eine einmalige weltoffene Stimmung. Am Brunnen vom Alexanderplatz wurden stets Lieder gesungen. Die meiste Zeit trugen wir unser blaues FDJ-Hemd. Wir waren in einer Turnhalle untergebracht. Zur Tagesverpflegung erhielten wir einen Beutel voller Essen (Brötchen, Wurst und Süßes), denn wir waren ja den ganzen Tag in kleineren Gruppen in Berlin auf den Beinen. Es fand die Demonstration am Alexanderplatz unter dem Motto der Gastfreundschaft für die Jugend der Welt statt. So konnten wir die damals hochverehrte kommunistische Kämpferin Angela Davis auf der Bühne in einer kurzen Rede erleben. Es ging um die Solidarität mit den Opfern des Krieges in Vietnam.
Ich persönlich war besonders begeistert von einer Aufführung der 9. Sinfonie von Beethoven auf dem Bebelplatz. Rund um die Freilichtbühne waren so viele Zuhörer, dass wir uns schließlich auf die Stufen vom Berliner Dom setzten und von dort aus das außergewöhnliche Konzert genießen konnten. Mir fiel dabei auf, dass damals aus dem Gemäuer des Doms mehrere kleine Bäumchen wuchsen. Alles war noch sehr kahl an diesem Platz. Der Palast der Republik wurde erst später gebaut und die Granitschale befand sich auch noch nicht im Lustgarten. Aber für die Akustik bot diese Freifläche viel Freiraum. Ich empfand es hochemotional, mit derart vielen Menschen aus den verschiedensten Ländern gerade dieses Musikwerk zu erleben.
Auf der Rückfahrt von Berlin nahm ich noch meinen kleinen Neffen mit nach Auma, den ich vorher bei meinem Bruder in Bernau, der inzwischen mit seiner Frau aus Dresden in die nördliche Nachbarstadt von Berlin gezogen war, abholte. Ich unterhielt mich sehr gern mit Udo. Er fragte mich zum Beispiel, warum in Leipzig so viele alte Häuser stehen. Er wohnte nämlich in Bernau in einem Neubauviertel. Doch so einfach konnte man das einem fünfjährigen Kind nicht erklären.
Im Herbst des vierten Studienjahres erfuhr ich durch einen Dozenten, dass meine Kandidatur als SED–Mitglied nicht erfolgreich war. Ich war verblüfft und konnte nicht so recht verstehen, dass man mich nicht aufnehmen wollte. Die offizielle Begründung hieß: Es sollen anteilsmäßig mehr Mitglieder aus der Arbeiterschaft aufgenommen werden. Nicht zu viel Intelligenz! Das musste ich erst einmal verdauen: Bisher stets in der „Schublade“ Arbeiterkind sollte ich als künftige Lehrerin, somit in der Zuordnung zur „Intelligenz“, nicht der SED beitreten, die Schulkinder jedoch für den SED-Staat bilden und erziehen. Ja, das muss über die DDR eben auch gesagt werden. Ich habe dem nicht nachgetrauert, aber eben schon meine Schlussfolgerungen für mich persönlich gezogen.