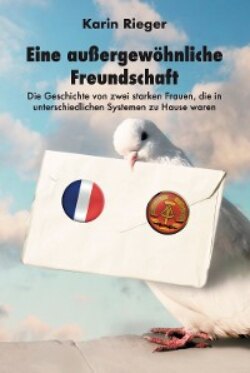Читать книгу Eine außergewöhnliche Freundschaft - Karin Rieger - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erweiterte Oberschule in Zeulenroda 1966 bis 1970
ОглавлениеDer Start an der EOS war äußerst ungünstig für mich. In der Zeit, als sich alle Klassenkameraden aufeinander einstimmten, bekam ich die Röteln. Ich lag drei Wochen mit roter Haut und dicken Eiterpusteln im Bett und sollte außerdem in einem verdunkelten Raum bleiben. Das war hart.
Die anderen Schüler hatten sich inzwischen miteinander angefreundet, denn wir kamen ja aus mehreren Orten in der Kreisstadt zusammen. Wegen der Ansteckungsgefahr konnte mich von denen niemand besuchen. So musste ich im Anschluss sämtliche Unterrichtsinhalte nachholen. Das gestaltete sich deshalb schwierig, weil meine Klassenkameraden auch nicht immer alles verstanden hatten. Das Lernniveau war hoch. Als ich meinen Klassenlehrer, der Physik unterrichtete, wegen eines Stoffgebietes in Physik nachfragte, verwies er mich an die Mitschüler. Das fand ich unerhört. Wozu war er mein Lehrer? Es dauerte Monate, bis ich mich gerade in dieses Fach ohne die jeweiligen Experimente hineingefunden hatte.
Auch die Russischlehrerin war sehr streng. Wir mussten jede Woche mindestens zwanzig Vokabeln lernen. In jeder Unterrichtsstunde wurde ein Schüler dazu mündlich geprüft. Manchmal wurden auch alle schriftlich testiert. Um sich keine schlechten Zensuren „einzufangen“, lernten wir ständig. In der Klasse selbst gab es kaum Häme. Wenn einer nicht klarkam, so halfen wir uns untereinander.
Im Chemieunterricht stand das Experimentieren sowie der Umgang mit dem Periodensystem der chemischen Elemente, deren Zusammenhänge wir ausgiebig erlernten, im Vordergrund. Durch chemische Experimente lernten wir insbesondere, genau zu arbeiten. An meiner EOS – heute nennt man das Gymnasium – wurde streng zensiert. Zugleich wurden uns Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit in Bezug auf eine Persönlichkeitsbildung abverlangt, genau das, was man auch heute im Arbeitsleben braucht.
In Biologie mussten wir fast in jeder Unterrichtsstunde Fragen in einer schriftlichen Leistungskontrolle beantworten. Dazu wurden in den ersten Minuten der Stunde die Fragen angesagt und zehn Minuten später wurden die Zettel eingesammelt. Das waren meist Anwendungsaufgaben zum Lernstoff. Ich erinnere mich an das Beispiel: „Begründe, warum des Nachts alle Katzen grau sind!“ Unser Biologielehrer, Herr Vogel, brachte uns damals schon bei, dass die Politik einen großen Einfluss auf die Umwelt und Natur hat. Er erklärte uns, dass man für höhere Ernteerträge lieber die Kartoffeläcker wegen der Schädlinge spritzt, als dass man sich um die damit möglichen gesundheitlichen Folgen für die Bürger schert.
An den Erweiterten Oberschulen in der DDR gab es verschiedene Schwerpunkte: altsprachliche, neusprachliche, kombinierte und naturwissenschaftliche Orientierung. Dies diente der langfristigen Studienwahl. In meinem Jahrgang verließ der Lateinlehrer die Schule aus Altersgründen. So wurde eine kombinierte Klasse gebildet und zwei naturwissenschaftliche. Ich kam in Letztere mit Französischunterricht als zweiter Fremdsprache, weil ich dies ja schon in der 7./8. Klasse angefangen hatte und die beiden Englischklassen schnell voll waren.
Meine Fähigkeit, logisch zu denken, verstärkte sich in jener Zeit. Immer wieder stellte ich mir die Frage, werde ich Mathematik studieren oder Musik. Eine Kombination schien sehr schwierig. Mit purer Mathematik konnte ich als Jugendliche noch nicht viel anfangen. Trotzdem ließ mich dieser Gedanke lange nicht los. In jedem Sommer fuhren wir für zwei Wochen ins Mathematiklager ins Erzgebirge. Johanngeorgenstadt bot zahlreiche Wandermöglichkeiten, die wir am Nachmittag nutzten. Am Vormittag lernten wir, spezielle Mathematikaufgaben anhand der Beispiele aus den Aufgaben bei Mathematikolympiaden in den Vorjahren zu lösen. Am Abend spielten wir Tischtennis im Schulgebäude, in dem wir untergebracht waren. Außerdem wurde von unserem Mathematiklehrer, der sonst im Unterricht gern einen Witz zur Auflockerung parat hatte, jedes Mal ein Quizabend mit Fragen zum Haushalt und über Allgemeinwissen veranstaltet. Insgesamt brachten mir diese Sommerlager persönlich ein dauerhaft gutes Abschneiden bei der jährlichen Mathematikolympiade und auch Freundschaften über die Schulklasse hinaus.
Was mir an der EOS auch zusagte, war der Lehrervortrag, so wie im Deutschunterricht bei Herrn Ficker über das Leben und Wirken von Gotthold Ephraim Lessing. Dabei lernten wir immer besser, wie man sich während des Zuhörens konzentriert und gleichzeitig Stichpunkte notiert. Das konnte ich später im Studium gut anwenden. In Erinnerung sind mir zwei gelungene Aufsätze geblieben: „Ich stelle mich vor“ sowie die „Beschreibung eines Kulturdenkmals“. Ich wählte dafür die Kirche in Auma, ließ mir dafür vom Pfarrer den Schlüssel geben und schrieb Notizen vor Ort beim genauen Betrachten des Kirchenschiffes. Das war für mich recht aufregend, allein in der Kirche zu verweilen.
In Geografie durfte jede Stunde ein Schüler vorn an die große Karte – Europa, Asien, Weltkarte – und musste Städte, Gebirge, Flüsse, Meere oder Halbinseln zeigen. Mehrmals kam dann der Hinweis vom Lehrer: „Wenn ihr nach dem Studium ein gutes Auskommen habt, dann solltet ihr einmal am wunderschönen Sewansee euren Urlaub verbringen. Ich war während des Krieges dort im Lazarett, konnte in jener Zeit viele Bücher lesen.“ – Nun, ich war bis heute nicht in der Sowjetunion beziehungsweise in Russland zu Gast, habe es aus den verschiedensten Gründen mehrfach verschoben.
Neben dem Lernen fand auch eine interessante Betätigung innerhalb der FDJ (Freie Deutsche Jugend) statt. Es war mehr oder weniger obligatorisch, in diese Organisation einzutreten und sich zu engagieren. Die Nachmittage waren abwechslungsreich und wurden mit zahlreichen Schultraditionen verknüpft. So fand in jedem Jahr für Schüler und Lehrer mindestens ein Ball in einem Kulturhaus des Kreises statt, so zum Fasching oder zu Ostern. Lange wurde überlegt, was man denn diesmal anzieht.
Ich wurde in unserer Klasse in den Gruppenrat gewählt und führte erneut die Klassenchronik. So habe ich heute noch viele Erinnerungen an diese Zeit. Auch die Klassenfahrten waren jeweils ein Höhepunkt. Wir fuhren nach Ziegenrück und Lauscha.
In den Sommerferien 1968 wurde ich ins FDJ-Schulungslager nach Wilhelmsthal bei Eisenach delegiert. Am Vormittag tauschten wir uns über die FDJ-Veranstaltungen an anderen Schulen aus. Die Teilnehmer waren aus ganz Thüringen angereist. Die Unterbringung war ungewöhnlich, und zwar im Jagdschloss Wilhelmsthal, einer alten Villa nahe der Drachenschlucht, die durch steile, hohe Seitenwände eingeschlossen war. Neben Sportveranstaltungen und Ausflügen zur Wartburg und ins Lutherhaus gab es viele interessante Gespräche, auch an den Abenden.
Zum Abschluss fand eine Veranstaltung im Speiseraum bzw. im großen Kaminzimmer statt. Dieser war vom Interieur her recht dunkel gehalten, sodass alles in dieser schummrigen Atmosphäre zusammenpasste. Einige sangen Lieder, andere führten Sketche vor. Ein anderer Schüler gab allen zu verstehen, dass er hobbymäßig als Hypnotiseur auftritt. Alle waren gespannt. Wir sollten auch ganz still sein während seines Tuns. Zum Aufwachen mussten alle laut klatschen, damit der Auserwählte wieder „aufwachte“. Er suchte sich drei Schüler aus, die natürlich erst einmal zustimmen mussten. Sie wurden hinausgeschickt. Danach besprach er mit den anderen, was passieren sollte. Der Erste sollte seine Armbanduhr ablegen. Das lief in gespenstischer Ruhe reibungslos ab. Der zweite Schüler zog seine Jacke nach der Hypnose aus. Beim dritten war es besonders aufregend. Würde die Hypnosekraft so weit reichen? Er bekam den Auftrag, seine Freundin, die er erst in dieser Zeit kennengelernt hatte, zu küssen. Sie saß im Saal ziemlich weit hinten. Ohne ein Wort zu sprechen, wurde der Junge vom Hypnotiseur nur durch dessen intensiven Blick animiert, vom Stuhl aufzustehen. Dann ging er zuerst in eine andere Richtung und alle wollten schon schmunzeln, ob er sie denn auch findet, denn er hatte die Augen verbunden. Nach einigen Irrungen und bei Totenstille kam er schließlich auf seine Freundin zu und küsste sie. Dann tobte unser Beifall und er war total verwundert wie die anderen beiden vorher auch. Sie hatten nichts mitbekommen während der Hypnose. Es war eine fast gruselige Stimmung.
In der 11. Klasse wurde ich auch noch zur FDJ-Schulkassiererin gewählt. Der FDJ-Beitrag betrug zehn Pfennige pro Monat und dann war noch ein DSF (Deutsch-sowjetische Freundschaft) -Beitragszuschlag erwünscht. Dazu erhielten die einzelnen Kassierer aus den einzelnen Klassen eine Anleitung von mir, was dazu führte, dass die Beiträge pünktlich weitergeleitet werden konnten. Im Oktober 1969 wurde ich als Delegierte nach Berlin zur Feier des 20. Jahrestages der Gründung der DDR nominiert. Es waren erlebnisreiche Tage. Neben einem großen Marsch Unter den Linden erinnere ich mich besonders an ein Konzert mit den Darbietungen zahlreicher Chansons durch Juliette Gréco im Brechttheater. Ihren Auftritt empfand ich einzigartig: Dunkle Bühne, schwarzes langes Kleid – nur die sich ausdrucksstark bewegenden Hände und das angestrahlte Gesicht waren weiß, ihr Gesang mit markanter Stimme.
Zur Vorbereitung auf dieses Jugendtreffen kaufte ich mir den auffallend roten Anorak, den sogenannten FDJ-Anorak, weil ich wirklich eine warme Jacke für den Winter brauchte. Die trug ich dann noch einige Jahre. Meine Eltern und ich sparten. Mein Vater hatte im Frühjahr eine Nierensteinoperation im Krankenhaus in Gera. Das war zwar überstanden, aber die Zeit der Heilung lief über den normalen Zeitrahmen einer Krankschreibung hinaus. So mussten wir Sozialhilfe beantragen, die es auch in der DDR gab. Daraufhin erhielt ich auch eine billigere Monatskarte für den Bus zur Schule nach Zeulenroda. Schlimm war neben der langwierigen Genesung, dass meinem Vater ein Jahr später die Nierensteine auf der anderen Körperseite entfernt wurden. Er hatte durch seine Zeit als Soldat im Zweiten Weltkrieg mehrere Kriegsverletzungen und wurde später als schwerbeschädigt eingestuft. Schon deshalb hatte ich meiner Mutter so viel geholfen.
Trotzdem gaben meine Eltern nicht auf. Mein Bruder kam nur selten zu Besuch. Als er aber 1969 Papa geworden war, fuhr ich mit meinem Vater nach Bernau, um das Neugeborene zu sehen. Dann lud mein Bruder mich und unseren Vater ein, mit ihm den Film „My Fair Lady“ im neuen Kino International in Berlin anzuschauen. Das war ein Kunstgenuss mit dem Gesang und dem neuen breiten Format der Leinwand.
In den folgenden Jahren wollte mein Bruder gern mit seiner Frau allein in den Urlaub fahren. Er brachte seinen Sohn in den Sommerferien nach Auma und meine Mutter betreute ihn. Ich durfte auch gleich Windeln wickeln und den Kinderwagen schieben, was nicht ohne kleine Bemerkungen von Nachbarn blieb. Für meine Eltern war es Schwerstarbeit. Ich betreute das aufgeweckte Kind in den folgenden Jahren, um meine Mutter zu entlasten.
Richtig angenehme Stunden erlebte ich während der Tanzstunde. Nach alter Tradition der Gymnasiasten meldeten wir uns im Herbst 1967 wie fast alle aus der Schulklasse beim privaten Tanzunterricht an. Schnell fanden sich Tanzpärchen. Mich forderte Frank zum Tanz auf. Er konnte gut führen und so lernten wir die Grundschritte vom Foxtrott, Walzer und Tango. Ich hatte mir die Tanzschritte sogar im Anschluss an die Tanzstunde aufgemalt.
Für ein halbes Jahr trafen wir uns jeden Dienstagabend. Mein Tanzpartner besuchte eine andere Schule, lernte danach den Beruf des Werkzeugmachers. Im Frühling 1968 fand dann der Abschlussball statt. Dafür hatte mir meine Mutter ein wunderschönes Kleid aus grün-goldenem Brokat genäht.
Grundsätzlich unterstützten wir uns in der Schulklasse gut. Hausaufgaben wurden zum Teil gemeinsam erledigt. Besonders schwierig erschien mir persönlich der Unterricht, als wir in der 11. Klasse andere Fachlehrer in mehreren Fächern bekamen, so in Deutsch, Staatsbürgerkunde, Physik und Chemie. Und sogar einen anderen Klassenlehrer, unseren Sportlehrer! Spätestens zu jener Zeit bemerkte ich, dass die Methodik eines Lehrers total ausschlaggebend für den Lernerfolg sein kann. Jeder hatte seine Schwerpunkte, die er abfragte. Im Deutschunterricht verstand ich zeitweise die literaturgeschichtlichen Einordnungen nicht, da der Lehrer in den Vorjahren darauf weniger Wert gelegt hatte. Es gab einige Einzelgespräche, in denen ich den aktuellen Lehrkräften dies zu verstehen gab.
Mein Abitur bestand ich dann doch mit „sehr gut“ und war stolz auf dieses Ergebnis. Wir hatten zuvor schriftliche Prüfungen in Mathematik, Deutsch (Erörterungsaufsatz) und Russisch. Mündlich wurde ich in Deutsch (Humanitätsideal) und Physik (Relativitätstheorie) geprüft, in denen ich mich nicht auf die bessere Zensur steigern konnte. Es waren genau die Themen, die ich tatsächlich nicht so richtig verstanden hatte.
Zu meinem größten Erstaunen fand ich in meinem ersten Abiturzeugnis einen Fehler. Mein Klassenlehrer hatte mir eine Berufsausbildung (Fachverkäuferin für Einzelhandel) bescheinigt, die ich gar nicht begonnen hatte. Nach einer Aussprache im Beisein meiner Eltern schrieb er mein Zeugnis schließlich neu.
Bevor ich zur EOS kam, wurde über die Musikschule in Gera, meine Eltern und die Schulleitung in Zeulenroda eine Vereinbarung getroffen. Ich sollte von der Berufsausbildung befreit werden. Vier Jahre vorher wurde in der DDR beschlossen, dass ein Praxisbezug für Gymnasiasten sinnvoll ist. So erhielten alle Schüler einer EOS gleichzeitig eine Berufsausbildung in den vier Jahren. Das war indirekt eine Fortsetzung des UTP-Unterrichts an den POS (Polytechnischen Oberschulen). Es fanden immer drei Wochen Schulunterricht statt und dann eine Woche Berufsausbildung in einer Berufsschule oder im Betrieb. Viel Auswahl an Berufen gab es dafür allerdings nicht. Ich erinnere mich noch an Gummifacharbeiter, Landwirt, Chemielaborant, Miederwarennäherin und eben Fachverkäuferin im Einzelhandel (Lebensmittel oder Textilien). Ich hatte mich vorsichtshalber für Letzteres entschieden, erhielt aber kurz vor Ausbildungsbeginn die Genehmigung für meine Ausnahme, um mich speziell auf ein Musikstudium vorzubereiten. Das hieß aber auch, dass ich kein Lehrlingsgeld erhielt.
So nutzte ich diese eine Woche pro Monat, in der die anderen Schüler ihrer Berufsausbildung nachgingen, um zu Hause Klavier zu üben, oft bis zu acht Stunden am Tag. In der Musikschule in Gera bekam ich Klaviereinzelunterricht wie bisher, dazu noch Unterricht für ein Zweitinstrument, und zwar Querflöte bei Herrn Rosenbaum. Schwierig war es meist, die Stunden so zu legen, dass ich nur an einem Tag in der Woche nach Gera fahren musste, wegen der Zeit und wegen des Fahrgeldes. Zwischenzeitlich gab es auch Prüfungen und Zensuren an der Musikschule. Pflicht war es auch, an den Solowettbewerben für junge Talente teilzunehmen.
Ziel meines intensiven Übens und der Auftritte war die Vorbereitung auf ein Studium im Musikbereich. So erhielt ich in Vorbereitung der Studienwahl eine Einladung an die Musikhochschule in Weimar. Es ging um eine Eignungsprüfung zur Ausbildung als Musiklehrerin. Schon während der Fahrt hatte ich ein mulmiges Gefühl: Die Vorstellung, später nur mit Musik mein Geld zu verdienen, stimmten mich nicht allzu optimistisch. Die Dozenten stellten fest, dass meine Gesangsstimme stark trainiert werden müsste, um ein ganzes Leben im Beruf zu bestehen.
So blieb ich also bei meinen Zweifeln zwischen Mathematik und Musik. Schließlich entschied ich mich zum Ende der 11. Klasse, als wir die Lochkarten für die Auswahl der konkreten Studienfächer und den gewünschten Hochschulstandort ausfüllten, für ein Studium an der Universität in Leipzig, und zwar als Lehrerin für Musik und Deutsch. Diese Entscheidung hatte mich lange beschäftigt, auch später noch. Als zweiten Studienwunsch hatte ich EDV, Elektronische Datenverarbeitung, in Karl-Marx-Stadt eingetragen. Eine Zugverbindung dorthin war jedoch mit häufigem Umsteigen verbunden, auch war dieser Studiengang neu und man konnte sich das Berufsbild im Detail noch nicht so recht vorstellen.
In den Ferien nach der 10. Klasse fuhr ich in ein tolles Spezialferienlager in Rudolstadt. Dort freundete ich mich mit anderen Musikschülern aus Gera an. Wir besuchten das geschichtsträchtige Schloss und erfuhren Details über den Aufenthalt von Friedrich Schiller in dieser Stadt. Besonders amüsant war es, Menuett im Festsaal dieses Herrschaftsgebäudes tanzen zu lernen. So konnte man sich gut in jene Zeit zurückversetzen.
An der EOS gab es auch einen Chor, den ich immer häufiger am Klavier begleiten musste. Mein Musiklehrer hatte dabei die Vorstellung, dass ich diese Begleitungen in Gera lernen würde. Ich erklärte ihm aber, dass ich dort „nur“ das Solospiel von Klavierstücken übte. Aber es gab ja auch festgeschriebene Begleitsätze. Mit dem Chor traten wir in einigen Städten unseres Kreises auf. Es gab immer viel Applaus. Dazwischen spielte ich auch manchmal ein Klaviersolo. Das bereitete dann allen Freude, auch mir.
Für das eingenommene Geld für die Auftritte fuhren wir einmal mit unserem Chor und dem Musiklehrer nach Leipzig in die Oper. Dort wurde nach einem Spielplanwechsel nicht die angekündigte Oper dargeboten, sondern das Ballett „Schwanensee“. Wir waren begeistert, denn schon die weite Reise mit der Gruppe war für uns ein Erlebnis. Im Bus erklärte uns Herr Büttner noch, worauf man neben dem Tanz besonders achten sollte (Mimik, Gestik …).
Im Frühling 1968 bereiteten wir uns auf ein Programm für Jugendweihefeiern vor, bei dem eine Schülerin mit ihrer hohen Stimme einen langen Solopart sang.