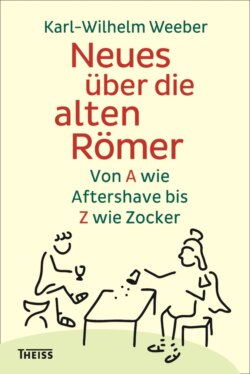Читать книгу Neues über die alten Römer - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Demonstration
ОглавлениеIm Jahre 195 v. Chr. ereignete sich in Rom Denkwürdiges. Manch einer wertete es als geradezu Unerhörtes, Revolutionäres. Im Senat stand die Entscheidung über die Aufhebung der lex Oppia an. Dieses Anti-Luxus-Gesetz war in der Not des Hannibalischen Krieges beschlossen worden, um Solidarität mit all denen zu zeigen, die Opfer des Krieges und der kriegsbedingten Einschränkungen waren. Den Damen der Oberschicht waren Goldschmuck, Purpurgewänder und Spazierfahrten untersagt worden. Nun war der Krieg seit einigen Jahren vorbei – mit einem Triumph für Rom – und das Gesetz stand zur Aufhebung an. Die Meinungen waren geteilt; Befürworter und Gegner stilisierten die Abstimmung zu einer Grundsatzfrage hoch.
In dieser Situation platzte einigen Damen der gesellschaftlichen Elite der Kragen. Sie hatten schlicht keine Lust, sich dem Diktat der Männer in dieser für sie wichtigen Frage oder einer Zufallsmehrheit im Senat zu unterwerfen. Warum sollten sie weiterhin auf inoffizielle Statussymbole verzichten? Und so taten sie das, was heutzutage selbstverständlich ist: Sie gingen für ihre Forderung auf die Straße. Das Beispiel der ersten erzürnten Protestiererinnen machte rasch Schule: „Die Menge der Frauen wuchs von Tag zu Tag an“, berichtet der Historiker Livius. Sogar aus den Nachbarstädten strömten Frauen zusammen und „belagerten alle Straßen der Stadt und alle Zugänge zum Forum Romanum“. Wer politische Verantwortung trug, hatte keine Chance, sich zu drücken: Die Damen redeten auf jeden Politiker ein, der vorbeikam, und baten ihn, in ihrem Sinn abzustimmen (Liv. XXXIV 1, 1–6).
Der Druck, den sie mit ihrer Demonstration und ihrem direkten Zugehen auf die Politiker ausübten, war nichts Neues. So reagierten römische Bürger in politischen Stresssituationen regelmäßig und zeigten damit ihre Unzufriedenheit mit den Verhältnissen und mit „der“ Politik – in Rom gleichbedeutend mit der gesellschaftlichen Elite – an. Das Muster sollte sich auch in den kommenden Jahrhunderten wiederholen: Die Plebs demonstrierte durch physische Präsenz an den politischen Entscheidungsorten ihren Willen, der mutmaßlich quer zum Willen der konstitutionellen Entscheider stand oder zumindest von denen zu wenig wahrgenommnen zu werden schien. Das lateinische Verb demonstrare heißt „zeigen“. Die Leute zeigten auf diese Weise zum Beispiel, dass sie Hunger hatten. Sie demonstrierten gegen Kornknappheit und hohe Preise. Für die Herrschenden stellte sich das als Misstrauensvotum und als Gefahr dar, auch als Verletzung der traditionellen Ordnung. Sie sprachen daher lieber von einem concursus, dem „Zusammenlaufen“ des Volkes. Das hatte die Konnotation von „Aufruhr“, „Unbotmäßigkeit“ der Masse. Es schien bedrohlich – und es sollte auch bedrohlich wirken. Die Leute waren sauer und eben das machten sie durch eine meist spontane Störung der öffentlichen Ordnung klar – eine Art von antikem Flashmob, der leicht aus dem Ruder laufen konnte und tatsächlich häufig genug in Handgreiflichkeiten und Steinwürfen endete.
So weit gingen die Frauen damals nicht. Aber der Skandal war auch so schon groß genug. Der Alte Cato sprach aus, was die allermeisten Männer – auch die Sympathisanten des Anliegens der Frauen – dachten: Die Freiheit der Männer werde „durch Herrschsucht der Frauen hier auf dem Forum zermalmt und mit Füßen getreten“; eine Verschwörung sei im Gange, eine schlimme Revolte, dass Frauen da mit einer Demonstration „die Straßen belagern und fremde Männer ansprechen“. Allenfalls könnten sie versuchen, ihren eigenen Mann daheim in ihrem Sinn zu becircen. So aber sei ihr Verhalten eine unerträgliche Disziplinlosigkeit. Gebe man der nach, dann werde man die Frauen künftig nicht mehr in Schranken halten können (Liv. XXXIV 2, 1–10).
Catos Empörung richtete nichts aus. Die Frauen erhöhten am Tag der Abstimmung sogar noch den Druck der Straße. Sie bedrängten zwei Volkstribunen, die den Antrag ihrer Kollegen, die lex Oppia aufzuheben, blockieren wollten, so massiv, dass die ihren Widerstand aufgaben. „Zwanzig Jahre, nachdem es erlassen worden war, wurde das Gesetz aufgehoben“, fasst Livius das Ergebnis der Abstimmung zusammen.
Die Demonstrantinnen hatten sich durchgesetzt. Catos Menetekel, dass sich die Frauen fortan verstärkt in die Männerdomäne Politik einmischen würden, sollte sich in den kommenden Jahrhunderten als pure Schwarzmalerei erweisen. Von Frauendemonstrationen hören wir nichts mehr, wohl aber von ähnlich verlaufenden Manifestationen der Masse, ihre Unzufriedenheit, Wut und Sorgen durch concursus zum Ausdruck zu bringen.
In der späten Republik gehörten Demonstrationen in der Hauptstadt zur Normalität. Weil in den Jahrzehnten zwischen 133 und 50 v. Chr. fast stets Gewalt oder zumindest die Androhung von Gewalt im Spiel war, mag der Begriff sogar verharmlosend klingen. Bei manchen Aktionen muss man von Aufruhr oder sogar von Aufständen sprechen, die sich bis zu Straßenkämpfen und zum Terror verfeindeter Banden ausweiten konnten. Die lateinischen Begriffe dafür sind tumultus oder seditio. Manchmal waren es Hungerrevolten, bei denen die Protestierenden nicht nur die Fäuste fliegen ließen – „der menschliche Magen ist weder der Vernunft zugänglich noch lässt er sich durch Gerechtigkeit besänftigen“, wird Seneca später feststellen (brev. vit. 15, 5) –, manchmal ging es um missliebige Beamte, um deren Amtsführung und um Korruptionsvorwürfe. Häufig aber wurden die Unruhen von Drahtziehern aus den Reihen der politischen Prominenz ausgelöst und gesteuert, die ihre Ziele mithilfe der Mobilisierung der Masse oder besser: einer, der ihnen nahestehenden Masse durchsetzen wollten und dabei vor Gewaltanwendung nicht zurückschreckten.
Beide politischen Lager der späten Republik, die Optimaten wie die Popularen, verstanden es, auf dieser Klaviatur zu spielen. Viele Demonstrationen und Tumulte, bei denen Amtsträger beleidigt und bedrängt, Menschen verletzt oder sogar getötet, Geschäfte geplündert und Häuser in Brand gesteckt wurden, waren alles andere als spontane Wutausbrüche „der“ Plebs. Sie wurden vielmehr, auch wenn sie sich gegen „die“ Politik und „die“ Politiker zu richten schienen, von einflussreichen Männern aus eben dieser Politik förmlich ausgerufen und gelenkt. Ganz gleich, ob es sich um einen solchen Stellvertreter-Aufruhr oder um ungesteuerte Kundgebungen gegen einen tatsächlichen oder vermeintlichen Missstand handelte, eines war doch allen gewaltsamen wie gewaltfreien Demonstrationen gemeinsam: Sie stellten nie das politische System Roms grundsätzlich infrage. Es waren punktuelle Misstrauensbekundungen, die da vehement auf die Straße getragen wurden, aber keine strukturellen Forderungen nach Umsturz und Entmachtung der politischen Klasse.
Mit dem Übergang zur Monarchie endeten die Demonstrationen nicht – und auch nicht die gewaltsamen Übergriffe, die sich mit manchen Protesten verbanden. So musste Kaiser Claudius im Jahre 51 n. Chr. einen wahren Hagel von Brotkrusten über sich ergehen lassen. Die Menge, die ihn vorher auf dem Forum Romanum am Weitergehen gehindert und mit Schimpfworten verfolgt hatte, demonstrierte auf diese Weise sehr handfest gegen einen bevorstehenden Versorgungsengpass (Suet. Claud. 18, 2). Wie ein solcher concursus wütender Bürger ablief, hat auch Augustus mehrfach erfahren müssen – das erste Mal noch als Triumvir Octavian, einige Jahre bevor er die alleinige Macht in Händen hielt. Auch damals war drohender Hunger der Auslöser: „Mit lautem Geschrei rotteten sich die Menschen zusammen, bewarfen alle, die nicht mitmachen wollten, mit Steinen und drohten, deren Häuser anzuzünden und niederzubrennen. Schließlich befand sich die ganze Masse in hellem Aufruhr. Octavian aber begab sich mitten unter die Leute (…). Doch als die Masse ihn erblickte, begann sie, ihn ohne jede Rücksicht mit Steinen zu bewerfen“ (App.b.c. V 68).
Die Situation spitzte sich seinerzeit so dramatisch zu, dass Octavian um sein Leben fürchten musste. Dieses und ähnliche Erlebnisse in späteren Jahren machten ihm klar, dass er als Kaiser unbedingt eine möglichst stabile Versorgungssicherheit mit Getreide und anderen Grundnahrungsmitteln gewährleisten musste. Das gelang in der Kaiserzeit weitgehend; eine Reihe von „Hungerprotesten“ ging nicht von tatsächlicher, sondern nur befürchteter Knappheit aus. Doch wurden diese Demonstrationen von den Kaisern sehr ernst genommen. Meistens wurden Ad-hoc-Maßnahmen ergriffen, die die Menschen schnell wieder beruhigten.
Man sah aber auch, dass solche Proteste fruchteten und vom Herrscher letztlich zähneknirschend als Manifestation der Stimmung im (stadtrömischen) Volk akzeptiert wurden.
Deutlich friedlicher verliefen zumeist die Demonstrationen des Publikums bei den Massenunterhaltungen. Besonders das Theater bot Raum dafür – und wurde kräftig dazu genutzt. Schon in der späten Republik entwickelte sich das Theater zu einer Art Stimmungsbarometer. Das Theaterpublikum galt als besonders ausgelassen; die theatralis licentia, „Zügellosigkeit des Theaters“, war geradezu sprichwörtlich. Umso leichter gingen die Leute dort aus sich heraus, umso spontaner taten sie ihre Freude und ihren Ärger kund und sagten den Mächtigen die Meinung. Führende Politiker und später die Kaiser konnten eine Menge über Stimmungstrends, über ihre Popularität und über konkrete Sorgen, Nöte und Anliegen der Menschen erfahren, wenn sie sich im Theater blicken ließen. Das war keine offizielle, aber eine sehr informative und effiziente Form der Kommunikation zwischen den Mächtigen Roms und ihrem Volk.
Die Theaterdemonstrationen waren eine Interaktionsform, die die Volksmasse in Rom ein bisschen an der Macht teilhaben ließ, ihr eine gewisse Form der Mitbestimmung ermöglichte und ihr zumindest das Gefühl vermittelte, etwas zu sagen zu haben und von den Entscheidern ernst genommen zu werden. Bei Missstimmung, Ängsten und Unzufriedenheit waren sie ein wichtiges Ventil, durch das Unmut kanalisiert und dadurch leichter beherrschbar wurde als bei den vorhin geschilderten concursus und seditiones. Man mag ideologiekritisch einwenden, dass dieses weitgehend argumentationsfreie kommunikative Pingpong etwa zwischen Kaiser und „Volk“ ein bloßes Surrogat für echte politische Partizipation war, das vor allem dem Kaiser in die Karten spielte. Das lässt sich kaum bestreiten, aber in Rom schien dieser Austausch beiden Seiten sinnvoll und nützlich zu sein. In der Sprache des Volkes formuliert, „brachte er was“.
Wie sehr sich die Kaiser als Erben dieser rudimentären demoskopischen Theater-Tradition sehen mussten, zeigen Äußerungen Ciceros über die Bedeutung dieser Publikumskundgebungen. An einer Stelle spricht er vom theatrum populusque Romanus, dem „Theater und Volk von Rom“ (Sest. 119). Das Theater als gewissermaßen politisches Forum noch vor der Volksversammlung – das war kühn. An anderer Stelle sagt er über den Politiker, dass populo et scaenae, ut dicitur, serviendum est, „man dem Volk und der Bühne (wie ein servus, „Sklave“) dienen müsse“. Das eingeschobene ut dicitur, „wie man sagt“, lässt erkennen, dass Cicero nicht der Einzige war, der diese „Tyrannei“ empfand (Cic. ad Brut. 17, 2): Wer in der Politik erfolgreich sein will, muss sich der Masse „andienen“. Das sagt ein taktisch gewiefter Politiker, der beileibe kein Demokrat ist. Cicero kann auch ganz anders, wenn er die vermeintlichen „Herren der Welt“ auch einfach einmal sentina urbis nennt, das „Brackwasser, die Jauche der Stadt“ (leg. agr. II 70, allerdings als Zitat).
Wie sahen die Demonstrationen des Theaterpublikums im Einzelnen aus? Es waren z.T. schlichte, aber nicht falsch zu interpretierende affektive Gesten, Signale der Zustimmung oder der Ablehnung, die dort von der Masse ausgingen: Applaus und stürmische Zu- und Hochrufe beim Eintreten hochgestellter Persönlichkeiten und Angehöriger der kaiserlichen Familie zum einen oder eisiges Schweigen, Auspfeifen, Schmährufe und Verwünschungen auf der anderen Seite, nicht selten in skandierender Form. Drohend in den Himmel gereckte Fäuste Tausender zeigten an, dass der damit Gemeinte zumindest vorübergehend den begehrten favor populi, die „Volksgunst“, verloren hatte.
Wichtige Botschaften verliefen auch über die Reaktion der Zuschauer auf bestimmte Verspartien, die die Schauspieler vortrugen. Spontaner Beifall für ein zur politischen Situation passendes, sie scheinbar kommentierendes Zitat war ebenso eine Demonstration der allgemeinen Stimmung wie die Forderung danach, eine bestimmte Stelle zu wiederholen. Solche revocationes, „Rückrufe“, konnten sich zu wahren „Wiederholungsorgien“ (Flaig, Entscheidung 121) steigern. Der Kontext spielte in diesem Augenblick keine Rolle mehr; die fragliche Passage wurde hemmungslos aktualisiert. Cicero war mächtig stolz darauf, dass ihm diese Ehre einst nach der Rückkehr aus dem Exil zuteil wurde. Das Theaterpublikum verlangte, den Vers „Tullius hatte seinen Mitbürgern die Freiheit fest gesichert“ unzählige Male zu wiederholen. Die Aussage des Stücks bezog sich auf den legendären König Servius Tullius, das Volk aber bezog sie auf „seinen“ Marcus Tullius Cicero (Sest. 123). Der Vorfall zeigte: Man hatte ihn wieder lieb. Und es gab kaum etwas, das Cicero lieber war, als dass man ihn lieb hatte …
Derartige „Usurpationen“ einzelner Verse durch das Theaterpublikum setzten sich auch in der Kaiserzeit fort. Sie gehörten sozusagen in jeder Hinsicht zum Spiel. Manche Stichwörter lösten einzelne Rufe aus, die sich rasch, mitunter von im Hintergrund agierenden „Regisseuren“ gesteuert, zu gewaltigen Sprechchören ausweiteten. Theaterdemonstrationen waren aber auch unabhängig von solchen Stichwörtern üblich, darunter auch offenkundig mit mehr oder weniger eingeübten Sprechchören vorbereitete. Das Volk forderte etwas oder lehnte etwas vehement ab. Die Historiker verwenden Standardformeln häufig im Ablativus absolutus dafür; incusante populo als Formel für die Missbilligung oder Beschwerde, flagitante populo als Formel für ein Habenwollen – offenkundig routinierter Alltag im „Gespräch“ zwischen Volk und Kaiser.
Im Prinzip kamen alle Gegenstände der jeweils aktuellen politischen und wirtschaftlichen Agenda als Inhalte von Massendemonstrationen infrage, gelegentlich auch sehr spezielle Anliegen, die etwa die Spiele selbst oder einen bestimmten Akteur des Showbusiness betrafen. Häufig wiederkehrende Forderungen betrafen (befürchtete) Versorgungskrisen und Hunger, Steuerdruck, aber auch die Lebensführung prominenter Repräsentanten der Macht einschließlich des Kaisers selbst sowie Fragen von Krieg und Frieden. „Wie lange führen wir denn noch Krieg?“, setzte das Theaterpublikum Kaiser Septimius Severus zu Beginn des 3. Jh.s unter Druck. Und: „Wie lange sollen wir all das noch hinnehmen?“ Der Historiker Dio Cassius war Ohrenzeuge dieser Demonstration. Er war überzeugt, dass göttliche Inspiration dabei im Spiel gewesen sein müsse: Wie anders ließen sich diese aus Tausenden von Kehlen gleichzeitig erschallenden Rufe erklären? (LXXVI 4, 5f.)
Wie gesagt: Hinter den Kulissen gab es durchaus Kräfte, die solche Proteste steuerten. Umgekehrt war auch der Kaiser bemüht, seine Position durch professionelle → Beifallklatscher lautstark unterstützen zu lassen. Selbstverständlich war diese „Basisdemokratie“ im Theater ausgesprochen anfällig für Manipulationen der einen wie der anderen Seite. Andererseits schaffte es auch der geschickteste Demagoge nicht, dauerhaft eine öffentliche Meinung vorzutäuschen, die von der tatsächlichen Stimmungslage der Leute abwich – zumal dem Theaterpublikum klar war, dass es nur etwas erreichen konnte, wenn es mit einer Stimme sprach. Eben das scheint bei den allermeisten Demonstrationen, ob pro oder contra, der Fall gewesen zu sein.
Auf diese Weise gelang es der Masse, im Einzelfall sogar „kulturpolitische“ Forderungen durchzusetzen. So hatte Kaiser Tiberius die berühmte Skulptur des Apoxyomenos (des „sich abschabenden“ Athleten) aus den Thermen Agrippas in seinen Palast bringen lassen. Er war in das Kunstwerk vernarrt und ließ es in seinem Schlafgemach aufstellen. Aber er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der hieß in diesem Fall Theaterpublikum. Das fand sich mit der Privatisierung der Statue nicht ab, sondern forderte ihre Restitution. Tiberius gab nach. Er beugte sich dem „Geschrei der Theaterbesucher“ (Plin. NH XXXIV 62) und gab das Kunstwerk an seinen rechtmäßigen Eigentümer – das Volk von Rom – zurück.
Ein bemerkenswert konkreter Demonstrationserfolg, und wahrhaftig nicht der einzige. Jeder Kaiser war gut beraten, wenn er den in diesen Manifestationen aufscheinenden Volkswillen ernst nahm. Vermutlich haben Demonstrationen in der Weltgeschichte selten solch einen großen und unmittelbaren Erfolg gehabt wie in der römischen Kaiserzeit. Sie waren eine vergleichsweise billige Form der Mitbestimmung, kaum mehr als ein Zipfel der Macht, den die Demonstranten da zu fassen bekamen, aber immerhin wurden sie in diesem Rahmen vielfach erfolgreich genutzt.