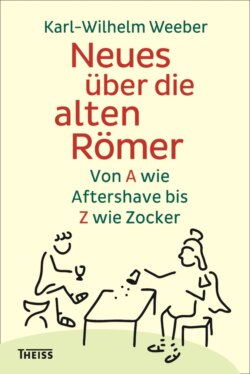Читать книгу Neues über die alten Römer - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Folter
ОглавлениеIm April des Jahres 52 v. Chr. fand in Rom ein spektakulärer Mordprozess statt. Annius Milo war angeklagt, seinen Erzfeind Clodius erschlagen zu haben. Beide waren berüchtigte Anführer von Schlägertrupps, die Rom mit ihrem Bandenterror jahrelang unsicher gemacht hatten. Cicero stellte sich Milo als Verteidiger zur Verfügung. Das überraschte wenig, denn Clodius war auch sein erbittertster Feind im politischen „Ring“ gewesen.
In seinem Plädoyer geht Cicero auch auf Zeugenaussagen von Sklaven ein, die den Angeklagten schwer belasten. Er erschüttert deren Glaubwürdigkeit: Das seien ja samt und sonders Unfreie des Anklägers Appius gewesen, die da gegen seinen Mandanten ausgesagt hätten. Die Gegenseite kann indes darauf verweisen, dass die Sklaven beim Verhör gefoltert worden seien. Das erhöhe das Vertrauen in die Zuverlässigkeit ihrer Angaben. „Was war denn das für ein Verhör?“, fragt Cicero zurück und schildert mit einigem Sarkasmus, wie er sich dieses Folterverhör vorstellt: Bringen die Sklaven Entlastendes vor, so ist ihnen die Kreuzigung sicher, weil sie ihrem Herrn in den Rücken fallen. Belasten sie Milo dagegen ordentlich, dann dürfen sie mit ihrer Freilassung aus Dankbarkeit rechnen. Mit anderen Worten: Unter Folter sagen sie eher das aus, was derjenige hören will, der sie foltern lässt – zumal wenn er sie selbst als Zeugen benannt hat (Cic. Mil. 60).
Die Passage wirft ein grelles Schlaglicht auf den Nachteil jedes peinlichen Verhörs (wenn man von dem aus heutiger Sicht menschenverachtenden Charakter des Instruments als solchem absieht): Den Römern war dieser Schwachpunkt der Zeugen- und Beschuldigtenaussage unter Zufügung körperlichen Schmerzes wohl bewusst. Aber sie wendeten die quaestio per tormenta, die „Befragung unter Folterqualen“, trotzdem mit einer gewissen Regelmäßigkeit an. „Regelmäßig“ bedeutet, dass die Folter als zulässiges, „normales“ Mittel der Wahrheitsfindung galt. Juristen warnten allerdings davor, sofort zu diesem Mittel zu greifen. Es musste zumindest eine Art Anfangsverdacht vorliegen, dass überhaupt eine Straftat begangen worden war und dass der unter Schmerzen Verhörte zur Aufklärung beitragen konnte (Dig. XLVIII 10, 1; 18, 18, 1). Wie sehr man sich in der Praxis an diesen Grundsatz gehalten hat, wie oft man tatsächlich vom Instrument der Folter Gebrauch gemacht hat, ist ganz schwer zu sagen. Ungewöhnlich war es sicher nicht, aber wohl auch nicht der tagtägliche Prozess-Standard – auch unter dem (reichlich zynischen) Gesichtspunkt, dass die Folter bei den so Verhörten bleibende Gesundheitsschäden zurücklassen konnte, die Haftungsansprüche begründeten.
Die „Selbstverständlichkeit“ der Folter-quaestio („Befragung“) bezog sich allerdings nur auf Sklaven. Deren Aussagen galten grundsätzlich als glaubwürdiger, wenn sie unter Folter (tormenta, cruciatus) zustande gekommen waren – ohne dass sie allerdings ohne Weiteres Beweiskraft gehabt hätten: Sie hatten den Rang wichtiger Indizien. Im Einzelfall konnte der zuständige Beamte anordnen, die Folter zu wiederholen. Allerdings gab es hinsichtlich der Zulässigkeit ihrer Anwendung deutliche Einschränkungen. Die wichtigste war: Aussagen gegen ihren eigenen Herrn durften von Unfreien im Normalfall nicht erzwungen werden. Ausnahmen galten nur bei Majestätsverbrechen gegen den Kaiser (crimen laesae maiestatis), die dem Hochverrat gleichkamen, bei Steuerhinterziehung und bei Ehebruch (Cod. Iust. IX 41, 1). Ferner waren bestimmte Personengruppen vor Folter geschützt: Kinder unter 14 Jahren, Schwangere, Alte, Kranke, Taube, Blinde und Stumme waren grundsätzlich ausgenommen (Dig. XXIX 5; XXXIV 9).
Freie Bürger durften in der Zeit der Republik nicht gefoltert werden. In der Kaiserzeit weichte dieses Bürgerprivileg an manchen Stellen auf. So war es gegen Räuber erlaubt, auch das Folterinstrument einzusetzen, außerdem bei Majestätsverbrechen. Dazu zählten Attentatspläne gegen den Herrscher sowie verschwörerische Aktivitäten, die auf Umsturz zielten. Mit diesem Verdacht rechtfertigte Plinius Folterverhöre gegen Christen schon im frühen 2. Jh. n. Chr. (mit Zustimmung des Kaisers: ep. X 97). In den Zeiten der Christenverfolgungen wurde häufig gefoltert; allerdings scheinen manche „Märtyrerakten“ in dieser Hinsicht zu übertreiben, um die Standhaftigkeit der christlichen „Blutzeugen“ hervorzuheben. Ob Angehörige der Oberschicht seltener einem Folterverhör unterworfen wurden als einfache Leute, wird in der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Normalerweise verfuhr das römische Rechtswesen mit sozial Stärkeren milder; vermutlich galt dieses Prinzip auch bei der Anwendung der Folter.
„Natürlich“ hatte der Herr jederzeit das Folter-„Recht“ gegenüber seinen eigenen Sklaven. Von diesem – wohl auch nicht exzessiv angewandten – Sonderfall abgesehen, wurde die Folter-Entscheidung auf Antrag eines Klägers von einem Beamten mit richterlicher Kompetenz getroffen. Er bestimmte die Modalitäten der Tortur und überwachte ihre Durchführung durch tortores, „Folterer“. Konkrete formale Abläufe der Folterung sind ebenso wenig überliefert wie bildliche Darstellungen und nähere Einzelheiten. Das übliche Folterinstrument war der eculeus („Pferdchen“), eine Streckbank, auf die die Opfer in der Horizontalen oder – seltener – der Vertikalen festgebunden wurden. Mittels Winden wurden ihre Gliedmaßen gedehnt und ausgerenkt. Verschärft wurde diese Folter durch gleichzeitiges Verbrennen von Körperteilen mithilfe von Fackeln oder glühenden Eisenklingen sowie durch Zerreißen der Haut mit Haken. Auch Ketten und Fesseln dienten als Folterwerkzeuge, indem sie den ganzen Körper oder einzelne Körperteile förmlich zusammenschnürten. Prügeln und Geißeln zählten ebenfalls zu den tormenta, gelegentlich mit Peitschen, die mit Bleikugeln beschwert waren.
Manche kaiserlichen Gerichtsherren dachten sich perverse Foltermethoden aus. So nötigte Tiberius einige Verdächtige, eine große Menge Wein zu trinken, ließ ihnen dann das Glied zuschnüren und „ihnen durch Harndrang unsägliche Folterqualen bereiten“ (Suet. Tib. 62, 2). Die Grausamkeit Kaiser Caligulas wird an vielen Beispielen geschildert, u.a. daran, „dass er, während er speiste und zechte, häufig Verhöre unter Folter vor seinen Augen durchführen ließ“ (Suet. Cal. 32, 1).
Wenn wegen angeblicher oder tatsächlicher Attentate auf den Kaiser ermittelt wurde, nahm sich manch ein in Verdacht geratener Angehöriger der Führungsschicht lieber selbst das Leben, bevor er sich einem peinlichen Verhör unterziehen ließ. Dabei spielte die Angst vor Schmerzen manchmal sogar die untergeordnete Rolle gegenüber der Schande und Würdelosigkeit, die sich mit diesem Folterverfahren verbanden. Ob die Folter tatsächlich die Menschen dazu brachte, die Wahrheit zu sagen, blieb – trotz der laufend geübten Praxis – eine theoretisch weiter intensiv diskutierte Frage. Die Gegner der Tortur argumentierten: „Erst das Foltern selbst sei der Grund, Lügen vorzubringen, weil manchen Gefolterten die Widerstandskraft das Lügen leicht, anderen aber die Schwäche das Lügen unvermeidlich macht“ (Quint. inst. or. V 4, 1). Die Menschenwürde war in der Antike allerdings kein Grund, auf die Folterung zu verzichten: Als grundsätzliches Konzept und Richtschnur war sie Griechen und Römern unbekannt.