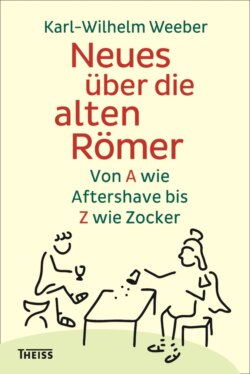Читать книгу Neues über die alten Römer - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 20
Falschgeld
Оглавление„Was halten wir nach den literarischen Wissenschaften für das schwierigste Geschäft?“, fragt der neureiche Trimalchio in Petrons Schelmenroman und gibt selbst die Antwort: „Arzt und Geldwechsler. Den Arzt, weil er weiß, was die armen Menschen in ihren Eingeweiden haben (…), und den Geldwechsler, weil er unter dem Silber das Kupfer erkennen muss“ (Petr. 56, 1ff.). Dafür bedurfte es in der Tat eines erfahrenen Spezialisten. Römische Geldfälscher mussten noch mit Metalllegierungen tricksen; Papiergeld gab es ja noch nicht. Den größten Gewinn machten sie, indem sie die Metallkerne von Gold- und Silbermünzen fälschten: Eine dünne Edelmetallschicht wurde auf eine Kupferlegierung (bei Silbermünzen) bzw. einen Bleikern (bei Goldmünzen) aufgetragen. Von der Differenz zwischen den Metallwerten ließ es sich ganz gut leben, auch wenn die Betriebskosten ziemlich hoch waren.
Allerdings war es ein riskantes kriminelles Geschäft. Auf Münzfälschung standen hohe Strafen. Wurden sie erwischt, so wurden honestiores, d.h. Angehörige der Oberschicht, auf eine Insel verbannt, humiliores, einfache Leute, wurden zur Bergwerksarbeit oder zur Kreuzigung verurteilt, Sklaven auf jeden Fall zur Todesstrafe (Paul. sent. V 25). Trotzdem war Münzfälscherei gang und gäbe; archäologisch nachgewiesen sind allerdings bisher nur zwei Fälscherwerkstätten im schweizerischen Augst und im französischen Châteaubleau.
Von Ersatzkleingeld abgesehen, das zwar nicht staatlich autorisiert, aber ohne Betrugsabsicht geprägt war und manche Provinzen zeitweise überschwemmte, ist auch „echtes“ Falschgeld in nicht geringer Stückzahl durch Bodenfunde ans Tageslicht gekommen. Bei Hortfunden – bewusst angelegten Verstecken von Ersparnissen – sind falsche Silber- und Goldmünzen aber vergleichsweise selten. Bevor der Eigentümer die wertvollen Stücke in den „Sparstrumpf“ steckte, ließ er sie offenbar vorsichtshalber auf ihre Echtheit prüfen – Arbeit für die anfangs erwähnten nummularii („Geldwechsler“), die sicher auch für gefälschte Exemplare ihr Prüfhonorar kassierten.