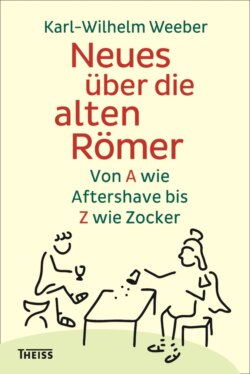Читать книгу Neues über die alten Römer - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 22
Fanartikel
ОглавлениеDas Rheinische Landesmuseum in Trier besitzt mit dem sogenannten Circusbecher ein berühmtes Exponat, das besser „Arenabecher“ heißen sollte. Denn das gläserne Gefäß zeigt neben einer Tierkämpferszene einen Gladiatorenkampf zwischen dem Netzkämpfer (retiarius) Pulcher („der Schöne“) und seinem Verfolger (secutor) namens Auriga („der Wagenlenker“). Über der kriegerischen Szene zieht sich ein lang gezogenes bibamus hin, „lasst uns trinken!“ Auf wen oder was da angestoßen werden soll, bleibt offen. Vermutlich hat es die beiden Gladiatoren tatsächlich gegeben; die Namen waren, wie es in der „Szene“ und in anderen Sparten des römischen Showbusiness üblich war, wohl eher Künstlernamen.
Haben sich nur Anhänger des Pulcher oder des Auriga für diesen Glasbecher interessiert? Vermutlich ist der Adressatenkreis für solche → Souvenirs nicht so eng zu ziehen. Sie zielten allgemein auf Fans von Gladiatorenkämpfen als Käufer. In diesem Sinn kann man derartige Ereignissouvenirs als „Fanartikel“ bezeichnen. So etwas nahm man mit nach Hause, um sich bei jedem Schlückchen Wein an sein „Hobby“ zu erinnern, oder eben auch, um seinen Gästen deutlich zu machen, dass man munera, „Gladiatorenkämpfe“, mochte. Mit dem Trinken stellten sich Erinnerungen an spannende, erlebnisreiche Stunden in der Arena ein. Trier, wo der Becher gefunden und wohl auch hergestellt wurde, verfügte über ein ansehnliches Amphitheater, das noch heute zu den touristischen Höhepunkten eines Besuchs in der Moselstadt zählt.
Stimmt es, dass …
… die Gladiatoren den Kaiser als „die dem Tod Geweihten“ grüßten?
Nein. Die viel zitierte angeblich „traditionelle“ Begrüßungsformel ave, imperator, morituri te salutant („sei gegrüßt, Kaiser, die dem Tode Geweihten grüßen dich!“) ist nur für eine einzige Gelegenheit bezeugt: eine künstliche Seeschlacht auf dem Fuciner See im Jahre 52 (Suet. Claud. 21, 6; Dio Cass. LX 33, 3) – sonst nirgendwo, auch nicht in einer anderen sprachlichen Variante. Und bei dieser einzigen Situation, in der die zum Kampf gezwungenen „Gladiatoren“ – verurteilte Verbrecher – so grüßen, atmet gleichsam alles den Geist der Ausnahme. Naumachien, künstliche Seeschlachten, fanden wegen des Riesenaufwandes nur ganz selten statt. Das Geschehen spielte sich außerhalb Roms ab, die in die Tausende gehende Zahl der Kombattanten, vor allem Ruderer, war außergewöhnlich groß, und nicht zuletzt zeigt die ungeschickte Antwort des Kaisers, dass er von dem – eben nicht üblichen – Gruß völlig überrascht wurde. Er antwortete aut non, „oder auch nicht“ – was die „Spieler“ des zynischen Kriegsspiels als Begnadigung missverstanden. Sie weigerten sich zu kämpfen. Mehr mit Gewalt als mit guten Worten brachte man die „Streikenden“ dazu, sich auf ihre Kriegsschiffe zu begeben und aufeinander loszugehen. Und wie reagierte der düpierte Spielgeber, dem seine „Spieler“ fast davongelaufen wären? „Er sprang von seinem Sitz auf, rannte in seinem hässlichen, wackelnden Gang am Ufer des Sees entlang und trieb sie zum Kampf an“ (Suet. Claud. 21, 6). Manchmal kann die Realität, die sich hinter einem berühmten Wort verbirgt, ganz schön peinlich sein – auch wenn das Wort seine Berühmtheit einer völlig verfehlten Verallgemeinerung verdankt.
Aus heutiger Sicht mutet es beklemmend oder gar abstoßend an, wenn sich jemand mit solchen in der eigenen Wohnung auf- und zur Schau gestellten Fanartikeln als Anhänger des brutalen Gladiatorenspektakels zu erkennen gab. Für Römer aber lag das im Bereich der Normalität – wie heutzutage der Fanwimpel eines bekannten Fußballclubs, den man ja auch nicht ängstlich versteckt, sondern stolz zeigt. Deshalb haben sich in vielen Ausgrabungsstätten solche Fanartikel zu Hunderten und insgesamt zu Tausenden gefunden: meist in Form von Arena-Darstellungen auf Öllämpchen, auf Keramik- und Glasprodukten, aber auch als Statuetten von Kämpfern und Szenen auf Kleinreliefs. All das konnte man in einem der Souvenirläden rings um die Arena erwerben. Meist war es „anonyme“ Massenware, die keine konkreten Namen trug, sondern sich auf Kampfszenen mit den unterschiedlichen Gladiatoren-Typen beschränkte.
Das Gleiche trifft auf die Wagenrennen zu, ebenfalls eine überaus beliebte Massenunterhaltung. Für die Anhänger des Circus-„Sports“ wurden zwar öfter personalisierte Fanartikel mit den Namen berühmter Wagenlenker und/oder Leitpferde produziert als für die „Abteilung“ Arena. Doch überwiegen auch hier die namenlosen Darstellungen, wobei Öllämpchen auch hier die führenden Bildträger sind. Das ist nicht besonders verwunderlich, waren die lucernae („Öllämpchen“) doch auch notwendige Bestandteile jedes Hausrats, die man bei Dunkelheit benötigte, um die Wohnung wenigstens etwas zu erhellen. Wenn sie zusätzlich ein bisschen „Circus-Flair“ in die eigenen vier Wände brachten – umso besser. Solche Memorabilien des Showbusiness gab es für jeden Geldbeutel in unterschiedlicher handwerklicher Qualität zu kaufen. Es waren keineswegs nur einfache Leute, die sich solchen – manch einer mag aus heutiger Sicht formulieren: – Kitsch auf den Tisch oder ins Regal stellten.
Für die Anhänger der Bühnenkunst und die (im Westen des Reiches nicht allzu zahlreichen) Fans der certamina Graeca, der griechischen Schau-Athletik mit den Schwerpunkten Ringen, Boxen und Pankration („Allkampf“), waren ähnliche Gegenstände im Angebot. Sie bildeten Theatermasken oder Bühnenszenen ab und stellten Ringer oder Pankratiasten im Kampf dar. Im Ganzen war das ein Riesenmarkt des fragwürdigen Geschmacks, der sich von den entsprechenden Angeboten moderner Souvenirläden im Prinzip kaum unterscheidet – so wenig wie sich echte Fan-Mentalität in ihrem Wesen und ihren Ausprägungen über die Jahrtausende geändert hat. Schon deshalb darf man den modernen Begriff „Fan“ durchaus auf die Antike „verlängern“.
Ein zweiter Grund kommt hinzu: Der englische fan ist keine angelsächsische Wortschöpfung, sondern ein aus dem Lateinischen abgeleiteter Begriff. Das „Original“ heißt fanaticus. Darunter verstanden die Römer einen „begeisterten“, „schwärmerischen“ Menschen, der sich in bestimmten Situationen am Rande des Wahnsinns bewegte. Die leidenschaftlichen Anhänger von Wagenrennen, Theateraufführungen und Gladiatoren-Shows nannte man so zwar nicht – sie heißen auf Latein studiosi oder fautores –, aber von deren „verrücktem“ Verhalten her hätte auch fanatici gepasst. Nicht zuletzt, weil viele ihr mühsam verdientes Geld auch in Fanartikel investierten.