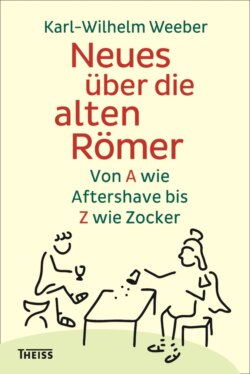Читать книгу Neues über die alten Römer - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 21
Familienessen
ОглавлениеMindestens einmal am Tag sollte die Familie eine Mahlzeit gemeinsam einnehmen und sich auf diese Weise auch ihrer Gruppenidentität versichern. So entspricht es der normalen bürgerlichen Vorstellung in der modernen westlichen Welt – nicht immer zur Freude von Kindern und Jugendlichen, die sich diesem „Zwang“ nicht unterwerfen möchten, weil sie oft schneller fertig sind als die Erwachsenen oder weil sie Gleichaltrige als „Tischgenossen“ vorzögen. Solche „Skeptiker“ gegenüber gemeinsamen Mahlzeiten im Familienkreis hätten sich in Oberschichtfamilien im Alten Rom wohlgefühlt.
Denn da gab es diese mehr oder minder eherne Regel nicht. Wie es in den Haushalten der einfachen Leute zuging, wissen wir mangels einschlägiger Quellen nicht. Bei der gesellschaftlichen Elite aber war das gemütliche Essen im Familienkreis eher die Ausnahme als die Regel. Die Kinder verließen das Haus morgens schon sehr zeitig, weil die Schule notorisch früh anfing (Mart. IX 68; Ov. am. I 13, 1ff.; Juv. VII 222f.). Sklaven und Pädagogen kümmerten sich darum, dass sie rechtzeitig aufstanden und frühstückten (Herm. Pseudodosith. Coll. Monacens. 2). Manche Schulkinder holten sich beim Bäcker ein schnelles „Frühstück“ auf die Hand (Mart. XIV 223). Das prandium als Mittags-Lunch war eher eine zügige Nahrungsaufnahme als ein in Ruhe eingenommenes Mahl.
Für ein gemeinsames Essen im Familienkreis hätte sich daher am ehesten die cena als Hauptmahlzeit am Nachmittag angeboten. Die Entscheidung darüber, in welchem Rahmen sie stattfand, traf der Vater. Im Normalfall war es ihm wichtiger, mit Bekannten und Freunden zu speisen und sie zu einem mehr oder minder förmlichen convivium, „Gastmahl“, einzuladen. Das diente der gesellschaftlichen Kontaktpflege und Selbstdarstellung. Auch erhielt der Hausherr oft Einladungen und speiste auswärts.
Diesen gesellschaftlichen Verpflichtungen wurde das, was man heute Familienleben nennen würde, konsequent untergeordnet, sodass Ehefrau und Kinder eher selten mit dem pater familias zusammen speisten. Seit der späten Republik wurde es allerdings üblicher, dass Ehefrauen und männliche Kinder gelegentlich an den Gastmählern im eigenen Haus teilnahmen. Das war nicht der Regelfall, verstieß aber nicht mehr gegen die guten Sitten. Eine Inschrift in einem Speisesaal in Pompeji fordert die Gäste auf, „lüsterne Mienen und verführerische Blicke von der Ehefrau eines anderen fernzuhalten“ (CIL IV 7698b). Das mag als Indiz für eine gewisse Normalität gewertet werden, dass nicht nur „Unterhalterinnen“ beim Gastmahl dabei waren. Auch war es seit augusteischer Zeit nicht mehr anstößig, dass Ehefrauen auf dem Speisesofa lagen. In früheren Zeiten hatten sie auf Sesseln zu sitzen (Val. Max. II 1, 2; Isid. Orig. XX 11, 9).
Diese neue Gemütlichkeit kam allerdings für Kinder und Jugendliche nicht infrage, wenn der Vater sie ausnahmsweise zu einem Gastmahl hinzunahm. Sie saßen hinter dem Speisesofa des Vaters (bzw. Großvaters; vgl. Suet. Aug. 64) oder auf den Sofaenden (fulcra; Suet. Claud. 32). Mitunter setzte man mehrere Kinder an einen separaten Tisch und servierte ihnen weniger aufwendige Speisen (Tac. ann. XIII 16, 1) – eine Diskriminierung, die mitunter auch anderen Angehörigen gesellschaftlich weniger anerkannter Gruppen unter den Gästen widerfuhr und die durchaus zur römischen Klassengesellschaft passte (Plin. ep. II 6; Mart. I 20, XII 27). Die Distanz, die damit im räumlichen wie im übertragenen Sinn zu den Kindern aufgebaut wurde, war sichtbarer Ausdruck der Tatsache, dass sie (noch) nicht zum Kreis der voll berechtigten Tischgenossen zählten.
Der wesentliche Grund dafür, halbwüchsige Söhne zum convivium mitzunehmen, war der Wunsch, sie in die gesellschaftliche Etikette einzuführen. Sie sollten den „Großen“ zuschauen und lernen, wie man sich in der „besseren Gesellschaft“ verhielt, worüber man plauderte, welche Punkte es beim gestus edendi, den „Tischsitten“ (Ov. ars am. III 755), zu beachten galt. Dazu gehörten: Hände, Kinn und Wangen beim Essen sauber zu halten, nur zu kleinen Bissen zu greifen, nicht gleichzeitig zu essen und zu trinken, langsam zu trinken, die Sklaven zu rufen und sie nicht herbeizupfeifen oder mit den Fingern zu schnippen, nicht zu spucken und zu husten, nicht laut zu rülpsen, sondern allenfalls mit geschlossenem Mund aufzustoßen, den Becher nicht mit einem einzigen Zug zu leeren, nicht gierig nach dem Essen zu greifen, sondern zu warten, bis man an der Reihe war (Clem. Alex. Paed. II 13; 31; 55; 60) – und sich im Ganzen bescheiden, höflich und still zu verhalten und den Aufforderungen der insoweit erziehungsberechtigten Bediensklaven zu folgen.
Ansonsten konnte der Heranwachsende nur hoffen, dass sein Vater ihm keine Rolle in der Unterhaltung seiner Gäste zugedacht hatte oder plante, ihnen die schulischen Fortschritte seines Sprösslings stolz zu präsentieren. Der Satiriker Persius erinnert sich jedenfalls, wie er sich als Knabe Öl ins Auge zu träufeln pflegte, „wenn ich keine Lust hatte, die schwülstigen Reden des sterbenden Cato (…) zu lernen, damit sie mein vor Aufregung schwitzender Vater vor eingeladenen Gästen vernähme“ (III 44ff.). Zumindest das dürften heutige Jugendliche ihren römischen Leidensgenossen nachfühlen können.