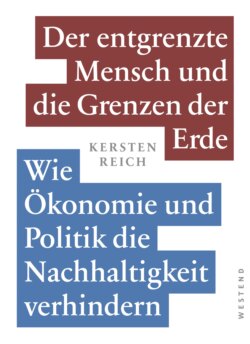Читать книгу Der entgrenzte Mensch und die Grenzen der Erde Band 2 - Kersten Reich - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеIm ersten Band1 ging es vor allem darum, die wichtigsten Herausforderungen der Nachhaltigkeit in einer Übersicht und Zusammenfassung darzustellen und sie mit Vorstellungen und Denkweisen zu kontrastieren, die in der Geschichte entstanden sind und bis heute fortwirken. Dies sollte helfen, genauer ausloten zu können, inwieweit Menschen heute in der Lage sind, ihr Verhalten an die Erfordernisse der Nachhaltigkeit anzupassen. Dabei hatte ich mich auf den Verhaltens- und Erziehungsbereich konzentriert, um Chancen und Hindernisse zu analysieren, die bezüglich der Nachhaltigkeit bestehen. Im vorliegenden zweiten Band wende ich mich der Frage zu, warum Ökonomie und Politik es als Rahmenbedingungen des Handelns sogar verhindern können, dass die Menschheit national oder international die notwendigen Ziele – etwa im Klimawandel bei den Treibhausgasen, in der Müllvermeidung und Verseuchung des Wassers und der Meere, bei der Vernichtung von Ressourcen – erreichen kann, die ihr eine umfassende Forschung über die globalen Grenzen als notwendige Handlungsbereiche aufgegeben hat.
Dieser Band beschäftigt sich insbesondere mit den Bedingungen, die durch ökonomische Strukturen und Prozesse auf die Gesellschaft und die Individuen wirken und die zugleich auch stark das Handeln und den Spielraum der Politik bestimmen. Mir scheint es besonders wichtig, dabei erstens die ökonomischen Grundlagen insoweit zu analysieren, wie sie bestimmend auch auf die Nachhaltigkeit Einfluss nehmen, und zu erörtern, inwieweit hier überhaupt Veränderungsspielräume gegeben sind. Zweitens will ich die politischen Bedingungen zum Ausgangspunkt nehmen, um kritisch einschätzen zu können, wie weitreichend die Nachhaltigkeitsfallen das politische Handeln gegenwärtig überhaupt erreichen und eine neue Politik auslösen können. Als Konsequenz aus diesen Analysen will ich sowohl auf zukünftige Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums als auch auf Grenzen der bisherigen demokratisch-institutionellen Vorgehensweisen verweisen, die ein radikales Umdenken und Umsteuern erfordern, wenn Nachhaltigkeit hinreichend gelingen soll. Abschließend will ich im Schlussteil des Buches erörtern, welche Wege aus den Nachhaltigkeitsfallen möglich sind und zu welchen Regeln dies in der Nachhaltigkeit führen müsste.
Nachhaltigkeitsfallen, das sind, so hatte ich schon im ersten Band ausgeführt, Fallen, die dadurch entstehen, dass wir als Menschen in einen Konflikt mit unseren Vorstellungen und Theorien, unseren Wünschen und unserem Begehren in Bezug zu den nicht erkannten Folgen unserer Handlungen geraten, oft dadurch, dass wir das, was wir wünschen, bereits für die Wirklichkeit halten. Die meisten Menschen befürworten heute Nachhaltigkeit, weil und insofern sie informiert sind, dass beispielsweise der Klimawandel auch ihr Wohlbefinden in Zukunft stark gefährden wird. Sie wären sogar bereit, sich für begrenzte Aspekte der Nachhaltigkeit einzusetzen, aber im praktischen Leben gibt es eben auch andere Erwartungen, Wünsche und Gewohnheiten, die solchem Einsatz im Wege stehen. Das sind Konsumerwartungen, die nicht aufgeschoben werden sollen, Reisewünsche, die Freiheit ausdrücken, und viele andere mehr. Wenn diese mit der Nachhaltigkeit im Konflikt stehen, der vielfach dann noch nicht einmal offensichtlich und für alle erkennbar ist, dann entsteht eine Falle, das alte Verhalten zu bevorzugen und Veränderungen nach hinten zu schieben, wodurch aber letztlich das Überleben in Zukunft gefährdet wird.
Ein Beispiel, das ich schon im letzten Band herangezogen habe: Ich weiß, dass mein Auto CO2 ausstößt und dass dies für das Klima schädlich ist. Aber das Auto ist mir wichtig, es repräsentiert für mich Freiheit, Mobilität, sozialen Status, ich benötige es, um zur Arbeit zu kommen, weil alle anderen auch Auto fahren und der Nahverkehr eingeschränkt wurde. Und schwieriger noch: Ich lebe in einem Land, das sehr viele Autos produziert, in dem viele Arbeitsplätze und die Wirtschaftskraft von dieser Produktion abhängen, sodass ich sogar meinen Wohlstand riskiere, wenn ich auf das Auto verzichten würde. Hier wird die Falle konkret sichtbar.
Eine große, vielleicht die größte Nachhaltigkeitsfalle, besteht für mich heute darin, dass wir es ökonomisch und politisch schaffen, uns bereits glücklich und zufrieden zu wähnen, und deshalb meinen, uns nicht wirklich umfassend ändern zu müssen. Die Zufriedenheitsstudien, die dies messen, orientieren sich am erreichten Stand, so wie wir es auch in den meisten Selbstbeschreibungen tun, aber es fehlt dabei meist der kritische Blick auf das, was der Überfluss, in dem wir leben, für die Zukunft bedeuten wird. Wir können bei genauerem Hinsehen aber sehr genau wissen, dass wir uns in einer Umweltkrise befinden, dass wir trotzdem Ressourcen verschwenden und nachlässig gegenüber den Überlebenschancen in der Zukunft operieren, aber sehr viele Menschen glauben zugleich, dass es nie so schlimm kommen wird, wie es uns wissenschaftliche Forschungen vorhersagen.
Teil I dieses Bandes beschäftigt sich damit, warum und wie die Ökonomie bisher die Nachhaltigkeit verhindert. Dabei geht es darum, wie aus der Vergangenheit heraus Nachhaltigkeitsfallen entstanden sind und warum es kaum Auswege aus diesen gibt. Die kapitalistische Ökonomie, in der wir alle arbeiten und leben, setzt auf Gewinne, die aus allen Beschäftigungen und Handlungen entspringen sollen, aber sie scheut bisher überwiegend die Kosten der Nachhaltigkeit, weil sie Gewinne schmälern. Die Menschheit hat sich in diesem System in einem Spannungsfeld von Wohlstand und Luxus oder Hunger und Ausbeutung schon lange eingerichtet, aber je mehr Mehrheiten diesem Weg weiter ungebremst in allen Ekstasen des Konsums und der Mobilität folgen, je mehr sie dabei weiter auf Gewinnmaximierung und nicht Fürsorge für Menschen und die Umwelt setzen, desto stärker wachsen die Kosten und Nachteile für jene an, die nach uns kommen. Wahrscheinlicher ist es sogar, dass bereits wir die negativen Folgen eines gedankenlosen Handelns massiv spüren werden. Ich will möglichst umfassend an der Breite der kapitalistischen Entwicklung von der Moderne bis in die Gegenwart zeigen, in welche Nachhaltigkeitsfallen wir uns begeben haben und warum die Ökonomie eine so zentrale Dimension darstellt.
Zunächst wird in einem ersten Schritt verdeutlicht, dass die Nachhaltigkeit noch nie im Fokus der kapitalistischen Arbeits- und Produktionswelt stand. Im Gegenteil, die soziale Seite der Nachhaltigkeit musste in unendlichen Arbeitskämpfen immer erst erstritten werden, um das Überleben der Arbeitenden im kapitalistischen System zu sichern. Aus diesen Kämpfen erst sind Wohlstand und ein gewisser Überfluss bei breiten Massen entstanden, aber das Problem der sozialen Gerechtigkeit und einer steten Umverteilung des Reichtums auf wenige Reiche ist geblieben. Für die planetare Nachhaltigkeit sind dies denkbar ungünstige Voraussetzungen, denn der Kampf für mehr soziale Gerechtigkeit, der in einem zweiten Schritt diskutiert wird, beherrscht immer noch den Kapitalismus, der Platz der Nachhaltigkeit geht dabei schnell verloren.
Im Folgenden wird erörtert, wie sich die schwere Moderne, der solide Kapitalismus mit seiner Industrialisierung, bis heute verflüssigt hat. Die Verflüssigung hat das ökonomische Leben flexibler, dynamischer und mobiler, aber auch unsicherer im Blick auf die eigenen Erwartungen gemacht. Der Konsum beherrscht das Zeitalter, und er ist zugleich Ausdruck dafür, die planetaren Grenzen in jeder Hinsicht zu überschreiten. Dies geht soweit, dass auch die Nachhaltigkeit selbst kapitalisiert wird, die Urheber von Schäden unsichtbar gemacht werden oder sich unsichtbar machen, die Gewinne ständig steigen und die Ausgaben für die Nachhaltigkeit im Verhältnis bescheiden bleiben. Nachhaltigkeit soll konform mit der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung gehen, dies ist Wunsch und Programm der Nationen und auch der Nachhaltigkeitsagenda der UN und der global goals. Immer mehr wird erkennbar, dass dies ein Widerspruch ist, weil jedes Wachstum im steigenden Wohlstand und Überfluss eine neue Herausforderung für die planetaren Grenzen setzt.
Teil II widmet sich der Politik, die meist im Einklang mit der Ökonomie die Nachhaltigkeit verhindert. Hierbei analysiere ich vor allem drei thematische Bereiche: Zu Beginn diskutiere ich kurz das politische Erbe fehlender Nachhaltigkeit. Der Politik fehlt in Fragen der Nachhaltigkeit ein umfassender Wille zur Wahrheit, um den Wahrscheinlichkeitsaussagen der Wissenschaft hinreichend Glauben zu schenken. Parteien in repräsentativen Demokratien wollen ihre Wählerinnen nicht verschrecken und ihre Wähler2 nicht verlieren, sie belügen sich und andere um der kurzfristigen Wahlgewinne willen und verschweigen notwendige Einschnitte und Verzicht im Verhalten. Aber die Wahrheit in der Anerkennung der Wahrscheinlichkeit der vorliegenden Forschungsergebnisse kommt auch dann an ihre Grenzen, wenn die Masse der Wahlberechtigten nicht auf einen Lebensstil mit großem Fußabdruck verzichten will.
Daraufhin wende ich mich dem politischen Kampf um Wahrheit in der Nachhaltigkeit zu. Dies ist eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen politischen Verhältnisse, soweit sie insbesondere für die Nachhaltigkeit relevant sind. Dabei will ich sowohl politische Faktoren fehlender Nachhaltigkeit herausstellen, aber auch das Zusammenwirken von Ökonomie, Politik und Lebensweise zwischen nationalen und globalen Herausforderungen diskutieren. In der Politik mischen sich die Kämpfe um mehr soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ständig, aber eine nachhaltige Politik wird sich entscheiden müssen, wird Prioritäten setzen müssen. Hierbei ist die Globalisierung Antreiber etwa des Klimawandels, aber auch ein Krisenantreiber für die zunehmende Zahl an Menschen, die als Verlierer aus der fehlenden Nachhaltigkeit hervorgehen. Zunehmende soziale Ungerechtigkeit, Vertreibung, Flucht und Migration sind Ausdrücke hiervon, die zugleich mit politischen Folgewirklungen wie dem Populismus oder der Leugnung der Notwendigkeit von Nachhaltigkeit verbunden sind.
Abschließend diskutiere ich das Spannungsverhältnis der Sehnsüchte vieler Menschen nach immer mehr Wohlstand gegenüber den Verpflichtungen, die Menschen untereinander und in den planetaren Grenzen des Wachstums haben. Bei zunehmender Sehnsucht nach Freiheit und Individualismus im gegenwärtigen Kapitalismus entsteht die Frage, welche Autorität den Menschen überhaupt die Notwendigkeit der Nachhaltigkeit klarmachen und dann auch noch durchsetzen soll. Zwar mögen viele Menschen aus Einsicht nachhaltig handeln wollen, aber wie viele werden es am Ende sein? Wer kontrolliert dann jene, die auf Kosten aller schädliche Wirkungen erzeugen und daraus sogar Gewinne auf den Märkten ziehen? Bisher haben Gesellschaftsverträge aus Einsicht und Vernunft nur gewirkt, wenn sie mit Herrschaftsformen verbunden wurden. Aber welche Art der Herrschaft, der Autorität oder der Rechtsstaatlichkeit kann und will man sich bei notwendigem Verzicht noch leisten? Ich will deutlich machen, warum und inwieweit der autoritäre Charakter der Vergangenheit heute immer noch eine Relevanz hat. Dabei will ich erörtern, inwieweit im heutigen Kapitalismus dieser selbst zu einer Autorität, zu einer sachlichen und institutionellen Bedingung geworden ist, die für Menschen sehr intransparent wirkt und damit zu allerlei Verschwörungstheorien herausfordert.
Hier ist es einerseits schon interessant, dass der gegenwärtige Populismus in all seinen Facetten sowohl einen autoritären Charakter favorisiert als auch Nachhaltigkeit ablehnt. Populisten und menschliche Ignoranz sind wichtige Kräfte geworden, die die Wahrscheinlichkeit nachhaltiger Fakten vergessen machen. Die Populisten bedienen ihre eigene Macht und Großartigkeit, sie nehmen es weder mit der Wahrheit noch den Fakten genau, betonen aber die Wünsche und das Vergessen. Die breite Ignoranz gegenüber der Nachhaltigkeit besteht darin, dass es keine Verpflichtungen zum Handeln, aber viele Wünsche zum Mitreden gibt. Wenn alle mitreden, ganz gleich wie ahnungslos sie sein mögen, und dann auch noch von ebenso ahnungslosen Populisten angetrieben werden, dann wird die Kurzsichtigkeit im Wissen und die Dummheit im Handeln zum Beschleunigungsfaktor in jeder Krise.
Aber andererseits ist die Naivität, mit der der gegenwärtige Kapitalismus in seinen meist unsichtbaren autoritären und institutionellen Formen hingenommen wird, auch eine Vorbedingung dafür, dass Nachhaltigkeit wenig gelingt, denn je weniger die Menschen das autoritäre System durchschauen, desto weniger werden sie auch Handlungschancen erkennen, wie sich die Dinge ändern lassen.
In den politischen Einstellungen vieler Menschen gibt es heute viele Widersprüche, die von einem Wunsch nach mehr Freiheit, Individualisierung und Konsum auf der einen Seite, aber zugleich von einem Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung der persönlichen Lebenslage auf der anderen Seite getragen sind. Wie kann bei einer gleichzeitigen Abnahme der Bereitwilligkeit, Verpflichtungen zu übernehmen, die Freiheitsansprüche einschränken, Nachhaltigkeit überhaupt gelingen? Es kommt für mich darauf an, diese und weitere Fragen zu einer Politik der Nachhaltigkeit vor den größeren Problemlagen eines unsichtbar gewordenen autoritären Kapitalismus, vor einer stets wirkenden institutionalisierten Autorität zu erörtern. Der entgrenzte Mensch lebt dabei in den Entgrenzungen des Kapitalismus, aber die Grundpfeiler des kapitalistischen Systems mit seiner ständigen Suche nach Gewinnmaximierung kollidieren mit den Grenzen der Erde.
Teil III fokussiert auf zwei Grenzen, die sich im menschlichen Handeln als Konsequenz aus der vorliegenden Analyse ergeben:
Erstens gibt es sehr klare Grenzen des Wachstums. Allen müsste klar sein, dass die Menschheit nicht immer einfach so weitermachen kann wie bisher. Handlungen, die nicht nachhaltig oder gar für die Nachhaltigkeit schädlich sind, müssten bestraft werden. Insbesondere eine Bepreisung solcher Handlungen erscheint notwendig. Entweder ein Abbau des Wachstums (degrowth) oder eine ökologische Transformation bei Produktion und Konsumtion, dies wären notwendige und sinnvolle Wege.
Zweitens aber werden sowohl Begrenzungen des Wachstums als auch Transformationen die Demokratie an ihre Grenzen bringen. Eine Demokratie mit Mehrheits- und Verhältniswahlrechten ist solange gut, wie es darum geht, einen ständigen Fortschritt zum Wohl möglichst vieler, wenn auch nicht gleichermaßen aller, zu verwalten; sie wird sofort problematisch, wenn es um Abbau bestehenden Überflusses, um Begrenzung und Verzicht geht. Bisher ist die Wohlstandszunahme in den Demokratien der größte Garant dafür, dass diese Systeme nicht durch einen Aufstand der Bevölkerung überwunden werden. In allen Nationalstaaten wird der Wechsel in die Nachhaltigkeit für große Verstörungen sorgen, weil im Verzicht die bisher ungelösten sozialen Ungerechtigkeiten deutlicher hervortreten werden. Der ständig auf solche Verstörungen lauernde Populismus kann schnell allen Nachhaltigkeitsbemühungen den nationalen Todesstoß versetzen. Begleitet wird diese Verstörung und Unfähigkeit, sich der Nachhaltigkeit zu stellen, vor allem auch durch den Kampf der Nationen gegeneinander, den viele schon für überwunden gehalten haben. Auch wenn die Nachhaltigkeit in internationalen Gremien der UN anerkannt ist und verfolgt wird, so zeigt die Praxis und Wirkung dieser Institutionen das ganze Ausmaß des bisherigen Scheiterns. Die internationale Politik, wie sie sich national rückspiegelt, ist ein entscheidender Risikofaktor für die Nachhaltigkeit, weil im Vergleich untereinander jeder selbst noch im Verzicht gewinnen will. Aber in der Nachhaltigkeit geht es nicht mehr ums Gewinnen, sondern um eine gemeinsame Lösung, die für alle eine Abkehr von vertrauten Wegen bedeutet.
Als ein Ausweg zumindest im Nationalen erscheint die Bürokratie, die über die Interessensgegensätze hinweg einen scheinbar neutralen Weg weisen könnte, um die Nachhaltigkeit in Gesetzen und Verordnungen durchzusetzen, sie dann aber auch hinreichend im Erfolg zu kontrollieren. In der Politik wird heute sehr umfassend auf die Bürokratie gesetzt, die stets als ausführendes Organ der politisch bestimmten Wege gilt. In einem Exkurs in die Bürokratieforschung will ich verdeutlichen, dass Bürokratien zwar als institutionelle Autorität auch in der Nachhaltigkeit notwendig sind, aber ihrerseits die Lösungen dann verschlechtern, wenn sie so wie bisher arbeiten. Überregulierungen und Bürokratien sind Abkömmlinge der Moderne, die das Leben sicherer und gerechter machen sollten, aber letztlich dabei immer vorherrschende Praktiken und bestehende Ungerechtigkeiten abbilden. Sie folgen einem langsamen Gang, weil bei unterschiedlichen Auffassungen alle Parteien gehört und mehr oder minder geeignete Kompromisse gefunden werden müssen. Bis zum Katastrophenfall bieten solche Regulierungen und Bürokratien eine Garantie dafür, dass wir handlungsunfähig bleiben. Sie sind nicht für Krisen, sondern für Stabilisierungen auf einem erreichten Stand gemacht. Es soll deutlich werden, dass sich Nachhaltigkeit nicht wesentlich bürokratisch befördern lässt, sondern einen umfassenderen Ansatz benötigt.
In Teil IV wende ich mich möglichen Wegen aus den Nachhaltigkeitsfallen zu. Als ich mit diesem Forschungsprojekt begonnen habe, war ich voller Hoffnungen, sehr viele Wege zu finden und als realistisch nachweisen zu können. Im Laufe meiner Auseinandersetzungen hat sich aber herausgestellt, dass es ohne eine grundlegende Änderung der Ökonomie und Politik kaum Chancen für eine wirkliche Veränderung gibt.
Ich nehme hier die Idee noch einmal auf, dass die möglichen Lösungsansätze vielen zwar noch als unendlich groß erscheinen, diese aber – so vielfältig sie auch im individuellen Fall sein mögen – konzentriert und schnell im großen Maßstab werden erfolgen müssen, um nicht zu spät zu kommen. Die biologische Evolution hat es dem Menschen ermöglicht, eine kulturelle Geschichte zu errichten, die das gesamt Bild der Erde im Anthropozän prägt. An der heutigen Position angekommen, stellt sich die Frage, inwieweit die menschliche Vernunft, die sich in so vielen Bereichen des Fortschritts bewährt hat, ausreichen wird, die nahenden Katastrophen zu erkennen und Wege aus diesen zu suchen. Die aktuelle Forschung zur Wirkung von Risiken und Katastrophen auf das menschliche Verhalten mag im Einzelfall Hoffnung geben, dass sich Menschen neuen Herausforderungen schnell anpassen können, aber wenn diese dann mit deren Emotionen, Wünschen und Lebensstilen zusammentreffen, schwinden solche Hoffnungen schnell. Die Leserinnen und Leser mögen für sich beurteilen, inwieweit die zusammengetragenen Forschungen sie eher beruhigen oder beunruhigen.
Im ersten Band habe ich zum Schluss klare Forderungen an das individuelle Verhalten gestellt. Jede und jeder muss bei sich selbst anfangen, denn Nachhaltigkeit kann insbesondere in demokratischen Ländern nicht einfach verordnet und instruiert werden, sondern bedarf der individuellen Überzeugung und motivierten Handlung. Alle müssen sich Gedanken darüber machen, was gut funktioniert und was weniger gut gelingen wird. In diesem Sinne wird Nachhaltigkeit zu einer ersten Bildungspflicht, denn nur diejenigen, die wissen, was sie tun, werden auch bereit sein, ihr Tun zu überdenken und zu verändern.
Für die Ökonomie und Politik ist ebenso klar: Die große ökologische und nachhaltige Transformation wird nicht ohne Verzicht zu machen sein. Sie kann in begrenztem Maße durch Innovationen und neue Lebenskonzepte kompensiert werden, sie kann sogar die Menschheit sozial gerechter machen und sich vielfältig in neue Richtungen entwickeln lassen, aber sie bedeutet eine wesentliche Umstellung in sehr vielen Lebensbereichen. Eckpunkte hierfür will ich mit diesem Band bewusst machen.
Abschließend werden gesellschaftliche Regeln zur Nachhaltigkeit aufgestellt, auf die sich nicht nur einzelne Menschen, nicht nur einzelne Nationen, sondern die gesamte Menschheit im Sinne eines Nachhaltigkeitsvertrages einlassen müssten, um der gegenwärtigen Krise etwas entgegenzusetzen. Zusammen mit den individuellen Regeln aus dem ersten Band fassen sie in kurzer Form das zusammen, was sich aus der Vielzahl wissenschaftlicher Forschungen als essenziell zusammenfassen lässt: ein Manifest der Nachhaltigkeit.
Mein Dank gilt den vielen Forscherinnen und Forschern, die mir ihre Veröffentlichungen frei zugänglich gemacht haben. Die umfangreichen Referenzen finden sich im Literaturverzeichnis für beide Bände, das mit Links zu zugänglichen Quellen online unter www.westendverlag.de/nachhaltigkeit verfügbar ist. Es sind zu viele, die mich in meinem Vorhaben unterstützt haben, um sie hier einzeln zu nennen. Hervorheben will ich die Lektorin Lea Mara Eßer vom Westend Verlag, die durch ihre professionelle Überarbeitung zur Verbesserung des Textes beigetragen hat.