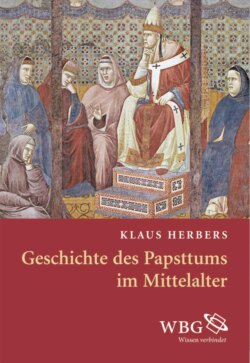Читать книгу Geschichte des Papsttums im Mittelalter - Klaus Herbers - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weltliche und geistliche Herrschaft und die Unantastbarkeit des ersten Sitzes – Standortbestimmungen an der Wende zum 6. Jahrhundert
ОглавлениеDie wechselhafte politische Situation seit dem ausgehenden 5. Jahrhundert eröffnete Spielräume, so dass manche Päpste teilweise an die schon skizzierten programmatischen Positionen Leos I. anknüpfen konnten. Mit Felix III. (483–492) gelangte erstmals ein Vertreter des senatorischen Adels auf die Cathedra Petri. Der anschließende Pontifikat Gelasius’ I. bedeutete eine Abrundung des „leoninischen Zeitalters“. Gelasius formulierte schon als Sekretär Felix’ III., dann während des eigenen Pontifikates einige wichtige Schreiben und steckte päpstliche Positionen gegenüber den Vorstellungen der oströmischen Kaiser ab. Gelasius verfocht die Idee eines Papsttums als Monarchie: Kaiser und Papst seien für die Regierung der Welt – und damit meinte er das Römische Reich – in unterschiedlicher Weise verantwortlich. In seiner „Zweigewaltenlehre“ skizzierte der Papst 494, was den jeweiligen Vertretern obliege. Der Papst besitze die auctoritas, die dazu noch geheiligt (sacrata) sei, dem Kaiser obliege es hingegen, durch kaiserliches Gesetz in geistlichen Angelegenheiten durchzusetzen, was die Autorität der Priester vorschreibe. Seine Konzeption dieses Verhältnisses basierte auf der Grundidee, dass Herrschaft als Gabe Gottes „arbeitsteilig“ funktionieren solle. Weil der König oder Kaiser aber ein Glied der Kirche war, stand er zugleich unter der päpstlichen Herrschaft. Obwohl beide Gewalten nebeneinander rangierten, komme der Autorität der Bischöfe das größere Gewicht zu. In den zentralen Sätzen geht es um eine Unterscheidung der auctoritas sacrata pontificum von der regalis potestas:
Zwei sind es nämlich, erhabener Kaiser, durch die an oberster Stelle diese Welt regiert wird: die geheiligte Auktorität (auctoritas) der Bischöfe und die kaiserliche Gewalt (potestas). Von diesen beiden ist die Last der Priester um so schwerer, als sie auch selbst für die Könige der Menschen vor Gottes Gericht Rechnung abzulegen haben. Denn Du weißt es, allergnädigster Sohn, daß Du an Würde zwar das ganze Menschengeschlecht überragst, daß Du dennoch aber vor den Amtswaltern der göttlichen Dinge demütig den Nacken beugst und von ihnen die Mittel zum Seelenheil erwartest. Daran erkennst Du, daß beim Empfang der himmlischen Sakramente […] eher der demütig Nehmende als der Befehlende bist. In diesen Dingen bist Du demnach vom Urteil der Priester abhängig und darfst sie nicht Deinem Willen unterjochen wollen. Wenn nämlich die Bischöfe im staatsrechtlichen Bereiche gerne anerkennen, daß Dir die kaiserliche Macht durch göttliche Anordnung übertragen ist und daß sie deshalb Deinen Gesetzen Gehorsam zu leisten haben, wie muß man dann um so williger denen gehorsam sein, die zur Ausspendung der ehrwürdigen Mysterien bestellt sind! […] Und wenn sich die Gläubigen schon allen Priestern insgesamt innerlich unterwerfen müssen, um wie viel mehr ist dann dem Bischof jenes Stuhles Zustimmung zu leisten, den der höchste Gott selbst über alle Priester gestellt sehen wollte und den seitdem die Gesamtkirche immerdar mit kindlicher Hingabe verehrt hat.7
Anlass zur Formulierung dieser Theorie war die Stellungnahme gegenüber Kaiser Anastasios I. (491–518) in einem Schisma. Obwohl in einer konkreten Situation entstanden, wurden die Kernaussagen später in Rechtssammlungen überliefert und seit der Zeit des „Investiturstreits“ weiter zugespitzt (Zweischwerterlehre, vgl. Lukasevangelium 22, 38 und unten Kapitel VII, S. 161). Solche Sammlungen von Rechtssätzen (Dekretalen und Kanones) entstanden in Rom seit der Zeit Papst Gelasius’ I. Besonders einflussreich wurde diejenige des skythischen Mönches Dionysius Exiguus, der unter Papst Symmachus (498–514) Dekretalen unter systematischen Aspekten zusammenstellte. Seit dem 8. Jahrhundert spielte die als „Dionysiana“ (oder „Dionysio-Hadriana“) bezeichnete Sammlung für das kirchliche Dekretalenrecht eine entscheidende Rolle.8
Gelasius zugeschrieben wird das wohl erst aus der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts stammende Decretum Gelasianum, das indirekt den Vorrang des Apostels Petrus auf eine neue Weise weiter konturiert, indem es von den fünf Patriarchensitzen drei hervorhebt, die mit dem Apostel Petrus in besonderer Verbindung gestanden haben sollen: „So ist also die römische Gemeinde der erste Sitz des Apostels Petrus, sie, die keine Makel noch Runzeln noch dergleichen hat. Der zweite Sitz ist zu Alexandrien im Namen des seligen Petrus von seinem Schüler, dem Evangelisten Markus, geweiht worden; […] der dritte Sitz desselben seligen Apostels Petrus wird zu Antiochien in Ehren gehalten, weil er dort weilte, bevor er nach Rom kam.“9
Unter einem Patriarchat verstand man in frühbyzantinischer Zeit – etwa ab dem 6. Jahrhundert – den Sitz eines Patriarchen, der mehreren Diözesen vorstand, und ein zugehöriges Territorium, das später im Osten in der Regel ein von Byzanz unabhängiges Reich darstellte (zum Beispiel Bulgarien). Erste Ansätze gab es seit dem 3. Jahrhundert in Ägypten, wo der Bischof in Alexandria den anderen Bischöfen Ägyptens und Libyens übergeordnet schien. In Antiochia waren die Bischöfe von Syrien, Palästina und Kappadokien zusammengefasst. Hier tagten schon im 3. Jahrhundert Synoden.
Rom stand grundsätzlich den Bischöfen Italiens vor. Die Konzilien von Nizäa (325) und Konstantinopel (381) gestanden den Hierarchen von Konstantinopel und Rom einen Ehrenvorrang zu. Die Ersthierarchen der Diözesen wurden seit 451 (Konzil von Chalzedon) offiziell als Exarchen bezeichnet. Nachdem die Exarchen von Asien, Pontus und Thrakien sich dem Erzbischof von Konstantinopel unterstellt und die Provinzen Palästina I–III sich aus dem Rechtsbereich Antiochias gelöst und Jerusalem unterstellt hatten, waren die fünf klassischen Patriarchate ausgebildet; neben Rom waren dies Konstantinopel, Antiochia, Alexandria und Jerusalem. Die Bedeutung der fünf Sitze führte im Osten zur Lehre von einer Pentarchie als Fünferkollegium (griech. pente = fünf; archein = herrschen). Die Liste von fünf Patriarchaten, die gemeinsam herrschen sollten, begegnet erstmals 451 (Akten des Konzils von Chalzedon). Dies wurde sogar in die Gesetzgebung Kaiser Justinians10 aufgenommen. In den Auseinandersetzungen des 7. (Monotheletismus) und 8. Jahrhunderts (Bilderstreit) wurde im Osten die Bedeutung des Fünfergremiums oft unterstrichen, später – mit Spitzen gegen den römischen Primat – vor allem beim Konzil in Konstantinopel 869/70 und beim Bruch zwischen Ost- und Westkirche 1054. Somit waren die oben zitierten, Papst Gelasius I. zugeschriebenen Bemerkungen im Decretum Gelasianum durchaus gegen Konstantinopel gerichtet und petrinischen Vorstellungen verpflichtet, weil Alexandria, Antiochia und Rom als Sitze, an denen Petrus oder einer seiner Schüler gewirkt hatten, hervorgehoben und damit indirekt den beiden anderen Patriarchaten Konstantinopel und Jerusalem übergeordnet wurden. Diese seit dem 5. Jahrhundert belegte römische Interpretation förderte in der Zukunft nicht die Eintracht mit dem Osten. Gelegentliche Anfragen bei Konflikten in Rom dürften kaum die Anerkennung einer römischen Spitzenposition beweisen, denn die entsprechenden Patriarchate suchten in solchen Situationen überall Bundesgenossen.
Unter dem zweiten Nachfolger des Gelasius, Papst Symmachus (498–514), wurde die Ablehnung staatlicher Einmischung deutlicher. Bei den Wahlen 498 konkurrierten zwei Strömungen, die sich in ihrer Haltung zu Konstantinopel unterschieden. Gegen Symmachus, der eher in der Tradition seiner Vorgänger eine größere Unabhängigkeit Roms verfolgte, wählte eine andere Gruppe Laurentius, der stärker mit Konstantinopel zusammenarbeiten wollte. Der in Italien herrschende Ostgotenkönig Theoderich erklärte jedoch Symmachus zum rechtmäßigen Papst, da er angeblich früher zum Kleriker geweiht und von einer Mehrheit gewählt worden sei. Dies führte auch zu weiteren Klärungen des Papstwahlverfahrens: Als die Gegenpartei des Laurentius Anklage gegen Symmachus erhob, berief Theoderich eine Synode – nun lud sogar ein König zu einer Synode –, um die Vorwürfe überprüfen zu lassen. Symmachus aber lehnte es ab, wegen sittlicher Verfehlungen durch diese Synode gerichtet zu werden, obwohl dieses Verfahren bisherigen Rechtsnormen entsprach. Niemand dürfe den ersten Sitz richten, hieß es auf einer weiteren Synode italischer Bischöfe 501.11 In den nach Symmachus benannten „Symmachianischen Fälschungen“ versuchten Anhänger des Symmachus, diese Position mit erfundenen Papstprozessen der Vergangenheit zu untermauern. In den Schriften wurde unter anderem eine vermeintliche Synode von Sinuessa zur Zeit Diokletians zitiert, um die Beschlüsse der Synode von 501 zu rechtfertigen. Eine andere Fälschung erfand ein Konzil, das angeblich Papst Silvester I. einberufen haben sollte. Auch diese Texte gehörten bald zu den gleichsam „verfassungsrechtlichen“ Schriften des Papsttums. Wenn jedoch von Fälschungen die Rede ist, so bedeutet das nicht unbedingt, dass die aufgezeichneten Bestimmungen von den gängigen Vorstellungen der Zeit weit entfernt lagen. Sie spitzten vielfach nur bestehende Ansichten juristisch zu. Die Fälschungen stellten jedoch auch eine Grundfrage: Wie sollte man überhaupt einen Papst absetzen, wenn der erste Sitz jedem rechtlichen Zugriff entzogen war? Die in den Symmachianischen Fälschungen vertretene Position unterstrich die göttliche Stiftung des Papstamtes, weshalb spätere Verfahren zur Absetzung von Päpsten immer große rechtliche Probleme zu lösen hatten.12