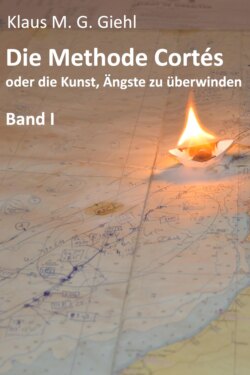Читать книгу Die Methode Cortés - Klaus M. G. Giehl - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI. DIE METHODE CORTÉS
1 „Meinmond“
Nein. Zwei Monde schienen nicht in meiner Welt. Hatte ich mich doch glatt von der Laterne da täuschen lassen. Da drüben schien kein Vollmond, da schien eine Laterne! Und sonst schien in dieser Nacht nur die wie ein Schiff am Horizont treibende Mondsichel.
Noch war die Sonne nicht aufgegangen, aber langsam, sacht, unaufhaltsam kündigte sie sich an, schob ihr Grau, ihr Violett, und endlich ihr Rot in den Horizont, und damit die Erinnerung an Cortés in mein Bewusstsein.
Wieso kam ich gerade jetzt auf Cortés? Weil er seine Schiffe verbrannte, sie verglühten, wie dieses Mondschiff in der Morgendämmerung verglühen würde? Weil die Entscheidung der Nacht, meinen letzten Traum jetzt wahr werden zu lassen, mich an den Tag erinnerte, der Cortés in mein Leben spülte?
Egal. Cortés war wichtig geworden für mein Leben und für die Brücke zum Neuen. Auf diese Brücke geschubst hatte mich Gonzalo, die spanische Glatze, mein alter Freund und beruflicher Ziehvater. Das musste Mitte achtundneunzig gewesen sein, als er sie mir erzählt hatte, diese Geschichte über Cortés. Den Schiffeverbrenner. Den Angstverbrenner. Den Traumverbrenner.
2 Cortés
Hernán Cortés war ausgezogen, Moctezumas Reich zu zerschlagen. Mit zwölf Schiffen. Eines für jeden Gott, dem die Azteken Menschen opferten. Aufgebrochen von Kuba, waren die Konquistadoren in einen Sturm geraten und an den Gestaden Yukatans eher gestrandet als gelandet. Doch wie durch ein Wunder hatte man sich wiedergefunden. Und schließlich, nach mühevoller Fahrt entlang der Küste, ging die Flotte an der Grenze des Aztekenreichs vor Anker. Dort, an einem öden Strand, saßen die Eroberer seit Wochen fest.
Cortés hatte sich eine Menge vorgenommen, aber es ging einfach nicht voran. Täglich empfing er Moctezumas Gesandte, ließ sich von ihnen preisen und beschenken, und verabschiedete sie höflich. Inzwischen hatte man sich fast gewöhnt an das Gepränge. Und je vertrauter es wurde, desto deutlicher wurde die Vorstellung von den Reichtümern der Azteken: Dort, in der Wildnis jenseits der Uferdünen, warte genau, wofür man gekommen sei. Gold. Unglaubliche Mengen Gold! – Doch Cortés wunderte sich:
Warum schickte Moctezuma all die Geschenke? Wollte er ihn verhöhnen? Oder waren die Gaben Köder, „diese fahlgesichtigen Neuankömmlinge“ in ein Inferno zu locken, das die buntbefederten Krieger als „Willkommensgruß“ im Landesinneren bereitet hatten?
Auch bei Cortés‘ Männern wucherten die tollsten Theorien. Und die Sorgen der Konquistadoren schienen sich miteinander zu verbünden: Man hatte Angst. Aber am Strand, in Reichweite der Kanonen, da sei es sicher. Also blieb man erst mal. Grund zur Eile bestehe schließlich nicht.
Cortés allerdings begann zu begreifen. Und ihm als vermutlich einzigem dieses verlassenen Haufens Spanier wurde klar, was diese Angst bedeutete:
Mit ihr ginge es nirgendwohin! Weder vorwärts noch zurück! Doch was sollten sie tun? Heimsegeln und dem König berichten, in der Ankerbucht sei nichts weiter zu finden gewesen und obendrein seien sie dieser unterwürfigen Unterhändler überdrüssig geworden? Oder sollten sie schauen, woher diese kamen, und sich in den Schlund eines Monsters wagen, das vielleicht noch grauenvoller war als das der eignen Phantasie?
Cortés sah ein, dass der Impetus zur Eroberung El Dorados in dem Moment, in dem man den ersten Fuß auf diesen Strand gesetzt hatte, verpufft war wie die Luft einer zerstampften Schweinsblase. Cortés ärgerte sich, indessen weniger über seine Männer, als über sich selbst: Über diese verdammte Angst, die ihm im Gedärm rumorte, und in der er sich kaum von dem verlausten Pack da draußen unterschied!
Cortés verstand sich selbst nicht mehr:
Wo war er denn, der Mut, mit dem er sich ein Denkmal hatte setzten wollen? Er reichte eben bis an diesen Strand! Zum Glück hatte man genug Wasser, Pulver und Kanonenkugeln. Oder war genau das das Unglück, dass nichts fehlte, für eine „angenehme Rast“? War er, Cortés, etwa kein Held? Oder hatten Helden kein Schiff, das im entscheidenden Augenblick Schutz bot? War deren Unglück letztlich das Glück, das sie zu Helden machte? Dann hatten sie den Mut der Verzweiflung. Oder war es Ignoranz, das Verkennen der Gefahr? Doch er, Cortés, war nicht ignorant!
Aber mutig fühlte er sich auch nicht gerade. Und das war ihm bewusst. Sehr bewusst. Allein mit den Duetten seiner Ängste und seinem Streben nach Größe – nach seinem Platz in der Geschichte! – freundete sich Cortés zunehmend mit dem Gedanken an, dass Mut nicht heiße, keine Angst zu haben, sondern sie zu überwinden. Egal wie! Denn was am Ende zählte, war das Ergebnis, das Erreichte. Und eben das für alle – selbst die Dümmsten! – „Begreifbare“: das Gold. Und ohne das wollte Cortés nicht mehr zurück.
Aber er zweifelte: Wie bloß könnte er sich und seine Männer überzeugen, diesen Weg, den Weg zu diesem Gold, das da vor ihnen lag, zu gehen? Und es zu nehmen, verdammt noch mal! Unmöglich konnte es nicht sein, denn Moctezumas Boten brachten nicht nur Geschenke, sondern auch Zeugnis: Das der Überheblichkeit. Oder das der Angst. Und wo die Angst herrscht, erlischt die Fähigkeit zum rechten Handeln, so wie die Einsicht zu ihm fehlt, wo Überheblichkeit gebietet. Beste Voraussetzungen also für ein Gelingen der Mission! Davon war er jetzt überzeugt! Fände er bloß ein Kraut gegen diese Angst in seinen Männern ... und in sich selbst!
Da kam Cortés ein wahrlich „zündender“ Gedanke:
Angst wurde nur dort mächtig, wo sie bleiben, wo sie wachsen konnte. Wo man ihr erlaubte, gleichsam im Herzen zu ankern. Allein so vermochte sie Verachtetes zu erheben, zur „akzeptablen Option“, der man sich nur allzu gern ergab. Doch welchen „Anker“ gewährten er und seine Männer dieser Angst? War das etwas Fassbares? Etwas, das man aufstöbern und ausradieren konnte wie ein Nest Ratten in der Bilge1? – Natürlich! Das waren die nahen Schiffe und der Schutz, den sie boten. Nur so konnte die Versuchung reifen, an diesem Strand zu bleiben und damit den unannehmbaren Rückzug und den gefürchteten Vormarsch zu vermeiden. Ohne diese Schiffe wäre der Strand nicht mehr sicher. Ohne diese Schiffe wäre man der Möglichkeit zur Umkehr beraubt. Und ohne diese Schiffe bliebe nur noch ein Weg: der Weg zum Sieg – oder in den Tod!
Der Entschluss war gefasst. Am Abend des 14. Augusts 1519 gab Cortés einem Vertrauten den Befehl, die Flotte in Brand zu setzen. Was folgte, war die Zerschlagung des Millionenreiches der Azteken – durch ein Häuflein von sechshundert Spaniern mit zehn Kanonen, und mit sechzehn Pferden.
Gewiss halfen noch viele Zufälle, das vermeintlich Unmögliche zu erreichen. Doch unabdingbar war dieser Initialfunke, der von den lodernden Schiffen in die Köpfe flog, und Cortés und seinen Männern genau die Motivation gab, das unmöglich Scheinende möglich zu machen. Cortés war also Motivationskünstler. Und seine Kunst hatte Methode. Diese war „die Methode Cortés“.
3 Punktphasen
Instinktiv hatte mich Gonzalos Geschichte über Cortés fasziniert, womöglich, weil ich – angstgeplagt – oft selbst nicht hatte sein können, wer ich hätte sein wollen, und ich mein Leben nicht weiter diesen Ängsten hatte widmen wollen. Mein Freund Paul, mit dem ich mich einmal bei einem Wein über die Geschichte unterhalten hatte, hatte das „Sich–den–Rückzug–vermiesen“ als Essenz des Ansatzes erkannt. Dieses ist zweifelsohne eine wichtige Ingredienz des Verfahrens, die aber dessen erbarmungslos effektiven Kern nicht trifft. Der ist, sich exklusiv auf eine Option festzulegen, und zugleich jeden Ausweg auf andere Optionen zu eliminieren. Gerade das Ausschließliche entzieht der Angst die Grundlage und schafft so die Motivation, auf dem Weg zum erkorenen Ziel zu bleiben. Es hilft also kaum, sich unerwünschte Alternativen weniger schmackhaft zu machen oder gar zu „vermiesen“. Mit solch „fester“ Entschlossenheit vermag man (bei „gebotener“ Demut oder „gereifter“ Einsicht oder besser beidem) nur allzu leicht auf vormals Verschmähtes umzuschwenken, besonders, wenn die Angst die Pirouette versüßt.
Erst Jahre nach diesem Plausch mit Paul hatte ich verstanden, dass einen nach der „Methode Cortés“ getroffenen Entschluss durchzuhalten kein Selbstläufer ist, denn an Alternativen in drolligen Varianten offeriert das Leben einen wahren Dschungel, in dem man flugs den Überblick verliert. Unverhofft mutiert da das Inakzeptable in eine schmierig schillernde Alternative, die man als „neu“, „eigentlich“ akzeptabel und vorher nicht bedacht zu erkennen denkt. Und tatsächlich bietet das Leben doch neue und akzeptable Optionen. Genau die zu erkennen, ist die Kunst der „Methode Cortés“: Man darf die in der Tat neuen und akzeptablen Optionen nicht mit den nahezu zur Unkenntlichkeit variierten inakzeptablen verwechseln. Und das ist schwierig. Die endlosen Permutationen des Inakzeptablen laden die Angst nämlich geradezu ein, sich sozusagen durchs Hintertürchen erneut ins Geschehen einzuschleichen – und sich die feiste Bangefratze veredeln zu lassen.
Was kann in diesem Getümmel helfen? Sicherlich ein klarer Blick. Nach meiner Erfahrung hilft indes vor allem, nach der „Methode Cortés“ zu entscheiden, und zwar angsteliminierend und irreversibel. Man erspart sich so belangvolle Konfrontationen mit Scheinalternativen und eröffnet sich gleichzeitig den Weg zum wirklich Neuen. Insofern bietet diese Methode fürwahr kreative Elemente. Schön im Grunde, nicht wahr?
Aber ich sollte mich zügeln, nicht ins „Schwärmen“ geraten, wie es mir als „Wissenschaftler von Herzen“ leicht unterlaufen kann, wenn ich über eine derart effektive Methode zu referieren habe, obschon mir dies bei meinem Verständnis der Methode (ich bin hier Experte!) durchaus nicht unterlaufen sollte. Denn durchaus ist die „Methode Cortés“ dazu geeignet, Situationen zu schaffen, mit denen man (aus der Retrospektive!) gar nicht mehr einverstanden ist!
Doch dazu später. An dieser Stelle sollte diese „Warnung“ genügen. Und an dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich keineswegs wie ein Wunderwasserhändler für die „Methode Cortés“ werben möchte. Mein Anliegen ist, über sie zu berichten, zu erläutern, wie wirkungsvoll, ja, rabiat und unabänderlich sie das Leben eines Menschen zu beeinflussen imstande ist. Lassen Sie sich also nicht ins Bockshorn jagen, wenn ich beziehungsweise das für die jeweilige Phase des Erzählten relevante Ich ins Schwärmen gerate respektive gerät.
„Das für die jeweilige Phase des Erzählten relevante Ich“? Was ist damit gemeint? Um die Frage zu beantworten, muss ich auf ein Kuriosum der Geschichte eingehen: Diese umfasst siebenunddreißig Jahre meines Lebens und setzt sich zusammen aus Notizen, „Originaldokumenten“, meinen frühen literarischen Versuchen, meinen weniger frühen literarischen Versuchen usw. Ich, der „späte“ Jakob Zucker, der Jakob Zucker des Jahres 2017, habe diese Texte zusammengefügt, ein wenig „poliert“, aber hierbei darauf geachtet, die Sprache meines Denkens und die Sprache meines Fühlens authentisch, also auf dem Stand der jeweiligen Zeit zu belassen, über die sie berichten. (Auch, wenn es mir, dem „späten“ Jakob Zucker, gelegentlich schwergefallen ist, den Mund zu halten zu dem Bockmist, den der „primordiale“ Jakob sich da zuweilen zusammengedacht und geleistet hat.) Urteilen Sie also nicht zu früh! Geben Sie dem „Helden“ der Geschichte eine Chance. Die Chance, sich zu entwickeln. Und entwickeln wird er sich! (Wenn auch nicht in einem gemeinhin als positiv verstandenen Sinne.)
Zurück zum eigentlichen Thema, zur „Methode Cortés“: Ihre Bedeutung für mich tatsächlich zu begreifen begann ich nach der Trennung von meiner Frau. Wir hatten damals in Austin gewohnt und vorgehabt, nach Deutschland zurückzukehren, um in Mainz, unserem „voramerikanischen“ Zuhause, ein ruhigeres Familienleben zu führen, gemeinsam. Zumindest war ich von einem gemeinsamen Vorhaben ausgegangen, bis sich meine Frau kurz vor unserem Abflug im Dezember 2003 von mir getrennt hatte. In meiner „Not“ hatte ich allerdings Glück gehabt und meine schon gekündigte Biologieprofessur an der University of Texas at Austin retten können. So war mir meine geliebte Forschung geblieben (in der alten Heimat hätte ich als Arzt gearbeitet). Und ich begann, zu begreifen, dass die „Methode Cortés“ für mich wichtig werden würde.