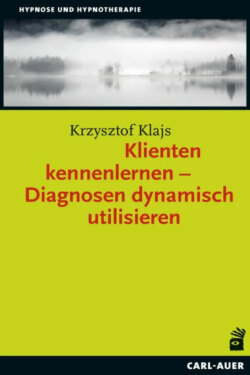Читать книгу Klienten kennenlernen – Diagnosen dynamisch utilisieren - Krzysztof Klajs - Страница 10
1.3Diagnose und Suggestion
Оглавление»Möchten Sie den Klienten bereits bei der zweiten Therapiesitzung zu seiner Vergangenheit befragen, dann sollten Sie dafür einen wirklich triftigen Grund haben.«
Norma Barretta
Die Beziehung zwischen der Person, die die Diagnose stellt und der Person, bei der die Diagnose gestellt wird, ordnet sich in einen breiteren Kontext hinsichtlich der Beziehung von Beobachter und beobachtetem Objekt ein. Auf der einen Seite dieser Beziehung steht die Forderung, dass der Beobachter dem beobachteten Objekt gegenüber neutral bleiben sollte, dass er nicht modifiziert und keinerlei Einfluss nimmt, sondern ausschließlich registriert.
Auf der anderen Seite dagegen steht die Überzeugung, dass durch den bloßen Fakt der Interaktion Beobachter und beobachtetes Objekt in einer solch starken Beziehung zueinander stehen, dass sie ohne einander gar nicht existieren würden. Die Position eines objektiven Beobachters, der keinen Einfluss auf den beobachteten Raum nimmt, ist somit reine Illusion. Die heisenbergsche Unschärferelation sagt aus, dass man Eigenschaften von Objekten unmöglich definieren kann, solange keine Beobachtung erfolgt. Dieses Prinzip gilt zwar für die Quantenphysik, kann aber auch hier als sinnvolle Metapher dienen. Der Therapeut, der den Klienten kennenlernt und beschreibt, beeinflusst den Klienten und wird gleichzeitig auch selbst von ihm beeinflusst.
Ähnlich ist auch die Musik nicht nur eine präzise Aufzeichnung von Noten, sondern eine subjektiv erlebte innere Erfahrung des Zuhörers. So sind die Erfahrungen zweier Personen, die dasselbe Musikstück gehört haben, in ihrem Wesen nicht miteinander vergleichbar. Ein jeder erlebt die Musik individuell. So verleiht allein der Empfänger – durch den bloßen Akt des Zuhörens – den Tönen einen einzigartigen inneren Klang (Botstein 2014). Ebenso behaupten viele Künstler, die im Bereich der bildender Kunst tätig sind, dass ihre Arbeit lediglich den Rahmen darstellt, den Ausgangspunkt für einen Dialog mit dem Empfänger. Ohne diesen Dialog existiert die Arbeit nicht. Der Betrachter belebt das Bild durch seine ganz individuelle Wahrnehmung, er verleiht dem Werk einen eigenen und einmaligen Ausdruck. Da jeder Betrachter eine andere Sichtweise hat, kann niemals nur von einem Kunstwerk gesprochen werden, vielmehr existieren so viele Werke, wie es Betrachter gibt (Rottenberg 2016).
Der Diagnoseprozess kann auch als Raum zwischen zwei Polen betrachtet werden: Zwischen dem Pol der völligen Neutralität des Therapeuten und dem Pol einer absoluten Abhängigkeit beider Seiten voneinander.
Trägt der Therapeut Informationen zum Klienten zusammen, so ist er weder objektiv noch neutral. Unmöglich ist aber auch, dass der Therapeut am entgegengesetzten Pol verweilt, an dem beide Seiten des Diagnoseprozesses – der Therapeut und der Klient – in einem Maße voneinander abhängig sind, das ein Kennenlernen der jeweils anderen Person ausschließt. Der Klient existiert schließlich unabhängig vom Therapeuten und der Therapeut unabhängig vom Klienten. Sowohl die Beschwerden als auch das gesundheitsförderliche Potenzial der erkrankten Person existieren unabhängig davon, ob sich diese im Diagnose- und Therapieprozess befindet oder nicht.
Begegnen sich unterschiedliche Personen und treten in eine Interaktion miteinander, beeinflussen sie sich gegenseitig. Lernt der Therapeut eine Person mit Beschwerden kennen, sollte er sich dessen bewusst sein, dass beim Diagnoseprozess und durch die Diagnose, die gestellt wurde, immer eine Einflussnahme auf den Klienten stattfindet. Dieser Einfluss zeigt sich auf unterschiedliche Art.
Ein Teil der Informationen, auf deren Grundlage die Diagnose gestellt wird, stammt aus den Antworten des Klienten auf die Fragen, die ihm gestellt wurden. Jede Frage, jede Intervention des Therapeuten steuert die Aufmerksamkeit des Klienten und übt somit Einfluss auf ihn aus. Die Psychotherapie kann als Prozess beschrieben werden, der die Aufmerksamkeit des Klienten in Richtung Gesundheit lenkt. In jeder Frage des Therapeuten ist eine Suggestion enthalten, zumindest die Suggestion, dass das, wonach der Therapeut fragt, wichtig für die Therapie ist. Wenn viele Fragen zur Vergangenheit gestellt werden, wird damit suggeriert, das frühere Geschehnisse eine grundlegende Bedeutung für Gesundheit und Heilung haben. Stellt der Therapeut Fragen zur Familie und zu Beziehungen zu nahestehenden Personen, dann lautet die unterschwellige Suggestion, dass familiäre und systemische Aspekte wichtig sind. Fragen zur Sexualität suggerieren, dass dieser Bereich von Bedeutung ist, Fragen zu Gefühlen unterstreichen die Wichtigkeit von Emotionen und Fragen zum Verständnis die Bedeutung kognitiver Prozesse. Genauso verhält es sich, wenn der Therapeut bestimmte Dinge nicht erfragt, dazu schweigt oder auf ein vom Klienten angesprochenes Thema nicht weiter eingeht. Damit sendet der Therapeut die Botschaft, dass dieses Gebiet nicht so wichtig sei. Spätestens mit der ersten Frage, die er dem Klienten stellt, entfernt sich der Therapeut von seiner Neutralität, vom objektiven Zusammentragen von Daten. Durch den Inhalt der Fragen, die Zeit, die er den einzelnen Themen widmet, durch die Art und Weise der Gesprächsführung sowie durch sich verstärkende oder abflauende Reaktionen, steuert der Therapeut (bewusst oder unbewusst) die Aufmerksamkeit der Person, mit der er sich im Gespräch befindet. Informationen zusammenzutragen ist nur scheinbar eine neutrale Tätigkeit. Indirekt präsentiert der Therapeut hierbei seine Ansichten zum Thema Gesundheit und Krankheit sowie zu seinem eigenen Wertesystem.
Selbst wenn der Therapeut während der ersten Sitzung nur wenige Fragen stellt, so suggeriert er doch indirekt, indem er bei gewissen Erzählsträngen länger oder aufmerksamer zuhört als bei anderen, was hörenswert und somit wichtig ist. Auf diese Weise beeinflusst er während der Therapiesitzung die Aufmerksamkeit des Klienten.
Auch das Zusammentragen von Informationen besitzt therapeutisches Potenzial, da hierbei die Aufmerksamkeit in Richtung des gewünschten Ziels gelenkt werden kann, wodurch das Erreichen dieses Ziels näher rückt.
Als Resultat des Diagnoseprozesses kann es dazu kommen, dass sich das Identitätsgefühl des Klienten verändert. Infolge der medizinischen Diagnose erfährt sich der Klient nicht nur als Person, die etwa an einer hartnäckigen und langwierigen Erkrankung leidet, sondern nimmt sich selbst als Alkoholiker (oder als erwachsenes Kind eines Alkoholikers) wahr, als Bulimikerin oder Epileptiker. Indem sie sich mit der Krankheit identifizieren, beschränken viele Menschen ihre Aktivitäten nicht nur auf eine Weise, die sich mit der Sorge um ihre Gesundheit begründen lässt, sondern ziehen sich aus vielen weiteren Lebensbereichen zurück. Oft geschieht dies ohne medizinische Notwendigkeit, sondern ist Ausdruck einer falschen und eingeschränkten Persönlichkeitsperspektive. Das Thema Persönlichkeitsaspekte der Diagnose ist besonders bei jungen Menschen wichtig, da sie gerade erst damit beginnen, ihr Selbstbild zu entwickeln. Auch in besonderen Entwicklungsmomenten, wenn das bisherige Selbstbild Veränderungen unterliegt, sollten derartige Überlegungen zum Thema berücksichtigt werden. Hier sind beispielsweise Veränderungen als Folge biologischer Prozesse wie Menopause oder Andropause gemeint, oder wichtige Ereignisse im Leben, wie etwa Mutterschaft oder Vaterschaft, Arbeitsplatzverlust, Eintritt ins Rentenalter oder Tod des Lebenspartners.
Die Diagnose, die ein Klient vernimmt, kann eine beruhigende Wirkung haben oder aber, ganz im Gegenteil, seine Besorgnis noch verstärken. Nachdem ihnen ihre Diagnose mitgeteilt wurde, atmen viele Klienten erst einmal erleichtert auf. Sie sind (wenn auch unbewusst) der Meinung, dass, wenn der Therapeut »weiß, was mit mir los ist, er auch weiß, wie man das therapieren kann. Er hat bei mir eine Krankheit festgestellt und gegen jede Krankheit gibt es schließlich Medikamente.« Zahlreiche Klienten hingegen machen sich Sorgen. Sie verleihen der vernommenen Diagnose eine negative Bedeutung, vor allem, wenn das Internet als Quelle aller möglichen Katastrophenszenarien zurate gezogen wird.
Es ließe sich die Aussage wagen, dass die Neutralität des Therapeuten wohl eher eine Illusion ist oder im besten Falle eine unmöglich zu erfüllende und dadurch zweifelhafte Forderung.
Das Zusammentragen von Informationen und das Untersuchen des Klienten verlaufen nicht spurlos, sie beinhalten Suggestionen und führen zu Veränderungen bei der Person, die untersucht wird. Die Aktivitäten des Therapeuten, der Informationen zum Klienten sammelt, greifen also in das untersuchte Gebiet ein und verändern es.
Wichtig ist auch die Frage nach der Parallelität von Diagnose- und Therapieprozess unter den eben behandelten Gesichtspunkten der Suggestion. Manche Therapeuten bemühen sich, den Diagnose- vom Therapieprozess zu trennen. Solch ein Konzept würde bedeuten, dass zuerst die Diagnose gestellt und später eine Hypothese aufgestellt und verifiziert wird. Danach wird ein therapeutischer Handlungsplan bestimmt und im nächsten Schritt mit der Therapie begonnen. Dieses Konzept stützt sich auf die Argumentation, dass es schließlich unmöglich sei, eine Behandlung durchzuführen, wenn nicht bekannt ist, was behandelt werden soll.
Eine solche Denkweise ist Ausdruck eines linearen Zeitverständnisses, obwohl ein lineares Zeitverständnis bei Weitem keine Selbstverständlichkeit ist.
Alltägliche klinische Erfahrungswerte zeigen, dass Diagnose- und Therapieprozess parallel verlaufen und miteinander, auch zeitlich, verbunden sind. Die zeitliche Parallelität dieser beiden Prozesse, der Diagnostik und der Therapie, zeigt sich beispielsweise dann, wenn der Therapeut die Reaktionen des Klienten bereits beobachtet, während er noch mit dem Zusammentragen von Informationen beschäftigt ist. Dies schafft die Möglichkeit schneller Interventionen und verkürzt den Behandlungsprozess.
Das in diesem Buch vorgestellte Diagnosekonzept wurde zum Gebrauch der Psychotherapie erstellt. Ziel ist es, dass der Therapeut mithilfe der diagnostischen Reflexion nützliche Hinweise dazu erhält, wie er vorgehen kann, damit diese seine weitere therapeutische Arbeit lenkt.