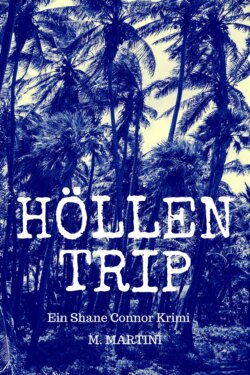Читать книгу Höllentrip - Manuela Martini - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеJoanna O’Reilly hetzte mit ihrer großen Mappe unter dem Arm den Korridor der Kinderabteilung des Brisbaner Royal Hospital hinunter. Sie war spät dran, die Auseinandersetzung am Morgen mit Marc hatte sie viel Zeit und Nerven gekostet. Sie fühlte sich erschöpft und war traurig und wenn sie ein weniger disziplinierter Mensch wäre, hätte sie sich heute krank gemeldet. „Du glaubst, ohne dich geht es nicht“, warf ihr Marc öfter vor. Letztes Mal hatte sie daraufhin einfach ja gesagt. Sie fühlte sich ihren Patienten gegenüber verantwortlich und konnte nicht so einfach zu Hause bleiben, wie Marc als Bankangestellter. Doch er verstand das nicht.
Zehn nach neun, sah sie im Vorüberhasten an der großen Uhr über dem Stationszimmer. Ihre Sandalen mit den schlanken Absätzen waren zwar schön aber nicht zum Schnellgehen geeignet. Doch sie unterstrichen ihre langen Läuferinnenbeine und passten zu ihrem kurzen Sommerkleid mit den feinen Querstreifen in oliv, orange und weiß.
„Hi, Joanna, er hat schon nach dir gefragt!“, rief ihr Schwester Patricia-Mae zu. Joanna nickte schnell, eilte weiter den Gang entlang, an dessen Ende sie bereits die imposante Gestalt des Stationsarztes Dr. Aylett entdeckte, der vor einer Tür stehen geblieben war. Sie verabscheute es, zu spät zu kommen.
„Sorry“, stieß sie atemlos hervor. Ihr fiel wieder mal auf, wie langweilig er doch wirkte, mit seiner milchigen Haut und dem schwammigen, faltenlosen Gesicht, das im Laufe seines vierzigjährigen Lebens nicht markanter, sondern eher noch konturloser geworden war.
„Sie haben gestern einen Jungen aus dem Hospital in Charleville hergebracht“, sagte er ohne Einleitung. „Seit einer Woche hat er kein Wort gesprochen.“
Joanna O’Reilly stieg sein After Shave in die Nase und nahm ihr beinahe den Atem. Dabei hätte sie sich nach einem Jahr seitdem sie in der Brisbaner Klinik als Kunsttherapeutin vier Tage die Woche arbeitete, schon daran gewöhnen müssen. Obwohl eine Menge Mitbewerber den Job wollten, hatte man sie genommen. Ihr Einfühlungsvermögen, ihre Geduld und ihre Intuition hatten nicht nur die Personalchefin sondern auch eben Dr. Aylett beeindruckt. Sie kam gut mit Menschen klar, auch mit denen, die ihr und ihrer Arbeit eher skeptisch gegenüber standen. Und Bemerkungen von Neidern, die behaupteten, sie habe den Aborigine-Bonus, ignorierte sie einfach.
Dr. Aylett drückte ihr eine dünne Mappe in die Hand.
„Ein Truckfahrer hat ihn gefunden. Stand auf einmal mitten auf der Straße. Er meidet jeden Kontakt, hat autistische Züge, spricht nichts. Wir wissen nichts, noch nicht mal seinen Namen. Finden Sie raus, was passiert ist! Bringen Sie ihn zum Sprechen!“
Sie blickte ihm nach, wie er mit wehendem weißen Kittel den Flur hinunterging. Joanna seufzte und sah auf die Unterlagen in ihrer Hand. Sie stand am Ende eines endlos langen, leeren Korridors. Dann blickte sie auf die weiße geschlossene Tür vor sich. Rasch überflog sie das Polizeiprotokoll. „Sie kommen mich holen“, hatte der Junge dem Truckfahrer gegenüber gesagt, und: „Sie haben sie vergraben.“ Welches Schicksal wartete da hinter der weißen Tür? Sie schluckte und stieß sie auf.
Auf einem der beiden Betten hockte ein Junge. Sie schätzte ihn auf neun oder zehn. Seinen Kopf hatte er zwischen die Schultern gezogen. Der hellblaue Jogginganzug stammte aus dem Krankenhaus. Sie hatte keine Ahnung, wo sie beginnen sollte. Der Junge schien sie überhaupt nicht zu bemerken.
„Hi“, sagte sie, „ich heiße Joanna.“ Sie setzte sich auf das leere Bett neben ihm und wartete ab. Der Junge blickte mit braunen großen Augen durch sie hindurch, Augen aus denen das Leben geflohen war. Er erwiderte nichts. Sie betrachtete ihn. Seine Haut war sehr hell, im Gesicht hatte er Sommersprossen und ein paar Schürfstellen. Seine dunklen Wimpern waren für einen Jungen eher ungewöhnlich lang, die hohen Wangenknochen ließen auf slawische Vorfahren schließen. Es war still bis auf das Tropfen des Wasserhahns im Bad.
Nach einiger Zeit stand sie auf und packte aus ihrer Mappe einen großen Zeichenblock und Acrylfarben aus, die sie auf den schmalen, langen Tisch an der Wand legte.
„Ich hab’ dir was mitgebracht.“
Sie unternahm noch nicht einmal den Versuch, mit ihm in den Therapieraum zu gehen, denn sie war sicher, dass er nicht freiwillig mit ihr das Zimmer verlassen würde. Nicht jetzt, nicht beim ersten Mal. Kaum merklich, aber ihr war es nicht entgangen, hatte er eben die Augen bewegt.
Sie setzte sich an den Tisch und wartete. Würde er sie, eine Fremde, in seine Welt eindringen lassen? Er saß weiter mit angezogenen Beinen auf dem Bett, den Blick auf die Wand vor ihm gerichtet. Sein rechtes Ohr stand etwas ab, fiel ihr jetzt auf und nun sah sie auch die feinen verkrusteten Schrammen an seinen Händen und Armen. Was hast du erlebt?, dachte sie. Doch er sah sie noch nicht einmal an. Immer noch nur ihr Atmen und der tropfende Wasserhahn und das kaum vernehmbare Ticken ihrer Armbanduhr.
Und plötzlich geht alles ganz schnell:
Die Tür wird aufgestoßen und Schwester Patricia-Mae kommt herein. Der Junge starrt die Schwester mit schreckgeweiteten Augen an, springt im selben Moment auf, wirft sich wie ein in die Enge getriebenes Tier zum Schrank, bekommt die obere Kante zu fassen und versucht hinaufzuklettern.
Patricia-Mae will den Jungen festhalten, ihn vor dem Hinunterfallen bewahren. Doch der brüllt und tritt wild um sich, noch immer mit den Armen am Schrank hängend.
„Lassen Sie ihn, Patricia-Mae!“, ruft Joanna. „Er verletzt sich doch!“
„Lassen Sie ihn sofort los!“, wiederholt Joanna energisch.
Da lässt die Schwester endlich von dem Jungen ab, der daraufhin sofort verstummt.
Eine Weile rührte sich niemand, dann ließ der Junge die Schrankkante los und glitt langsam hinunter.
„Du bist in Sicherheit“, sagte Joanna mit ruhiger Stimme, „Niemand hier tut dir etwas.“ Zum ersten Mal sah sie der Junge an. In seinem Blick stand die pure Angst. Joanna bat die Krankenschwester, zu gehen und der Junge verkroch sich ins Bett und zog die Decke über den Kopf. Sie blieb noch eine Weile neben ihm auf der Bettkante sitzen, ließ ihm die Decke als schützende Höhle und ging schließlich.
Die nächsten vier Stunden mit den anderen Patienten verliefen erfolgreicher. Doch sobald sie ein paar Minuten Zeit hatte, sah sie bei dem Jungen herein. Eine Praktikantin versuchte mit ihm zu spielen, einmal waren zwei Kinder bei ihm, doch er nahm mit niemandem Kontakt auf.
Als Joanna am Abend die Klinik verließ, fühlte sich müde und niedergeschlagen. Wie lange würde es dauern, bis der Junge zu sprechen begänne? Würde er es überhaupt tun? Sie vermisste ihre Supervisorin, von der sie sich Rat und Unterstützung holen könnte. Doch Jil Graham war nach England gezogen und einen Ersatz hatte Joanna noch nicht gefunden.
Vor dem Eingang blieb sie eine Weile stehen und sie genoss die warme, feuchte Luft. Sie war ihr lieber als die kalte aus der Klimaanlage, sie hatte das Gefühl, ein bisschen zu entspannen. Dann fiel ihr Marc wieder ein, der sicher schon zu Hause wäre. Viel lieber wäre sie jetzt allein gewesen – oder mit einem Menschen zusammen, bei dem sie sich aufgehobener fühlen konnte, verstanden – ein Krankenwagen raste mit Blaulicht und Sirene heran und unterbrach ihre Gedanken. Sie sah, wie Sanitäter die Türen aufrissen und eine Trage herausschoben auf der ein Mann mit blutigem Gesicht lag. Er hatte schwarze Haut - wie sie. Manchmal vergaß sie das.
Joanna fuhr durch die Straßen der City hinunter zum Fluss, fand trotz des Samstags einen Parkplatz und ging hinunter zum Riverside Quai. Ein paar Minuten Aufschub, dachte sie, bevor sie nach Hause fahren würde. Es roch wunderbar nach Moos und Fluss, und von den Cafés am Fuße der hohen Apartmenthäuser mit ihren spiegelnden Glasfassaden drangen Stimmen und Musik. Sie sah hinauf in die weißen Wolken. Möwen kreisten. Der Wind wellte die Oberfläche des Wassers auf der Wasservögel sich treiben ließen. Eine Weile stand sie so da, und spürte, wie all das sie durchdrang, wieder stärkte und ruhiger machte. Dann stieg sie die Stufen zum hölzernen Quai hinunter und schlug die Richtung flussabwärts ein.
Als sie gestern Abend spät nach Hause gekommen war, hatte Marc auf dem Sofa gelegen, fern gesehen und mit glasigen Augen aufgeblickt als sie hereingekommen war.
„Ohne dich läuft’s wohl nicht!“, hatte er gesagt. „Andere gehen um diese Zeit aus.“ Sie war wortlos ins Bad gegangen. Er hatte sich in den letzten Monaten verändert, interessierte sich nicht mehr für ihre Arbeit, im Gegenteil, er warf ihr vor, zu viel zu arbeiten. Auf ihre Frage hin, ob er Ärger im Büro habe, winkte er immer nur ab. Natürlich dachte sie an eine Affäre. Aber schließlich hatte sie dann doch nicht den Mut gehabt, ihn direkt zu fragen.
Sie bemerkte, dass sie schon fast an der Victoria-Bridge angekommen war. An ihrer rechten Ferse brannte eine Blase. Sie wünschte sich, Joggingschuhe angezogen zu haben und kehrte um. Als sie an einer Ampel auf Grün wartete, donnerte ein Lastwagen vorbei, und sie stellte sich vor, wie der Junge mitten auf der Straße gestanden hatte. Woher war er gekommen? Und wer wollte ihn holen?