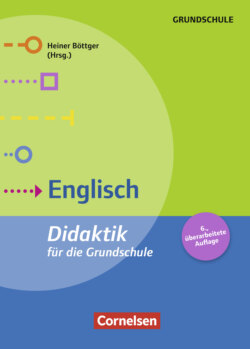Читать книгу Fachdidaktik für die Grundschule - Marianne Häuptle-Barceló - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.2 Herkunft
ОглавлениеDie ethnische, sprachliche, kulturelle und religiöse Vielfalt ist weitgehend zum Normalfall geworden. Die Debatte, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist oder nicht, ist von der Wirklichkeit überholt worden. Ein Gesetz wird hier in Kürze für eine Neuregelung sorgen. Wie stark eine Klasse ethnisch und sprachlich durchmischt ist, schwankt abhängig davon, ob es sich um Klassen in einer Großstadt oder im ländlichen Raum handelt und wo die schulischen Einrichtungen liegen. Die Freigabe des Einzugsbereichs für die Grundschulen hat z. B. zu beachtlichen negativen Auswirkungen hinsichtlich der Gentrifizierung geführt.
Nach den Daten des Mikrozensus von 2018 hat heute ungefähr jede vierte Person in Deutschland einen Migrationshintergrund – in Westdeutschland sind es 28,6 Prozent, in Ostdeutschland 8,0 Prozent –, d. h. dass die Person selbst oder ihre Eltern bzw. Großeltern aus einem anderen Land stammen. Damit ist der Anteil aller Kinder unter fünf Jahren, die einen Migrationshintergrund haben, auf 40,6 Prozent gestiegen (Bundeszentrale für politische Bildung 2019).
Einen Migrationshintergrund hat eine Schülerin / ein Schüler, so auch die Definition des Mikrozensus, wenn eines der vier folgenden Merkmale zutrifft: nicht in Deutschland geboren, keine deutsche Staatsangehörigkeit, Vater oder Mutter nicht in Deutschland geboren oder Vater oder Mutter ohne deutsche Staatsangehörigkeit. In Nordrhein-Westfalen hat z. B. an jeder dritten Grundschule mindestens die Hälfte der Kinder einen Migrationshintergrund. An vielen Schulen liegt der Anteil sogar bei über 50 Prozent, einige werden fast ausschließlich von Kindern mit Migrationshintergrund besucht. An den staatlichen Grundschulen in Hamburg sind 49,3 Prozent Kinder nicht deutscher Herkunft. Das sind nur einige Beispiele.
Das Hauptaugenmerk im schulischen Kontext liegt im Allgemeinen nicht auf Zugewanderten, die aus dem west- oder nordeuropäischen Ausland kommen (Dänemark, Schweden, Niederlande usw.), sondern auf Einwanderern aus Ländern wie der Türkei, Russland, Polen und verstärkt seit 2015 aus arabischen Ländern. Bei der Untersuchung, welche Sprachen in den jeweiligen Haushalten gesprochen werden, war Türkisch mit 17 Prozent am häufigsten vertreten, gefolgt von Russisch (15 Prozent), Polnisch (8 Prozent) und Arabisch (7 Prozent). Auf schulische Kontexte bezogen, zeigen einige Statistiken der Bundesländer, dass es zunehmend Grundschulen gibt, deren Schülerinnen und Schüler mehrheitlich zu Hause kaum Deutsch sprechen. Nach Arp/Elger (2018) trifft dies z. B. in Berlin auf 43 Prozent der betroffenen Haushalte zu, in Bremen auf 41 Prozent, in Schleswig-Holstein aber dagegen nur auf 4 Prozent.
Ein erstes Fazit: Für Lerngruppen in Kitas und Grundschulen wird es zunehmend normaler, dass sie ethnisch, sprachlich, kulturell und religiös durchmischt sind. Für den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule verlangt das nach einer würdigenden Einbeziehung der unterschiedlichen sprachlichen Fähigkeiten. Das kann auch der ersten schulischen Fremdsprache das Fenster zu weiteren Sprachen eröffnen und die Schülerinnen und Schüler somit auf die Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Bildung vorbereiten (BIG-Kreis 2005, 13). Gerade weil einige Kinder schon eine Zweitsprache gelernt haben oder diese noch vervollständigen müssen, ist es wichtig, dass der Englischunterricht einsprachig abläuft. Dann haben alle Kinder die gleichen Ausgangsbedingungen beim Erlernen der neuen Sprache und „die Schulen sind neben dem Arbeitsplatz die Integrationsorte Nummer eins“ (Yvonne Gebauer, Schulministerin NRW 2017, zit. nach DPA 2017).