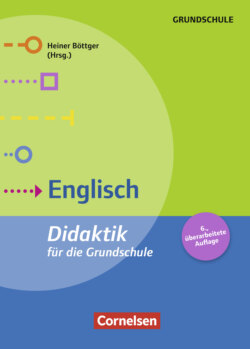Читать книгу Fachdidaktik für die Grundschule - Marianne Häuptle-Barceló - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.6 Spiele, Freizeit und Medien
ОглавлениеWenn nach den Vorerfahrungen und den Lebenswelten der Grundschulkinder gefragt wird, darf der Bereich der täglichen Aktivitäten nicht ausgeblendet werden. Die vierte Frage heißt deshalb: Wie werden Spiele und Freizeit heutzutage gestaltet, welche Medien haben sich in das Leben der heute Sechs- bis Zehnjährigen eingenistet?
Verallgemeinernd lässt sich mit einiger Sicherheit feststellen, dass die meisten Kinder heute vorstrukturierte und genormte Betätigungsmöglichkeiten vorfinden. Das gilt für die öffentlichen Spielplätze – Abenteuerplätze sind Ausnahmen – ebenso wie für industriell vorgefertigtes (Plastik-)Spielzeug. Da dieses durch die Massenproduktion überdies billig geworden ist, leiden Kinder nicht an einem Mangel, sondern eher an einer Überfülle an Spielzeug.
Nicht zufällig gibt es seit einigen Jahren das Projekt „Spielzeugfreier Kindergarten“, das in verschiedenen Kommunen umgesetzt wird und das es auch als Online-Angebot der Aktion Jugendschutz (Landesarbeitsstelle Bayern e. V.) gibt. Es gehört in den Bereich der Suchtprävention und soll der Stärkung von Lebenskompetenzen einschließlich der Gesundheitserziehung dienen.
Wenn sich Kinder früher sozusagen auf der Straße austoben konnten, so bieten die heutigen Städte dazu kaum noch Gelegenheit. Spielstraßen werden nicht selten unter dem Druck klagender Anwohner nicht genutzt, und was sich in Hinterhöfen abspielt, grenzt bisweilen eher an Verwahrlosung.
Demgegenüber gibt es durchaus genügend Eltern, die die finanziellen Mittel haben, um Holz- und Lernspielzeug anzuschaffen, und die Ideen haben, wie die Kreativität der Kinder gefördert werden kann. Sie regen ihre Kinder auch dadurch an, dass sie mit ihnen zusammen spielen, dass es Gesellschaftsspiele gibt und dass sie gemeinsame zielorientierte Ausflüge unternehmen.
Einen Schwerpunkt in der Freizeitbeschäftigung von Kindern, die, wie schon eingangs erwähnt, eine Welt ohne Internet gar nicht mehr kennen, bildet der Einsatz von Handy oder Smartphone. Teilweise wird sehr erregt darüber diskutiert, ob es in Schulen verboten bzw. wie es sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden soll. Im Juli 2018 hat Frankreich ein bereits in Grundschulen bestehendes Handyverbot für Schülerinnen und Schüler bis 15 Jahren verschärft. In Deutschland hat bisher nur Bayern ein solches Verbot in seinem Schulgesetz verankert, gegen das sich inzwischen aber Widerstand von Eltern und einigen Abgeordneten regt. In allen anderen Bundesländern bestehen sehr unterschiedliche Maßnahmen und Vorschriften zum schulischen und unterrichtlichen Umgang mit digitalen Medien, einschließlich spezieller Regeln für die Benutzung in den Pausen. An Grundschulen sollte es handyfreie Schulhöfe geben, damit Kinder die Freude am Toben und Spielen wiederentdecken.
Im Familienalltag wird fehlendes Miteinander immer häufiger durch mediale Befriedigung kompensiert. Die Mittel dazu liefert eine Vielzahl an elektronischem Spielzeug und Unterhaltungsgeräten, die Allgegenwärtigkeit von Medien wie TV und Internet, Audiogeräten und Handys: Medial vermittelte Bilder fangen an, die unmittelbare Welterfahrung zu überlagern. Immer wieder warnen Untersuchungen vor zu viel TV-Konsum, vor allem vor Sendungen wie Krimis, Horror- und Science-Fiction-Filmen, weil die Kinder, oft dabei allein gelassen, die Bilder nicht verarbeiten können. Einer Studie des University College London zufolge, schadet hoher TV-Konsum nachweislich dem verbalen Gedächtnis (vgl. Krapp 2019) – so kann tags zuvor in der Schule Gelerntes vergessen werden. Wenn im Fernsehen in der letzten Zeit immer wieder auf die Gefahren des Fernsehkonsums hingewiesen und den Eltern geraten wird, mit den Kindern zusammen Sendungen anzuschauen, dann stellt sich schon die Frage, wer die Zeit und die Intelligenz hat, das Quiz für den „Schau hin“-Medienpass zu bestehen.
Auf der anderen Seite darf nicht verkannt werden, dass Kinder heute über mehr Kenntnisse, Informationen und ein größeres Weltwissen verfügen als je zuvor, was manchen Erzieherinnen und Erziehern sowie Grundschullehrerinnen und -lehrern zu schaffen macht, denn es verändert ihre Rolle als „Allwissende“ und verlangt Moderationsgeschick.
Ein viertes Fazit: Das familiär und herkunftsbedingt unterschiedliche Spiel-, Freizeit- und Medienverhalten führt zu ebenso unterschiedlichen Einstellungen zu Schule und Unterricht. Da sitzen die hoch motivierten und neugierigen Kinder, die lernen wollen und sich auf Unterricht freuen, neben denen, die lustlos, müde und unkonzentriert sind, weil sie mit ihren Fernseherlebnissen nicht fertigwerden. Auch hier hat der Englischunterricht eine Chance, positiv einzugreifen. Auf der einen Seite mit Lernspielen und Gesellschaftsspielen, die allen Kindern Spaß machen, auf der anderen Seite mit dem zielorientierten Einsatz von Smartphone, Tablet und Internet, die zugleich hilfreiche Instrumente bei der Anleitung zum selbstständigen Lernen sind. Dabei können die Lehrkräfte zunehmend auf Materialien zurückgreifen, die die Verlage für sie bereitstellen.