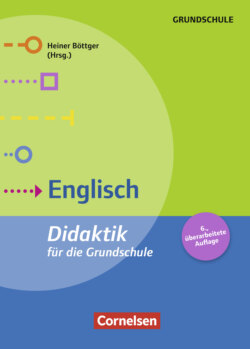Читать книгу Fachdidaktik für die Grundschule - Marianne Häuptle-Barceló - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.3 Familien- und Sozialstrukturen
ОглавлениеEng mit der Herkunft hängt das Familienleben zusammen, das in Deutschland einem besonders starken Wandel unterzogen ist. Die zweite Frage lautet deshalb: Aus welchen Familien kommen die Kinder heute, welche Familienstrukturen und Familienzusammensetzungen haben sie erlebt oder auch erlitten?
Außer den sprachlichen Differenzen bringen Kinder aus zugewanderten Familien andere ethische Normen, kulturelle Werthaltungen und religiöse Vorstellungen mit. Während in deutschen Familien die Bedeutung der Kirche und gelebte Christlichkeit stark abgenommen hat – nur noch gut die Hälfte der Eltern (vor zehn Jahren noch knapp zwei Drittel) verstehen sich als Christen, die anderen sind konfessionslos oder atheistisch – sind moslemisch oder orthodox geprägte Elternhäuser sehr viel fordernder in der Anerkennung ihres Glaubens, den zu praktizieren sie für unerlässlich halten. Das gilt nach Daten des Deutschen Jugendinstituts (DJI 2007) für ein Drittel der in Deutschland lebenden Muslime. Selbst jene, die säkularisiert sind, behalten spezifische Traditionen bei. Eine vom DJI durchgeführte Kinderpanelstudie belegt eine gegenüber der deutschen Bevölkerung deutlich wertkonservativere Familiensituation. Fast 90 Prozent aller türkischen Kinder wachsen in einer verheirateten Partnerschaftssituation auf. Die Familien sind kinderreicher und nicht selten Großfamilien. Zusammenhalt in der Familie und Solidarität zwischen den Generationen gehören zu ihren Grundwerten. D. h., dass „der Zusammenhalt der Familie vor individueller Entfaltung steht“, so das Deutsche Jugendinstitut.
In deutschen Familien stellt sich die Situation ganz anders dar. Im Jahr 2017 wurden gegenüber 449 500 Eheschließungen 148 066 Ehen geschieden. Während in den 1950er-Jahren auf durchschnittlich rund zwölf Eheschließungen eine Scheidung kam, gab es im Zeitraum von 2011 bis 2017 nur noch rund 2,32 Hochzeiten pro aufgelöste Ehe. Von den 153 000 Scheidungen waren in knapp 76 900 Fällen auch minderjährige Kinder betroffen, insgesamt knapp 123 500 Mädchen und Jungen (vgl. Statistisches Bundesamt 2018b). Diese Zahlen verdeutlichen, wie der elterliche Hintergrund heutiger Kita- und Grundschulkinder aussehen kann.
Kinder können beide Elternteile als leibliche Eltern haben, sie können aus geschiedenen oder auch getrennt lebenden Elternhäusern kommen oder aus Elternhäusern, in denen nur noch ein Elternteil leiblich ist. Sie können in nicht ehelichen oder eheähnlichen, auch gleichgeschlechtlichen Lebens- und Wohngemeinschaften aufwachsen, als Einzelkind, mit leiblichen, Halb- und Stiefgeschwistern. Die Zwei-Kind-Familie gilt als Familienideal und ist in Deutschland am häufigsten. Dennoch wächst jedes dritte bis vierte Kind – die Zahlen schwanken – allein auf. Es ist nicht eindeutig belegt, ob die Tendenz zum Einzelkind steigend ist. Mit Sicherheit steigend ist in den letzten Jahren die Zahl alleinerziehender Mütter und auch, aber weniger, die der alleinerziehenden Väter. Laut Statistischem Bundesamt (vgl. 2018a, 9) hatte 2017 knapp jede fünfte Familie (19 Prozent) mit mindestens einem minderjährigen Kind eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater. Scheidungswaisen müssen nicht unbedingt leiden. Es hängt davon ab, wie die Eltern nach der Scheidung mit der Trennung umgehen. Je nachdem, welche Regelungen nach der Scheidung oder Trennung zwischen den Partnern getroffenen wurden, erleben nicht wenige Kinder den fehlenden Vater als Wochenendvater.
Alleinerziehende sind nicht nur in der täglichen Erziehung der Kinder auf sich gestellt. Auch ihre ökonomische Situation ist im Durchschnitt im Vergleich zu Familien mit beiden Elternteilen schlechter. Das größte Risiko der Armutsgefährdung tragen Alleinerziehende, Haushalte mit Migrationshintergrund und mit Langzeitarbeitslosigkeit, aber auch Haushalte mit mehr als drei Kindern. Für mehr als die Hälfte der betroffenen Kinder ist Armut darüber hinaus ein Dauerzustand, der mehr als drei Jahre andauert. Von Kinderarmut ist in Deutschland jedes sechste Kind betroffen (vgl. Friedrich 2018).
Zu den Veränderungen in der Familienstruktur gehört auch die gewandelte Rolle der Frauen. Sie sind juristisch den Männern gleichgestellt und ihnen stehen – theoretisch – alle beruflichen Möglichkeiten offen. Bildungsmäßig haben die Mädchen die Jungen überholt und über die Hälfte der heutigen Mütter wollen Beruf und Familie kombinieren.
Ein zweites Fazit: Es gehört zur Realität der Kinder von heute, dass sie in sehr unterschiedlichen, gesicherten und ungesicherten Familien- und Betreuungsverhältnissen groß werden, was sich vor allem auf ihr seelisches Gleichgewicht oder eben den Mangel an Selbstbewusstsein auswirkt. Das heißt für die Englischlehrkräfte, dass ihre fachliche Kompetenz zwar unerlässlich ist, aber nur in dem Maße wirkt, wie sie positive Beziehungen zu den Kindern entwickeln, Wertschätzung signalisieren und damit bei den Kindern Selbstvertrauen aufbauen.