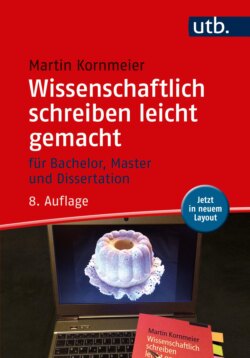Читать книгу Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht - Martin Kornmeier - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2 Die vier Grundsätze von Bäcker Roth oder: „Wie man sich bei wissenschaftlichen Arbeiten korrekt verhält!“
ОглавлениеGeben Sie bei Google doch mal „Grundsätze Bäckerei“ ein! Sie stoßen dann u. a. auf die Bäckerei Roth, die mit ihren Grundregeln exemplarisch für viele Vertreter ihrer Zunft steht:
• traditionelles Handwerk,
• voller Geschmack,
• natürliche Zutaten,
• ehrliche Deklaration.
Oder anders formuliert: Jene Bäcker, für die der Slogan „Erstklassiges Handwerk!“ mehr als nur eine Floskel ist, legen offenbar großen Wert auf
• STILvolle Backwaren mit exquisitem Geschmack durch traditionelles Handwerk,
• Backwaren mit INHALT (aufgrund hochwertiger Zutaten),
• EHRLICHKEIT!
Da wir Inhalt, Stil und auch Form wissenschaftlicher Arbeiten noch eingehend beleuchten werden, sei an dieser Stelle die besondere Bedeutung der Ehrlichkeit betont, denn: „Wissenschaft ist die Suche nach Wahrheit. Der redliche Umgang mit Daten, Fakten und geistigem Eigentum macht die Wissenschaft erst zur Wissenschaft. Die Redlichkeit in der Suche nach Wahrheit und in der Weitergabe von wissenschaftlicher Erkenntnis bildet das Fundament wissenschaftlichen Arbeitens“ (Albers u. a. 2012, S. 2).
Aus diesem Grund haben der Allgemeine Fakultätentag, die Fakultätentage sowie der Deutsche Hochschulverband 2012 in einem gemeinsamen Positionspapier Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis für das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten formuliert, die für Vertreter aller Wissenschaftsdisziplinen gelten sollen.
Grundsätze wissenschaftlicher Arbeiten (Bachelorarbeit, Masterarbeit, Dissertation, Habilitationsschrift)
„1) Originalität und Eigenständigkeit
Originalität und Eigenständigkeit sind grundsätzlich die wichtigsten Qualitätskriterien jeder wissenschaftlichen Arbeit. Dabei werden an diese Kriterien je nachdem, welche Qualifikation mit der Arbeit nachgewiesen werden soll, gestufte, sich steigernde Anforderungen zu stellen sein. Die Güte einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit bemisst sich – insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften – aber auch nach der Fähigkeit des Autors, fremden Gedankengängen und Inhalten aus wissenschaftlichen Vorarbeiten vor dem Hintergrund eigener Erkenntnis einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu verleihen. Erst mit diesem mit Zitaten bzw. Verweisen belegten Vorgang macht sich ein Verfasser fremde Gedanken und Resultate legitimerweise zu Eigen. Insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften beweist sich Originalität und Eigenständigkeit im experimentellen Design, der kritischen Analyse und Wertung der Daten und der Fähigkeit, in differenzierender Weise erhobene Ergebnisse in den wissenschaftlichen Kontext einzubinden.
2) Recherche und Zitation
Alle Qualifikationsarbeiten erfordern ein korrektes und sorgfältiges Recherchieren und Zitieren bzw. Verweisen. Durchgängig und unmissverständlich muss für den Leser erkennbar sein, was an fremdem geistigem Eigentum übernommen wurde. Was wörtlich und gedanklich entlehnt wird, muss deutlich erkennbar sein.
3) Einflüsse
In Qualifikationsarbeiten sollten stets alle (externen) Faktoren offen gelegt werden, die aus der Sicht eines objektiven Dritten dazu geeignet sind, Zweifel am Zustandekommen eines vollständig unabhängigen wissenschaftlichen Urteils zu nähren. Sinnvoll erscheint es auch, die Förderung eines Werkes durch Stipendien, Drittmittel oder wirtschaftliche Vorteile kenntlich zu machen.
4) Zuschreibung von Aussagen
Zu den Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens gehört, dass der Autor sorgfältig darauf achtet, zitierten Autoren keine Aussagen zu unterstellen, die diese nicht oder nicht in der wiedergegebenen Form gemacht haben.
5) Übersetzungen
Wer fremdsprachliche Texte selbst übersetzt, hat dies unter Benennung der Originalquelle kenntlich zu machen. Gerade bei einer ‚sinngemäßen Übersetzung‘ ist darauf zu achten, dass dem übersetzten Autor kein Text unterstellt wird, den er mit diesem Inhalt nicht geäußert hat. Wer sich auf Übersetzungen Dritter stützt, hat dies kenntlich zu machen.
6) Fachspezifisches Allgemeinwissen
Das tradierte Allgemeinwissen einer Fachdisziplin muss nicht durch Zitierungen bzw. Verweise nachgewiesen werden. Was zu diesem Allgemeinwissen zählt, ist aus der Sicht der jeweiligen Fachdisziplin zu beurteilen. Im Zweifel obliegt eine Entscheidung der Institution, die die angestrebte Qualifikation bescheinigt.
7) Plagiate und Datenmanipulation
Das Plagiat, also die wörtliche und gedankliche Übernahme fremden geistigen Eigentums ohne entsprechende Kenntlichmachung, stellt einen Verstoß gegen die Regeln korrekten wissenschaftlichen Arbeitens dar. Gleiches gilt für die Manipulation von Daten. Plagiate und Datenmanipulationen sind im Regelfall prüfungsrelevante Täuschungsversuche.
8) Eigene Arbeiten und Texte
Die Übernahme eigener Arbeiten und Texte verstößt dann gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis, wenn diese Übernahme in einer Qualifikationsarbeit nicht belegt und zitiert wird. Prüfungsordnungen können die Wiederverwertung desselben oder ähnlichen Textes desselben Verfassers ausschließen. Dies gilt insbesondere für Dissertationen.
9) ,Ghostwriting‘
Ein schwerwiegender Verstoß gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ist das Zusammenwirken des Verfassers mit einem Dritten, der Texte oder Textteile zu einer Qualifikationsarbeit beisteuert, die der Autor mit dem Einverständnis des Ghostwriters als eigenen Text ausgibt.
10) Mehrere Autoren
Bei gemeinschaftlichen Qualifikationsarbeiten ist der eigene Anteil des jeweiligen Autors dem Leser gegenüber deutlich zu machen. Dies schließt aus, dass jemand Autor sein kann, der selbst keinen ins Gewicht fallenden Beitrag zu einer Qualifikationsarbeit geleistet hat. Ehrenautorschaften oder Autorschaften kraft einer hierarchisch übergeordneten Position ohne eigenen substantiellen Beitrag sind grundsätzlich wissenschaftliches Fehlverhalten.
11) Doppelte Verantwortung
Die Verantwortung für die Einhaltung der Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens trägt in erster Linie der Verfasser einer wissenschaftlichen Qualifikationsarbeit. Aber auch den Betreuern und/oder den Prüfern kommt Verantwortung zu. Die Aufgabe der Betreuer ist es, den Prüflingen vor Beginn der Arbeit die Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens mitzuteilen und gegebenenfalls zu erläutern. Die Aufgabe der Betreuer und Prüfer ist es auch, Zweifeln an der Einhaltung der Grundregeln wissenschaftlichen Arbeitens bei einer Qualifikationsarbeit konsequent nachzugehen.“
Quelle: Albers u. a. (2012, S. 3-5).
Eine eingehende Betrachtung und Beschreibung dessen, was als wissenschaftliches Fehlverhalten gilt, finden Sie in der Handreichung „Zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten in den Hochschulen“, welche die Hochschulrektorenkonferenz bereits am 6. Juli 1998 in ihrem 185. Plenum allen Mitgliedshochschulen empfohlen hat, „ggf. in modifizierter Form – möglichst bald zu übernehmen bzw. in Kraft zu setzen“ (Hochschulrektorenkonferenz 1998, S. 3).
Was ist „Wissenschaftliches Fehlverhalten“?
„1. […] Als möglicherweise schwerwiegendes Fehlverhalten kommt insbesondere in Betracht:
a. Falschangaben
• das Erfinden von Daten;
• das Verfälschen von Daten, z.B.
– durch Auswählen und Zurückweisen unerwünschter Ergebnisse, ohne dies offenzulegen,
– durch Manipulation einer Darstellung oder Abbildung;
• unrichtige Angaben in einem Bewerbungsschreiben oder einem Förderantrag (einschließlich Falschangaben zum Publikationsorgan und zu in Druck befindlichen Veröffentlichungen).
b. Verletzung geistigen Eigentums
• in bezug auf ein von einem anderen geschaffenes urheberrechtlich geschütztes Werk oder von anderen stammende wesentliche wissenschaftliche Erkenntnisse, Hypothesen, Lehren oder Forschungsansätze:
• die unbefugte Verwertung unter Anmaßung der Autorschaft (Plagiat),
• die Ausbeutung von Forschungsansätzen und Ideen, insbesondere als Gutachter (Ideendiebstahl),
• die Anmaßung oder unbegründete Annahme wissenschaftlicher Autor- oder Mitautorschaft,
• die Verfälschung des Inhalts,
• die unbefugte Veröffentlichung und das unbefugte Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht sind.
c. Inanspruchnahme der (Mit-)Autorenschaft eines anderen ohne dessen Einverständnis.
d. Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich dem Beschädigen, Zerstören oder Manipulieren von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die ein anderer zur Durchführung eines Experiments benötigt).
e. Beseitigung von Primärdaten […], insofern damit gegen gesetzliche Bestimmungen oder disziplinbezogen anerkannte Grundsätze wissenschaftlicher Arbeit verstoßen wird.
2. Eine Mitverantwortung für Fehlverhalten kann sich unter anderem ergeben aus
• aktiver Beteiligung am Fehlverhalten anderer,
• Mitwissen um Fälschungen durch andere,
• Mitautorschaft an fälschungsbehafteten Veröffentlichungen,
• grober Vernachlässigung der Aufsichtspflicht.“
Quelle: Hochschulrektorenkonferenz (1998, S. 3f.).