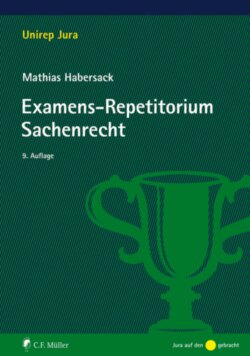Читать книгу Examens-Repetitorium Sachenrecht - Mathias Habersack - Страница 64
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Begriff und Rechtsnatur
Оглавление64
Aufgabe des dinglichen Rechts ist es, die Sache zumindest in bestimmter Hinsicht dem Berechtigten mit Wirkung gegenüber jedermann zuzuordnen. Allein die Existenz des dinglichen Rechts verschafft dem Berechtigten allerdings nicht zwangsläufig auch die tatsächliche Möglichkeit, von dem Herrschaftsrecht Gebrauch zu machen. So mag es sein, dass dem Eigentümer der Besitz an der Sache entzogen wird, ferner, dass das Grundbuch zu Unrecht eine Belastung des Grundeigentums verlautbart und somit der Grundeigentümer in seiner Möglichkeit, über sein Recht zu verfügen, beschränkt wird. In diesen und ähnlichen Fällen ist der Eigentümer darauf angewiesen, dass ihm die Rechtsordnung einen „Rechtsbehelf“ zur Verfügung stellt, der ihm die Beseitigung des die Ausübung seines Herrschaftsrechts beeinträchtigenden Zustands ermöglicht. Solche „Rechtsbehelfe“ bezeichnet man als dingliche Ansprüche; auch das BGB verwendet diesen Begriff, freilich nur in § 198 und damit an sehr versteckter Stelle.
65
Die Rechtsnatur dieser dinglichen Ansprüche erschließt sich, wenn man berücksichtigt, dass mit der Anerkennung eines dinglichen Rechts – Entsprechendes gilt für sonstige absolute Rechte – die Verpflichtung aller anderen Rechtssubjekte einhergeht, dieses Recht nicht zu beeinträchtigen[49]. Diese allgemeine Verpflichtung eines jeden Rechtssubjekts führt allerdings vor erfolgter Beeinträchtigung des geschützten Rechts noch nicht zur Entstehung eines konkreten und aktuellen Rechtsverhältnisses; mit dem absoluten Recht verbindet sich vielmehr ein zunächst nur latentes Rechtsverhältnis zwischen dem Inhaber des Rechts und „allen anderen“. Erst für den Fall, dass es zu einer Beeinträchtigung des Rechts durch ein Rechtssubjekt kommt, verdichtet sich das latente Rechtsverhältnis diesem Rechtssubjekt (dem „Störer“) gegenüber zu einem gewöhnlichen, konkrete Rechte und Pflichten erzeugenden Rechtsverhältnis, kraft dessen der Inhaber des dinglichen Rechts die Beseitigung der Beeinträchtigung, etwa die Herausgabe der Sache oder die Berichtigung des Grundbuchs, verlangen kann.
66
Man kann somit sagen, dass der dingliche Anspruch das dingliche Recht „verwirklicht“[50], indem er dem Inhaber des Herrschaftsrechts die ungestörte Sachherrschaft verschafft. Auf subjektive Voraussetzungen in der Person des Störers kommt es dabei nicht an. Dadurch, aber auch durch den Anspruchsinhalt, unterscheiden sich die dinglichen Ansprüche von den Ansprüchen aus Delikt. Auch für diese gilt zwar, dass sie die absolute Herrschaftssphäre des Eigentümers oder Inhabers eines „sonstigen“ Rechts gegenüber jedermann in der Weise absichern, dass das gegenüber jedermann bestehende latente Rechtsverhältnis bei Verwirklichung des Deliktstatbestands zu einem konkreten Rechtsverhältnis erstarkt (Rn. 65). Ganz abgesehen davon, dass nach § 823 Abs. 1 nicht nur Sachenrechte geschützt sind, geht allerdings der Zweck dieser Vorschrift über die Verwirklichung des subjektiven Rechts hinaus und besteht allgemein in dem Schutz des Integritätsinteresses[51].
67
Die Existenz der gegenüber jedermann gerichteten Ansprüche macht zugleich deutlich, dass dingliche Rechte kein Rechtsverhältnis zwischen dem Rechtsinhaber und der Sache begründen[52]. Wie Rechte im Allgemeinen richten sich vielmehr auch die Rechte des Eigentümers gegen andere Rechtssubjekte. Das „Eigentum an einer Sache“, von dem etwa in §§ 873 Abs. 1, 929 S. 1 die Rede ist, ist deshalb nichts anderes als die Verkörperung der Befugnisse des Eigentümers gegenüber allen anderen Rechtssubjektiven in Bezug auf die Sache als den Gegenstand des Rechts.