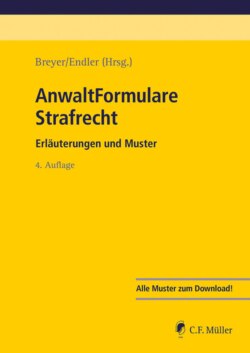Читать книгу AnwaltFormulare Strafrecht - Matthias Klein - Страница 397
На сайте Литреса книга снята с продажи.
E. Vermögensabschöpfung
ОглавлениеLiteratur
Breyer, Neue Möglichkeiten für Geschädigte von Eigentums- und Vermögensdelikten, VE 2017, 148; Janssen, Gewinnabschöpfung im Strafverfahren, 2007; Kempf/Schilling, Vermögensabschöpfung, 2007; Podolsky/Brenner, Vermögensabschöpfung im Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren, 5. Auflage 2012; Rönnau, Vermögensabschöpfung in der Praxis, 2015; Gebauer, Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, ZRP 2016, 101; Maciejewski/Schumacher, Die steuerrechtliche Behandlung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, DStR 2016, 2553; Mansdörfer, Die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung – von der Rückgewinnungshilfe zum Entschädigungsmodell, jM 2017, 122.
240
Die Vermögensabschöpfung spielt eine immer größer werdende Rolle im Rahmen der Strafverfolgung. Dem Täter sollen die „Früchte“ seiner Tat nicht belassen werden.[1] Hierbei gilt insbesondere die Vorstellung, dass der Wegfall des Vermögensvorteils aus einer Tat aufgrund des geltenden Bruttoprinzips mitunter eine weitaus höhere Strafe sein kann als die eigentliche materielle Strafe. Weiterhin werden durch die Vermögensabschöpfung nicht nur Ansprüche Geschädigter gesichert, sondern sie trägt im Millionenbereich zu den Haushalten der Länder bei. Laut Jahresbericht „Finanzermittlungen“ für das Jahr 2012 des LKA Baden-Württemberg betrug die sichergestellte Summe in diesem Bundesland im Jahre 2012 ca. 27,2 Mio. EUR.[2] Das Instrument der Vermögensabschöpfung wird zwischenzeitlich nicht mehr nur in großen Wirtschaftsstrafverfahren, sondern auch im Bereich der allgemeinen Kriminalität angewandt. Zum 1.1.2007 ist das Gesetz zur Stärkung der Rückgewinnungshilfe in Kraft getreten,[3] das zwar keine komplette Neuregelung der Vermögensabschöpfung, jedoch einige wichtige Änderungen im Bereich der Geltung vorläufiger Maßnahmen sowie der Rückgewinnungshilfe gebracht hat.
Zum 1.7.2017 ist das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung in Kraft getreten, das die bislang umfassendste Reform darstellt. Ziel war es, die Regelungen zu vereinfachen und Zweifelsfragen zu lösen. Insbesondere sollten schwierige zivilrechtliche Fragen vermieden werden. Auch das bisherige Institut der Rückgewinnungshilfe ist erheblich vereinfacht worden, was dem Opferschutz Rechnung tragen soll. Ein wichtiges Ziel der Reform war es, das „Windhundrennen“ im Rahmen der Rückgewinnungshilfe abzuschaffen, wonach derjenige Geschädigte, der am schnellsten war, entschädigt wurde, während andere möglicherweise leer ausgingen.
241
Spätestens seit der Einführung des Bruttoprinzips (siehe Rn 269) kann die Vermögensabschöpfung die Interessen des Mandanten weit mehr beeinträchtigen als die eigentliche Strafe. Für Vertreter von Geschädigten ergeben sich vielfach Möglichkeiten, die Rückgewinnungshilfe durch die Staatsanwaltschaft zu nutzen und dadurch ein langwieriges Zivilverfahren, insbesondere hinsichtlich der Vollstreckung, zu vermeiden.
242
Einzige Erklärung für die bislang auch in der Praxis feststellbare Zurückhaltung der Verteidiger war die teilweise unübersichtliche Regelung durch den Gesetzgeber. Bei einer systematischen Vorgehensweise wurden jedoch auch für das bislang geltende Recht schnell Strukturen erkennbar, die dann auch eine effektive Verteidigung auf diesem Gebiet erlaubten. Durch die genannte Reform zum 1.7.2017 wurde eine erhebliche Vereinfachung erzielt.
243
Rechtsprechung zu der nunmehr in Kraft getretenen Reform lag zum Zeitpunkt der Neuauflage dieses Werks noch nicht vor. Soweit die Reform Teile der bisherigen Regelung unangetastet gelassen hat, wurde jedoch auf die nach alter Rechtslage ergangene Rechtsprechung zurück gegriffen.
Bei der Darstellung wurde teilweise bewusst auch die Rechtslage bis zum 1.7.2017 mit dargestellt, um zu verdeutlichen, wo die Änderungen durch die Reform liegen.
Wichtig
Bei dem Inkrafttreten zum 1.7.2017 handelt es sich um eine Stichtagsregel. Das bedeutet gem. der Übergangsregelung des Art. 316h EGStGB n.F., dass das neue Recht auch auf Taten Anwendung findet, die vor seinem Inkrafttreten begangen wurden. § 2 Abs. 5 StGB, der einen Vorrang des milderen Rechts vorsieht, gilt nicht. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn bis zum 1.7.2017 bereits eine Entscheidung über eine Einziehung ergangen ist.
Kapitel 2 Verteidigung im Ermittlungsverfahren › E. Vermögensabschöpfung › I. Die Einziehung von Taterträgen (früher: Verfall)