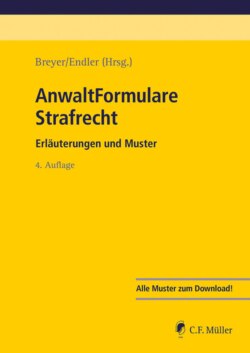Читать книгу AnwaltFormulare Strafrecht - Matthias Klein - Страница 405
На сайте Литреса книга снята с продажи.
e) Umfang und Art des erlangten Etwas
Оглавление261
Unter dem erlangten Etwas ist all das zu verstehen, dem einen Vermögenswert beigemessen wird. Bloße Besitzerlangung, ersparte Aufwendungen sowie Befreiungen von Verbindlichkeiten sind ebenfalls ausreichend, so dass letztlich so gut wie keine Fälle denkbar sind, in denen ein Vermögenswert verneint werden könnte.
262
Erlangt hat der Täter den Gegenstand, sobald er, wenn auch nur für einen kurzen Zeitpunkt, die tatsächliche Verfügungsgewalt darüber ausüben kann.[39] Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht (z.B. nicht versteuerte Zigaretten bei Hinterziehung von Verbrauchssteuern), können nicht nach §§ 73 ff. StGB eingezogen werden, da sie nicht „durch“ die Tat erlangt worden sind.[40]
263
Nach der neuen Reform darf nicht mehr nur diejenige Rechtsposition, die unmittelbar aus der Tat erlangt wurde, eingezogen werden.[41] Vielmehr erstreckt sich die Einziehung auf jede kausal durch die Tat erlangte Bereicherung (§ 73 Abs. 1 S. 1 StGB). Der Täter oder Teilnehmer muss den Vermögensgegenstand als Gegenleistung für die Tatbegehung, nicht nur bei Gelegenheit der Tat,[42] erlangt haben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Vermögensgegenstand keinem Tatbestandsmerkmal des verletzten Gesetzes entsprechen muss, sondern aus der Tat im prozessualen Sinne (§ 264 StPO) stammen muss.[43]
264
Dennoch gelten keine Beweiserleichterungen, so dass es nicht ausreichend ist, die Einziehung (der Höhe nach) unter Zugrundelegung eines Sicherheitsabschlags anzuordnen. Der Verteidiger sollte Wert darauf legen, dass dem Mandanten nachgewiesen wird, aus welcher konkreten Tat dieser den Vermögensgegenstand erlangt hat. Beweiserleichterungen bestehen nur für die Anordnung der erweiterten Einziehung.
265
Der Verteidiger sollte genau prüfen, welchen Vermögensgegenstand/-wert sein Mandant unmittelbar durch die Tat erlangt hat. Wird die Unterscheidung zwischen der Bestimmung des unmittelbar erlangten Etwas und des genauen Umfangs nicht exakt vollzogen, so kann der Mandant möglicherweise einen Vermögensnachteil erleiden, der bei genauer Prüfung nicht entstanden wäre.
266
Der BGH hatte in einem von ihm entschiedenen Fall[44] den Umfang des erlangten Etwas zu prüfen. Der Angeklagte hatte durch Bestechung eine Änderung des Bebauungsplans erreicht. Hierdurch waren seine Grundstücke im Wert gestiegen. Danach hatte der Angeklagte die Grundstücke verkauft und einen Verkaufserlös erzielt. Der BGH widersprach der Auffassung der Staatsanwaltschaft, der gesamte Verkaufserlös sei als erlangtes Etwas anzusehen. Vielmehr sei durch die Änderung des Bebauungsplans eine Gewinnchance des Angeklagten entstanden, die jedoch nur einen Wert in der Differenz zwischen ursprünglichem Erwerbspreis und Verkaufserlös habe.[45]
267
Gerade im Bereich der Ordnungswidrigkeiten kommt es häufig auf die Frage des Erlangten an (z.B. Überladung, Sonntagsfahrverbot). Hier ist für die Frage, ob nur ersparte Aufwendungen einzuziehen sind, zu unterscheiden, ob eine Genehmigungsfähigkeit vorliegt oder nicht.[46]
268
Bis zum Jahre 1992 durfte der Täter seine Aufwendungen, die er hatte, um den rechtswidrigen Vermögensvorteil zu erlangen, von seinem erlangten Etwas abziehen (Nettoprinzip). Dies wird durch § 73d StGB verhindert.[47] Es gilt das Bruttoprinzip. Erlangt wird demnach der Erlös, nicht nur der Gewinn.[48] Hierdurch erfolgt eine Beweiserleichterung,[49] da die Ermittlungen zu den Aufwendungen des Täters selbstverständlich sehr umfangreich ausfallen mussten. Der BGH geht davon aus, dass das Bruttoprinzip für alle Deliktsarten Geltung hat. Dies gelte auch für solche, die üblicherweise hohe Aufwendungen des Täters voraussetzten.[50] In der Literatur wird teilweise die Ansicht vertreten, das Bruttoprinzip führe vielfach zu ungerechten Ergebnissen, so dass es dann nicht anwendbar sei, wenn Beweisschwierigkeiten tatsächlich nicht bestehen.[51] Die Rechtsprechung hat dennoch bislang an der Anwendbarkeit des Bruttoprinzips für sämtliche Fälle und alle Deliktsarten festgehalten.[52] Dies wird damit begründet, dass bei Anwendung des Nettoprinzips eine wirtschaftlich risikolose Tatbegehung ermöglicht werde. Unbillige Ergebnisse können im Übrigen über § 459g StPO (Vollstreckungshindernis) vermieden werden.[53]
Nach der Neufassung des § 73d StGB erfolgt die Bestimmung des erlangten Etwas in zwei Stufen:[54] Eine Prüfung ist nur dann erforderlich, wenn das Erlangte nicht mehr originär vorhanden ist (Fälle des § 73c Abs. 1 StGB).
Zunächst erfolgt eine rein gegenständliche Betrachtung. Erlangt sind danach alle Vermögenswerte, die aus der Verwirklichung des Tatbestands in irgendeiner Phase des Tatablaufs zugeflossen sind. Eine Unmittelbarkeit zwischen Tat und Bereicherung ist nicht erforderlich.
§ 73d Abs. 1 StGB konkretisiert den Rechtsgedanken des § 817 S. 2 BGB für die Vermögensabschöpfung.[55] Es soll erreicht werden, dass Investitionen in ein verbotenes Geschäft verloren sind. Aufwendungen sind demnach (in einem zweiten Schritt) zu berücksichtigen, wenn sie nicht bewusst und willentlich zur Vorbereitung oder Begehung der Straftat eingesetzt wurden (gleicher Lebenssachverhalt und innerer Zusammenhang mit dem Erlangten). Sind bei einem Vertrag z.B. auch nicht zu beanstandende Leistungen erbracht worden, können diese in Abzug gebracht werden. Bei fahrlässiger Begehung besteht kein Abzugsverbot.
Eine Rückausnahme gilt für den Fall, dass es sich um die Erfüllung einer Verbindlichkeit gegenüber dem Verletzten handelt (§ 73d Abs. 1 S. 2 StGB). Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn der Anspruch des Verletzten erloschen ist (§ 73e Abs. 1 StGB).