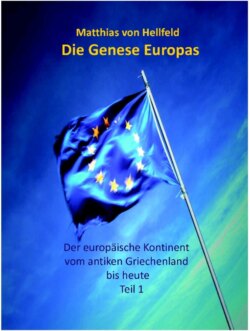Читать книгу Die Genese Europas - Matthias von Hellfeld - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Griechenland im dauerhaften Kriegszustand
ОглавлениеCharakteristisch für die Geschichte des antiken Griechenlands ist der dauerhafte Kriegszustand, in dem sich die Städte untereinander befinden. Und wenn sie nicht gegeneinander antreten, dann kämpfen sie gemeinsam gegen einen äußeren Feind. Im fünften vorchristlichen Jahrhundert heißt dieser äußere Feind Persien, ein Land, das an Kriegern und militärischem Potenzial weit überlegen ist. Persien erstreckt sich von Indien, dem Hindukusch, den asiatischen Wüstengegenden, dem Kaukasus, dem kaspischen und dem Schwarzen Meer, bis Byzanz, Thrakien und Makedonien; in der arabischen Welt herrschen die Perser über Libyen, Ägypten und Syrien. Der Konflikt mit den Persern beginnt mit dem Aufstand der Ionier, einem der alten griechischen Stämme, die an der kleinasiatischen Küste Persiens gegenüber dem griechischen Festland leben. Sie wehren sich gegen die persische Herrschaft, die ihnen Autonomie verweigert und das Leben mit Handelshemmnissen schwer macht. Der Aufstand der Ionier beginnt um 500 v. Chr. und wird nach der Schlacht bei Lade in der Nähe von Milet im Jahr 494 v. Chr. von den Persern blutig niedergeschlagen.
Trotzdem stellt der Aufstand der Ionier eine Herausforderung für das riesige Reich der persischen Achämeniden dar. Denn die soziale Lage an der kleinasiatischen Küste ist für das Weltreich vor allem deshalb ein Problem, weil der Aufstand Persien an seiner sensibelsten Stelle in Frage stellt – nämlich im ägäischen Meer gegenüber dem griechischen Festland. Die Ionier bekommen Unterstützung von Athen und einigen anderen griechischen Städten auf dem Festland, was den persischen König Darios I. (550 – 486 v. Chr.) dazu bringt, eine Strafexpedition gegen Griechenland zu unternehmen.
Als 492 v. Chr. ein persisches Heer nach Thrakien und Makedonien aufbricht, sieht es anfangs auch so aus, als handele es sich um eine Expedition zur Wiederherstellung der persischen Autorität. Zwei Jahre später wird daraus aber eine Strafaktion gegen Athen und Eritrea, die den Aufstand der Ionier unterstützt haben. Die Konfrontation beginnt im Sommer 490 v. Chr., nachdem die persische Flotte aufgebrochen ist, um die beiden Städte abzustrafen und gleichzeitig die „Errichtung einer persischen Oberhoheit in Griechenland“ ins Werk zu setzen, wie es der Althistoriker Hermann Bengtson formuliert hat. Sparta soll isoliert und die übrigen Städte in kleine Gruppen gespalten werden. Aber der Plan misslingt, denn die Athener suchen den Kampf nicht in Athen wie die Perser erwartet haben, sondern in Marathon. Ein kühner Entschluss, der im Falle einer Niederlage Athen ungeschützt lässt. Aber die Athener haben das Kriegsglück auf ihrer Seite. Der Sieg in der Schlacht von Marathon 490 v. Chr. gibt moralischen Auftrieb und die Hoffnung, trotz militärischer Unterlegenheit eine Chance in diesem ungleichen Kräftemessen zu haben. Der Nachwelt ist dieser Kampf wegen eines Mannes in Erinnerung geblieben, der die Schlacht zwar überlebt, die nachfolgende Strapaze aber nicht überstanden hat. Die Kunde von diesem kaum erwarteten Sieg bringt Pheidippides nach Athen. Nach rund 42, im Laufschritt zurückgelegten Kilometern erreicht er den „Areopag“, wo der oberste Rat tagt, und überbringt mit letzter Kraft die Siegesnachricht. Seine Botschaft löst eine heftige Jubelfeier aus, er selbst bricht wegen Überanstrengung tot zusammen.
Dieser Geschichte könnte es übrigens genauso ergehen wie vielen anderen: Sie könnte erfunden sein. Nach der Überlieferung durch Plutarch (45 – 125) könnte es sein, dass Pheidippides ursprünglich nach der Schlacht von Marathon 245 Kilometer nach Sparta gelaufen ist, um die Spartaner zum Kampf gegen die Perser zu überreden. Sein Name sei auf den legendären Boten von Marathon nur übertragen worden. Dieter Eckart hat das Ende Oktober 1987 in FAZ so zusammengefasst:
„Der antike Marathon-Läufer ist ein rundum tragischer Held: Er hieß nicht nur nicht Pheidippides, er ist nicht nur nicht von Marathon nach Athen gelaufen, er ist dort nicht nur nicht tot zusammengebrochen, es hat ihn nicht einmal gegeben. Er ist eine Erfindung viel später Geborener.“
Aber auch das lässt sich nicht mit Sicherheit beweisen.
Nach der Schlacht von Marathon ist die Gefahr nur fürs erste gebannt, denn den Griechen bleibt nicht verborgen, dass der neue persische König Xerxes I. (519 – 465 v. Chr.) Vorbereitungen für einen weiteren Vorstoß nach Griechenland betreibt. Diese Nachricht setzt in Athen den weiteren Flottenausbau in Gang. Themistokles kann sich durchsetzen und die Athener überzeugen, es auf dem Wasser mit den Persern aufzunehmen. In Windeseile wird dieser Beschluss in die Tat umgesetzt. Gleichzeitig dringen immer neue Nachrichten von den Kriegsvorbereitungen der Perser nach Athen, die die Griechen in Angst versetzen. Xerxes I. hat 486 v. Chr. die Nachfolge seines Vaters Dareios I. angetreten und an dessen Totenbett versprochen, Griechenland zu erobern. Jetzt will er dieses Versprechen offenbar in die Tat umsetzen. 482 v. Chr. sind die Vorbereitungen abgeschlossen, sie stellen alles in den Schatten, was man sich bis dahin hatte ausmalen können. Zeitgenossen attestieren Xerxes I. Größenwahn und einen labilen Charakter, der sich nicht selten in außergewöhnlicher Brutalität zeige. Erstaunlich sind jedenfalls die gigantischen Bauwerke, die Xerxes I. beauftragt: Um seine Truppen schneller transportieren zu können, lässt er einen Kanal durch die Halbinsel Athos stechen – den Xerxes-Kanal -, baut eine Brücke über den Hellespont und eine weitere über den Fluss Strymon. Auch das Ausmaß seines Heeres sprengt die damalige Vorstellungskraft. Selbst wenn die Zahl nicht exakt nachprüfbar und sie wahrscheinlich etwas übertrieben ist, soll der Perserkönig mehr als 100.000 Soldaten mit sich geführt haben. Jedenfalls deutet alles darauf hin, dass Xerxes I. nicht nur Rache für die Niederlage von Marathon will. Er hat einen Eroberungskrieg zunächst gegen Griechenland und dann gegen den europäischen Südosten im Sinn – für alles andere wäre sein Heer überdimensioniert!
An den Thermopylen kommt es im August 480 v. Chr. zur nächsten Schlacht der Griechen gegen die Perser. Von den Thermopylen hat man den direkten Zugang zum griechischen Festland und der Weg nach Athen ist frei. Das Kommando bei den Griechen führt der spartanische König Leonidas (ca. 420 – 480 v. Chr.). Da sich der Stadtstaat auf dem Peloponnes von den Persern ebenso bedroht fühlt, sind Sparta und weitere griechische Städte einem gemeinsamen griechischen Bündnis beigetreten. Aber die Zusammenarbeit steht anfangs unter keinem guten Stern, denn offenbar gibt es einen Verrat im Lager der Griechen, der den Persern die Einkesselung der griechischen Truppen an den Thermophylen ermöglicht. Nach drei Tagen ist die griechische Niederlage unabwendbar und Leonidas lässt zum Rückzug blasen. Die Niederlage ist heftig und fordert einen hohen Blutzoll auf Seiten der Griechen. Die Kunde von der Niederlage löst in Athen Panik aus – der Weg nach Athen ist frei und die Bürger in höchster Sorge vor einer persischen Invasion des Festlands.
480 v. Chr. wird das Jahr der Entscheidung und die soll in einer Seeschlacht fallen, zu der Themistokles die Athener Strategen überredet hat. Wie Recht er mit der Einschätzung hat, dass das riesige persische Heer in einer offenen Feldschlacht nicht zu besiegen sei, hatte sich ja an den Thermophylen erwiesen. Dort ist es nur zwei Tage gelungen, die Perser aufzuhalten. Danach ist die persische Übermacht durchgebrochen und in ein Land vorgestoßen, das von den Griechen weitgehend geräumt ist. Viele Menschen sind in wilder Panik aus ihren Dörfern gestürmt und haben ihr Heil in der Flucht gesucht. Xerxes I. aber kennt nur ein Ziel: Athen. Ist erst die mächtigste Stadt vernichtet, wird auch der Widerstandswille seiner überlebenden Bewohner gebrochen sein. In Athen angekommen, besetzt und verwüstet er die weitgehend verlassene Stadt – trotzdem: Es soll eine Warnung für all jene sein, die sich der persischen Herrschaft widersetzen würden. Währenddessen haben sich die Griechen auf die entscheidende Seeschlacht in der Meerenge vor der Insel Salamis westlich von Athen vorbereitet. Dies ist ihre letzte Chance. Würden sie diese Schlacht verlieren – das wissen sie – ist das Ende des freien Griechenlands besiegelt. Nach zwölf Stunden ist die Seeschlacht von Salamis mit einem Sieg der Griechen beendet. Der Verlauf der Schlacht ist nicht genau rekonstruierbar. Offenbar haben die Griechen mit kleinen und in der Bucht besser manövrierbaren Booten die großen persischen Schiffe wieder und wieder gerammt, bis sie gesunken sind. Der Siegeszug des persischen Königs Xerxes I. ist jedenfalls im Jahr 480 v. Chr. gestoppt.
Im Anschluss an diesen nicht erwarteten Sieg der Griechen werden die persischen Truppen in einige Folgekämpfe verwickelt, bis 478 v. Chr. die persische Vorherrschaft an der kleinasiatischen Küste gegenüber von Griechenland schließlich beendet ist. Ein Jahr später wird der attisch-delischen Seebund gegründet, mit dem Athen zur Hegemonialmacht Griechenlands aufsteigt. Mit diesem Bündnis sind sämtliche Küstenregionen des ägäischen Meeres bis hoch zum Bosporus in einem antipersischen Bündnis. Aber gleichzeitig birgt diese Allianz auch den Nagel zum eigenen Sarg, denn mit dem attisch-delischen Seebund entsteht der so genannte „Dualismus“ in Griechenland zwischen Athen und Sparta, der wenig später in einen blutigen Bruderkampf münden wird. 449 v. Chr. schließen Griechen und Perser den Kalliasfrieden. Auf Athener Seite verhandelt der Diplomat Kallias (500 – 432 v. Chr.) auf Seiten der Perser König Artaxerxes I. (ca. 500 – 424 v. Chr.). Wenn den Quellen getraut werden kann, was einige Historiker bezweifeln, dann haben sich beide Seiten auf eine Autonomie für die griechischen Städte und Enklaven an der kleinasiatischen Küste geeinigt. Persische Truppen dürfen sich außerdem nur in einer bestimmten Entfernung von diesen Orten aufhalten, was durch regelrechte Sperrzonen für persische Schiffe in der Ägäis gewährleistet werden soll. Als Gegenleistung verpflichtet sich Athen das Perserreich zu respektieren.
In den Augen der Griechen ist das drohende Schicksal der Versklavung in Persien abgewendet und der Despotismus, der den Persern unterstellt worden ist, vom griechischen Festland ferngehalten. Aber es gibt auch eine welthistorische Perspektive, die für den Fortgang der Geschichte von Bedeutung ist. Vermutlich stellt der griechische Abwehrkampf gegen die persischen Invasoren – wie nur wenige andere Daten in der Weltgeschichte – eine Wegmarke dar. Erst durch den Sieg der Griechen hat sich Europa zu dem entwickeln können, was es heute ist. Bei einer Niederlage hätte es für Xerxes I. und seine Nachfolger keine Barrieren mehr gegeben: Sie hätten ihr Reich immer weiter nach Westen – also nach Kontinentaleuropa – ausdehnen können. Dabei wäre – aller Voraussicht nach – die griechische Kultur verschüttet worden, die erst das römische Reich und später die mittelalterlichen und neuzeitlichen europäischen Staaten maßgeblich beeinflusst hat. Vielleicht wäre es auch nicht zum Imperium Romanum gekommen, das rund drei Jahrhunderte später eine neue Zivilisation im südlichen und westlichen Europa aufbauen sollte. Möglicherweise hieße Europa heute „Westasien“, deren Bewohner vielleicht Muslime oder jedenfalls nicht unbedingt Christen wären. Es ist vielleicht nicht zu weit hergeholt, wenn man sagt, dass die griechischen Kämpfer von Marathon oder Salamis knapp fünfhundert Jahre vor Christi Geburt die „Voraussetzungen“ dafür geschaffen haben, dass die Menschen des Abendlandes ihre geistige Unabhängigkeit und Freiheit erhalten haben – so lautet etwas verknappt der Gedanke von Herrmann Bengtson.