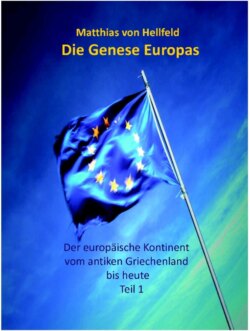Читать книгу Die Genese Europas - Matthias von Hellfeld - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Solon: Reform in Athen
ОглавлениеZu Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr. wird Athen von sozialen Unruhen erschüttert. Die Angehörigen der Aristokratie fürchten um ihre Privilegien, sie sorgen sich vor sozialen Umwälzungen, selbst eine Revolution der weitgehend verarmten Bevölkerung scheint nicht mehr ausgeschlossen. Als gleichzeitig viele nicht-adlige, aber freie Bürger mehr Rechte in der politischen Mitbestimmung fordern, muss ein Kompromiss gefunden werden. Für die Oberschicht ist eine Revolution oder gar eine Militärdiktatur das größere Übel, also stimmen sie schließlich 594 v. Chr. der Wahl von Solon (640 – 560 v. Chr.) zum Archonten – dem höchsten Beamten in der Stadt – zu. Eine Reform aus seiner Hand kann nicht so schlimm sein, schließlich gehört Solon selbst dem Adel an.
Aber sie haben sich getäuscht, denn unmittelbar nach Beginn seiner Amtszeit löst Solon die seit 621 v. Chr. geltenden, sprichwörtlich „drakonischen“ Gesetze des Drakon auf und reformiert den Stadtstaat Athen. Zunächst werden die Bauern entschuldet, nicht ohne massiven Druck auf die Gläubiger auszuüben, der Entschuldung auch zuzustimmen. Dann werden Maße und Gewichte vereinheitlicht, wodurch Waren überall miteinander verglichen werden können. Heute nennt man das Markttransparenz. Anschließend verbietet Solon die so genannte „Schuldknechtschaft“. Das „Leihen auf den Körper“ ist bis dahin oft der letzte Ausweg für in Not geratene Bauern, bedeutet aber Sklaverei. Solon legt außerdem eine Höchstgrenze bei Grundbesitz fest und reformiert das Gerichtswesen.
Anschließend legt er eine Verfassung vor, die die Beteiligung aller vier Klassen in Athen festlegt. Die Klassen sind nach Einkommen – gemessen in Scheffel – aufgeteilt; in der ersten finden sich Großgrundbesitzer in der vierten Landarbeiter wieder. Sie haben unterschiedliche Stimmrechte: Gemeinsam wählen sie die Volksversammlung, die das alleinige Recht hat, die obersten Richter des Volksgerichts zu bestimmen. Die drei ersten Klassen dürfen den „Rat der 400“ wählen und die erste Klasse zudem über die Wahl der Archonten mitbestimmen. Die Volksversammlung entsendet 400 Männer in den „Rat der 400“. Da diese Funktion ein Ehrenamt ist, kann es nur von Reichen, also dem Adel oder der Oberschicht angehörenden Personen wahrgenommen werden. Wichtigste Funktion des Rates ist die Bestimmung der Archonten, den höchsten und wichtigsten Beamten in Athen. Der „Rat der 400“ schickt Vorschläge und Abstimmungsvorlagen an die Archonten, die teilweise aus der Volksversammlung kommen, teilweise von ihnen selbst. Schließlich gibt es den Areopag, der sich aus ehemaligen Archonten zusammensetzt. Der Areopag ist eine Art Oberaufsicht über die öffentlichen Belange Athens. Zudem obliegt dem Areopag die so genannte „Blutgerichtsbarkeit“, also Strafverfahren, die mit Tod oder körperlichen Verstümmelungen geahndet werden können. Areopag-Urteile sind unwiderruflich, haben also eine große Bedeutung. Später wird der Areopag entmachtet und auf sakrale oder heidnisch-religiöse Aufgaben beschränkt.
Solon gilt als einer der Wegbereiter der „attischen Demokratie“ – in der Antike hat er den Ruf einer der „sieben Weisen“ des Landes zu sein, aber es gibt nur wenige Überlieferungen über ihn, so dass man mit dem Urteil über sein Wirken vorsichtig sein sollte. Trotzdem hat er es zu Weltgeltung gebracht, denn er ist der erste, der
[Schaubild 2: Verfassung von Solon 594 v. Chr.]
in einer Verfassung den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Solon hat zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit versucht, das Individuum zu emanzipieren. Er hat diese Idee in die Welt gesetzt und damit eine kulturelle Entwicklung angestoßen, die den Menschen und seine Lebenswelt zur Richtschnur des gesellschaftlichen Handelns macht. Der Mensch und sein Leben stehen im Mittelpunkt und nicht die Interessen der Machthaber oder jener, die sich die politische und ökonomische Pfründe bis dahin gegenseitig zugeschoben haben. Jeder Bürger soll teilhaben am Gemeinwesen, nicht nur einige. Dieser Grundsatz gilt bis heute für die europäische Verfassungsgeschichte. Aber so groß Solons Eifer auch ist, es bleibt festzuhalten, dass von wirklicher Gleichheit in modernem Sinne im Jahr 594 v. Chr. nicht die Rede sein kann. Die Reform des Solon gilt nämlich nicht für Frauen, Sklaven und Fremde. Ihnen werden pauschal sämtliche Rechte einer beginnenden politischen Partizipation vorenthalten.