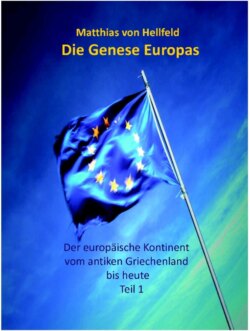Читать книгу Die Genese Europas - Matthias von Hellfeld - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Alexander „der Große“
ОглавлениеNach dem Ende des Peloponnesischen Krieges 404 v. Chr. hat Sparta von Athen die Rolle der Hegemonialmacht auf dem griechischen Festland übernommen. Aber die spartanische Herrschaft ist außergewöhnlich hart – ja brutal. Sie beschwört Widerstand und lokale Aufstände herauf. Auch Persien mischt in Hellas wieder mit, aber der persische König Artaxerxes II. (ca. 453 – 359 v. Chr.) unterstützt jetzt jene, die sich gegen Sparta erheben. Der entscheidende Sieg gegen Sparta gelingt aber trotz einiger persisch-griechischer Bündnisse nicht. Inzwischen ist der makedonische König Philipp II. im Nordwesten Griechenlands zu einem der entscheidenden Machtfaktoren aufgestiegen. Er ist weniger ein griechischer Held als vielmehr ein Eroberer, der die Griechen dazu aufruft, gemeinsam gegen Persien anzutreten. Philipp II. bekommt zwar das Oberkommando der griechischen Streitmacht, nicht aber den Krieg. Denn kurz bevor der beginnen kann, wird er ermordet.
Doch der Krieg ist nur aufgeschoben, denn mit seinem Sohn Alexander betritt nun eine Figur die historische Bühne, die es etwa 2.500 Jahre später sogar zum Titelhelden eines Hollywood-Spektakels bringen sollte. Alexander will den Plan seines Vaters vollenden und gegen die größte Territorialmacht des Erdballs, Persien, zu Felde ziehen. Die Situation ist für den Makedonier nicht schlecht, denn die Perser sind in diesen Jahren mit inneren Problemen beschäftigt. Vier Jahre zuvor - 338 v. Chr. - ist der persische König Artaxerxes III. (390 – 338 v. Chr.) von einem einflussreichen Eunuchen namens Bagoas (ca. 400 – 336 v. Chr.) vergiftet worden. Unmittelbar danach entstehen Streitigkeiten um die Neubesetzung des Throns, in denen Dareios III. (380 – 330 v. Chr.) als entfernt Verwandter schließlich das Rennen macht. Das Land hat zwar nun einen neuen König, bleibt aber innenpolitisch instabil. Aber trotz dieser Situation hat der persische König die größte Streitmacht seiner Zeit.
Alexander schreckt das nicht. Er hat seinem Vater auf dem Sterbebett versprochen, gegen die Perser einen Rachefeldzug wegen der Zerstörung des griechischen Festlands im Jahr 480 v. Chr. durchzuführen. Nach dem Tod seines Vaters kann ihn nichts davon abhalten, den Plan in die Tat umzusetzen. Im Sommer 334 v. Chr. macht er sich mit rund 35.000 Kämpfern auf und überschreitet die Dardanellen. Es kommt zu mehreren Schlachten, die Alexander siegreich beendet. Ein Jahr später – 333 v. Chr. - erreicht sein Heer die Stadt Gordion, etwa 80 Kilometer westlich von Ankara, wo Alexander angeblich einen Knoten mit dem Schwert durchschlagen haben soll, nachdem ein Orakel ihm prophezeit hat, nur wer den „Knoten von Gordion“ durchschlagen kann, gewinne die Herrschaft über Asien. Aus dieser Legende stammt der bis heute oft zitierte „gordische Knoten“, den man zerschlagen müsse, um ein Problem zu lösen. Gestärkt von diesem Orakelspruch schlägt Alexander 333 v. Chr. mit einem militärischen Geniestreich das überlegene persische Heer in der Schlacht bei Issos.
In den kommenden sieben Jahren erobert Alexander Phönizien, Ägypten, die Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, Persien, Afghanistan und die heute zu Russland gehörenden Staaten Turkmenistan, Tadschikistan, Usbekistan und Anfang 326 v. Chr. Teile von Indien. Weite Teile dieser Regionen sind für die Griechen „terra incognita“ – also „unbekanntes Land“. Der Weg, den Alexander mit seinem Heer zurückgelegt hat, ist beeindruckend. Zu Fuß oder auf dem Rücken ihrer Pferde, immer wieder in die kriegerische Auseinandersetzungen mit den einheimischen Völkern verwickelt, konfrontiert mit fremden Kulturen und Lebensweisen und einer mitunter brutalen Natur ausgesetzt, überwinden sie viele Tausend Kilometer durch unbekanntes Land. Auf diesem Weg gründet Alexander mehr als 70 Städte mit dem Namen „Alexandria“, von denen die größte und bedeutendste heute die gleichnamige ägyptische Metropole ist.
Gleichzeitig verbreiten Alexander und seine Krieger die griechische Philosophie und die griechische Lebensweise weit über den eigentlichen griechischen Kulturraum hinaus. Er überwindet Sprachgrenzen und hinterlässt so bis zum Himalaya Spuren der griechischen Kultur. Natürlich sind die Städtegründungen auch unter militärischen Aspekten erfolgt: Sie sollen den Nachschub sichern und seinem Heer Rückzugsmöglichkeiten bieten, wenn die mit der Eroberung des griechischen Weltreichs verbundenen Strapazen zu groß geworden sein sollten. 326 v. Chr. sind sie zweifellos zu groß geworden, die Soldaten meutern und zwingen Alexander zum Rückzug nach Griechenland. Während des Rückwegs nach Hellas erreichen sie in der Nähe des heutigen Bagdad am östlichen Ufer des Tigris die Stadt Opis. Der Überlieferung nach soll Alexander hier seinen Traum von der Verbrüderung aller von ihm unterworfenen Völker verkündet haben. Zudem soll er eine umfassende Friedensordnung formuliert haben, in der die griechische und die orientalische Kultur miteinander verschmelzen.
Alexander stirbt am 10. Juni 323 v. Chr. im Alter von nur 33 Jahren an den Folgen einer Infektion nach einer Alkoholvergiftung. So genial sein militärisches Vermögen auch gewesen sein muss, der Umgang mit ihm dürfte schwierig gewesen sein. Ihm werden Tobsuchtsanfälle nachgesagt, bei denen er durchaus zur Waffe gegriffen haben soll. Er soll übermäßig Alkohol getrunken haben, was zum allmählichen Verlust der Selbstkontrolle geführt haben könnte. Alexander ist beiden Geschlechtern zugewandt gewesen und hat zu einer übertriebenen Selbstdarstellung geneigt. Aber die Bedeutung Alexanders „des Großen“ geht weit über seine Eroberungsfeldzüge hinaus. Durch ihn sind mehr als 70 Städte („Alexandria“) gegründet, neue geopolitische Räume erschlossen, Handel und Verkehr erweitert worden. Griechische Sprache und Kultur haben sich verbreitet. Eine Epoche des „Hellenismus“ wird eingeleitet, die erst durch das Römische Imperium rund zwei Jahrhunderte später beendet werden sollte.
In Persien hat Alexander eine Massenhochzeit zwischen Griechen und Persern ausgerichtet. So erstaunlich das für einen Krieger und Feldherrn auch klingen mag, es ist die logische Konsequenz einer Überzeugung gewesen, die Alexander mit seinen Truppen in die Welt hinausgetragen hat. Er hat an die Verschmelzung der griechischen und der orientalischen Kultur, die er ebenso bewundert hat wie seine eigene, geglaubt. Die Folgen dieses „Hellenismus“ sind bis heute zu spüren. Mit den Eroberungen Alexanders beginnt einerseits eine Durchdringung der griechischen Welt mit Einflüssen des Orients, wie andererseits eine Hellenisierung des Morgenlands zu bemerken ist. Erst mit dem Vordringen der islamischen Religion rund 1.000 Jahre später werden die griechischen Spuren eingedämmt und schließlich weitgehend verdrängt. Die griechische Sprache bleibt Jahrhunderte lang Amtssprache in Kleinasien, Ägypten oder Syrien. Auch als das griechische Reich Teil des Imperium Romanum geworden, haben die Römer klug gehandelt und den Griechen eine weitgehende kulturelle Autonomie belassen. Mehr noch: Unter den gebildeten Römern ist es Usus gewesen, Sprache und Literatur der Griechen zu beherrschen.
Der „Hellenismus“ prägt aber nicht nur Kultur und Sprache, sondern hat auch großen Einfluss auf die Religionen, die sich einige Jahrhunderte später entwickeln werden. Ganz besonders das Judentum und in dessen Gefolge auch das Christentum weisen deutliche hellenistische Spuren auf. Der spätere Apostel Paulus von Tarsus (ca. 20 v. Chr. – 64) ist ursprünglich ein griechisch gebildeter und hellenisierter Jude. Er spricht und missioniert in griechischer Sprache, später wird griechisch die Sprache des Neuen Testaments werden. Und damit finden sich die Ausläufer des „Hellenismus“ in Form einer Bibel in den Nachtischen guter Hotels in der ganzen Welt und das rund 24 Jahrhunderte später!
Nach Alexanders Tod verfällt Griechenland ins Chaos, weil die griechische Reichseinheit den Interessen Einzelner geopfert wird. Es beginnt die Zeit der Nachfolgekämpfe, aus denen so genannte „Diadochenreiche“ entstehen, von denen Ägypten die größte Bedeutung erlangt. Die Griechen reiben sich – wie so oft in ihrer wechselvollen Geschichte - in Bruderkämpfen auf und haben nach der Zerstörung Karthagos und Korinths am Ende des 3. Punischen Krieges 146 v. Chr. den Römern nichts mehr entgegen zu setzen. Griechenland wird als römische Provinz einem Statthalter Roms unterstellt. Die Freiheit der Helenen ist eingeschränkt, aber ihre Kultur lebt im Imperium Romanum weiter und beeinflusst erst die römische und dann die europäische Kultur.