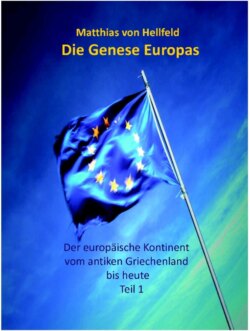Читать книгу Die Genese Europas - Matthias von Hellfeld - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Philosophen-Trias
ОглавлениеDiese drei Philosophen gehören zusammen, denn der eine ist Lehrer des anderen: Sokrates unterrichtet Platon, der wiederum Aristoteles zum Schüler hat. Sokrates (469 – 399 v. Chr.) lebt zur Zeit der Entstehung der attischen Demokratie und des Peloponnesischen Krieges. Er ist von dem Wunsch angetrieben, die seiner Meinung nach moralisch verkommene Elite Athens „regierungsfähig“ zu machen. Dazu entwickelt er ein Prinzip, das ihn bei seinen Zeitgenossen zu einem Nerv tötenden Besserwisser gemacht haben muss. Er stellt nämlich alles in Frage, was sein Gegenüber als vermeintlich gesichertes Wissen im Kopf hat. Er zerstört erst das Wissen des Anderen, um es anschließend streng nach den Regeln der Logik wieder aufzubauen. Dadurch – so hofft er - würde der Mensch in die Lage versetzt werden, die Welt wahrzunehmen wie sie wirklich ist. Anschließend sei der Mensch befähigt, selbständig zu denken und zwischen falschem und richtigem Handeln zu unterscheiden. Es ist ein Dreiklang, der die Unterhaltung mit Sokrates aus- und manchmal auch schwierig macht: Auf die Verunsicherung folgt die Zerstörung, die durch einen Wiederaufbau behoben wird. In diesem Prozess des selbständigen Denkens sieht sich Sokrates als „Geburtshelfer des neuen Wissens“.
Sokrates hat nichts Schriftliches hinterlassen. Wir wüssten vermutlich wenig über ihn, wenn Platon (428 – 348 v. Chr.) sein Werk nicht fortgeführt und die Gedanken seines Lehrers festgehalten hätte. Nach dem Tod von Sokrates, der wegen Knabenliebe und „Gotteslästerung“ zum Gifttod durch den „Schierlingsbecher“ verurteilt worden ist, versucht sich Platon erfolglos in der Politik. Anschließend gründet er eine dem Akademos, einem frühen Sagenhelden Athens, gewidmete Hochschule, an die bis heute die modernen „Akademien“ erinnern. Im Gegensatz zu Sokrates ist Platon offenbar ein angenehmer Zeitgenosse, der darüber hinaus die Philosophie der kommenden Jahrhunderte regelrecht vorprogrammiert hat. In seinem berühmt gewordenen „Höhlengleichnis“ sitzen Menschen in einer Höhle, in der hinter ihrem Rücken ein Feuer flackert. Zwischen ihnen und dem Feuer bewegen sich reale Gestalten, die Menschen aber sehen nicht die Realität, sondern nur die schwankenden Schatten an der gegenüberliegenden Wand, die sie für real halten und als Wirklichkeit definieren. Platon teilt so die Realität in eine Welt der Ideen und eine Welt der Erscheinungen und begründet damit sowohl die Metaphysik als auch den Idealismus. Also: was ist dahinter, gibt es einen Sinn, dass die Welt so ist wie sie ist und: die Wirklichkeit ist eigentlich geistig-ideeller Natur.
Aber Platons Beschäftigung mit der Wirklichkeit bringt auch ein politisches Konzept hervor, das viele Jahrhunderte später wieder diskutiert werden sollte. Sein „Idealstaat“, den er in seiner Schrift „Politeia“ beschreibt, ist zwar eine Utopie, aber er formuliert darin eine Erziehungsdiktatur zum Wohle des Staates. Im platonschen „Idealstaat“ gibt es weder Eigentum noch Familien. An deren Stelle treten ein eugenisches Ausleseverfahren und ein diktatorisches Erziehungsprogramm. In genau festgelegten Schritten werden die Menschen zwangsweise gebildet, bis sie nach dem Militärdienst mit etwa 20 Jahren aussortiert werden. Die Hochbegabten durchlaufen fortan eine wissenschaftliche Ausbildung, die anderen bekommen niedere Arbeit zugewiesen oder gehen zum Militär. Die Ausbildung geht bis zum 50. Lebensjahr, anschließend ist die „Elite der Besten“ geeignet, staatliche Führungsämter zu übernehmen. Das ist die konsequent zu Ende gedachte Idee von Sokrates, der eine Elite bilden wollte, die den Staat zum Wohle aller führen kann. Platon aber geht weit darüber hinaus und unterzieht der attischen Demokratie mit seinem Konzept einer vernichtenden Kritik wie es Egon Friedell wohl nicht zu Unrecht beschrieben hat.
Der Dritte im Bunde der großen griechischen Philosophen ist Schüler an der platonschen Akademie gewesen. Mit sieben Jahren beginnt Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) dort sein 20jähriges Studium, anschließend wird er Lehrer eines Jugendlichen, der die antike Welt gehörig durcheinander bringen sollte: Alexander III., später mit dem Beinamen „der Große“ (356 – 323 v. Chr.) geehrt, Sohn des makedonischen Königs Philipp II. (382 – 336 v. Chr.) Als jener Alexander zu seinem Jahre dauernden Feldzug gegen die Perser aufbricht, kehrt Aristoteles nach Athen zurück und gründet 334 v. Chr. das Lyzeum. Er erweitert Platons Unterteilung zwischen Ideen und Erscheinungen, in dem er von Form und Stoff spricht. Bei Aristoteles gibt es nicht mehr zwei voneinander getrennte Welten, sondern beide Elemente befinden sich in der gleichen Welt. So wie aus dem Marmorklotz unter den Hammerschlägen des Bildhauers eine monumentale Figur werden kann, so verwandelt sich das Unbestimmte ins Bestimmte. Dieses Prinzip kann auf alles angewandt werden, was das reale Leben ausmacht: Aus Tönen wird Sprache, aus Sprache werden Worte, aus Worten werden Gedichte und so weiter. Damit begründet Aristoteles die Logik.
Sokrates, Platon und Aristoteles haben das abendländische Denken bis in unsere Tage beeinflusst. Mitunter wird behauptet, die heutige Philosophie bestehe eigentlich nur aus Fußnoten zu den griechischen Philosophen. Das ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber dennoch: Nach wie vor kommt keine philosophische Denkrichtung ohne Rückgriff auf einen der drei großen griechischen Denker aus. Ihre Ideen sind ein Kulturerbe, das die Europäer seither begleitet und bereichert, auch wenn nicht alle Vorstellungen geeignet sind, die heutige moderne Welt nachvollziehbarer zu machen.
In anderen wissenschaftlichen Gebieten hat die griechische Antike ebenfalls tiefe Spuren hinterlassen. Die Mathematik wäre ohne die Erkenntnisse des Pythagoras von Samos (570 – 510 v. Chr.), der den Beweis einführt, wohl immer noch eine Ansammlung von Vermutungen. Thales von Milet (624 – 546 v. Chr.) gelingt es im 6. Jahrhundert vor Christus die Sonnenfinsternis exakt vorherzusagen. Und schließlich verdanken wir dem Geographen Eratosthenes von Kyrene (276 – 194 v. Chr.) eine Erkenntnis, die noch viele Jahrhunderte verschwiegen wird. Er findet nämlich heraus, dass die Erde eine Kugel ist. Sie alle haben ihre Spuren in den Naturwissenschaften hinterlassen, ihre Einsichten haben Eingang gefunden in die Schulbücher unserer Zeit. Ihr Wirken ist im besten Sinne des Wortes nachhaltig!