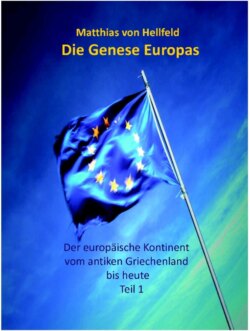Читать книгу Die Genese Europas - Matthias von Hellfeld - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Europa“ in der griechischen Antike
ОглавлениеWährend sich auf den Schlachtfeldern das Schicksal Griechenlands entschieden hat, sucht die Geschichtsschreibung jener Jahre der Auseinandersetzung mit den Persern einen Sinn oder einen Mythos zu geben. Der für die Perserkriege wichtigste antike Chronist ist Herodot (480 – 425 v. Chr.). Er gilt als einer der Urväter der griechischen Geschichtsschreibung. Bis weit ins Mittelalter hinein hat er das Wissen der Menschen über die Antike geprägt. Herodot hat den griechischen Freiheitskampf überliefert, von ihm stammen die meisten Informationen, mit denen die Geschichtsschreibung jedoch äußerst vorsichtig umgeht. Dennoch spiegelt sein Werk das Denken und die Ideologie jener Jahre. Europa, so hat er geschrieben, sei so lang wie Libyen und Asien zusammen. Man wisse nicht, ob Europa von Meeren umgeben sei und wer dem Kontinent den Namen gegeben habe. Vermutlich gehe der Name auf „Europa von Tyros“ zurück, die von Phönizien nach Kreta gekommen sei. Die Überlieferung des Namens „Europa“, der sich Herodot in Ermangelung einer Alternative angeschlossen hat, geht auf eine Sage zurück, die Hesiod überliefert hat. Danach ist die phönizische Prinzessin „Europa von Tyros“ durch den zum Stier verwandelten Göttervater Zeus von Tyros – im heutigen Libanon - nach Kreta entführt worden. Dort habe sie bei der Namensgebung des Kontinents Patin gestanden. Dieses folgenschwere Ereignis soll sich in der Bronzezeit rund 7.000 Jahre vor der Geburt Christi zugetragen haben. Wahrscheinlicher ist, dass sich der Name Europa aus dem phönizischen Begriff „erebu“ für das „Land im Westen“, wo die Sonne untergeht, herleitet.
Herodot hat sich sehr intensiv den ideologischen Gründen für den Krieg mit den Persern, deren Augen- und Zeitzeuge er gewesen ist, gewidmet. Bei ihm wird Europa zum politischen Kampfbegriff, denn er hat die Ursache der Kriege in der Auseinandersetzung zwischen „Freiheit und Demokratie“ auf der einen und „Despotismus“ auf der anderen Seite gesehen. Freiheit und Demokratie sind für Herodot identisch mit Europa, Despotismus charakterisiert Asien. Um seine Behauptung zu belegen, führt er an, in Athen müsse sich jeder Machthaber kontrollieren lassen, was nach den verschiedenen Verfassungsreformen zumindest nicht völlig falsch ist. In Persien hingegen würden die Despoten von niemandem kontrolliert. Zum ersten Mal wird durch Herodot die damals bekannte Erde in zwei sich diametral gegenüberstehende Hälften geteilt: Asien und Europa. Und Herodot bildet obendrein das ideologische Gegensatzpaar: Freiheit gegen Knechtschaft!
Herodot markiert in seinen Texten neben der politischen auch eine kulturelle Trennlinie zwischen Europa, das für ihn hauptsächlich Griechenland gewesen ist, und Asien, am gegenüberliegenden Ufer der Ägäis. Mit dieser Deutung hat er ein „Urteil“ in die Welt gesetzt, das aus der Sicht der Zeitgenossen vielleicht nachvollziehbar gewesen ist. Für Herodot hat der persische König nämlich die griechische Lebensweise angegriffen, die Errungenschaften der Demokratie in Frage gestellt und nach der Macht auf dem europäischen Kontinent gegriffen. Die Verteidigung der Griechen gegen die Perser ist damit vielmehr als „nur“ ein Krieg wie jeder andere gewesen. Bei Herodot ist es auch ein Krieg der Systeme, die Auseinandersetzung der Kulturen und der Kampf ums Überleben Griechenlands und damit auch Europas gewesen. Herodot stempelt mit seiner Deutung indirekt das persische Volk ab, er negiert ihre kulturellen Leistungen und den großen Mut, mit dem sich die Kämpfer in unbedingter Treue für den persischen König geschlagen haben. Insofern also ist Herodots Urteil ziemlich einseitig, aber es spiegelt die Meinung seiner Zeit wider. Sein Urteil ist in der Welt geblieben und wird - zum Vorurteil mutiert - immer wieder gegen „asiatische Horden“, „Hunnen“ oder „Steppenbewohner“ angewendet. Herodot hat damit etwas vorgegeben, was bei der Identitätsfindung der Europäer noch sehr oft zu beobachten sein wird: Identität entsteht durch die Negierung von etwas anderem. Auch bei Herodot entwickelt sich die Identifikation mit Demokratie und Freiheit durch die Gegenüberstellung mit dem despotischen Gegenteil. Ohne die Kriege gegen die Perser hätte es diesen Selbstfindungsprozess im antiken Griechenland vielleicht nicht gegeben. Jedenfalls ist die erfolgreiche Verteidigung ihrer griechischen Heimat zum europäischen Mythos geworden ist.
Bis in die Mitte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts haben die Griechen von Europa also zunächst eine mythische Vorstellung – nämlich die der von Zeus nach Kreta verbrachten phönizischen Prinzessin. Dann ist eine vage geographische Idee von Europa als einem Raum zwischen spanischer Südküste und Schwarzem Meer hinzugekommen. Bei Herodot tritt eine dritte Vorstellung hinzu: Europa als Identitätskategorie, die aus griechischer Sicht das Eigene gegenüber den asiatisch-persischen Feinden abgrenzt. Eine etwas andere Variante dieser Vorstellung findet sich bei dem als Arzt berühmt gewordenen Hippokrates von Kos (460 – 370 v. Chr.). Nach Monika Franz hat er den Europäern „Mut, Liebe zu Freiheit und Angriffslust“ zugesprochen, während er den Asiaten „Begeisterung für den Krieg und die Kunst“ sowie „Weichheit und Antriebslosigkeit“ zuschreibt. Als Ursache für diese merkwürdige Unterscheidung führt der Arzt die klimatischen Bedingungen an, die nach seiner Ansicht prägend für die jeweiligen Charaktere seien. Aus der mythologischen Europavorstellung ist binnen relativ kurzer Zeit ein Kampfbegriff geworden, der die eigenen Lebensvorstellungen überhöht und die der anderen verteufelt.