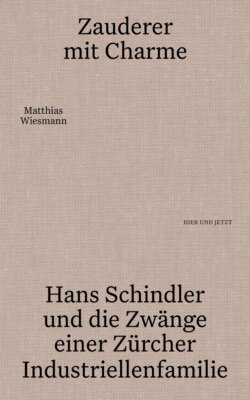Читать книгу Zauderer mit Charme - Matthias Wiesmann - Страница 17
Wenig Harmonie unter den Geschwistern
ОглавлениеZur oft angespannten Stimmung im Haus trugen auch die unaufhörlichen Zankereien unter den Geschwistern Dietrich (Dieter), Gertrud (Trudy), Werner und Hans bei. Die Differenzen legten sich auch im Erwachsenenalter nicht. Gemäss Hans Schindler hatte nur die drei Jahre ältere Schwester Gertrud den dominanten Charakter des Vaters geerbt. Sie habe aber die Herrschaft über andere Menschen in sehr konziliante Formen zu kleiden gewusst. Nach ihrer Ausbildung zur Krankenschwester am Kinderspital Zürich hatte sie den Wunsch, in einer Umgebung zu wirken, in der sie niemand kannte. Das Leben in der Upperclass gefiel ihr nicht, so ihre Tochter in einer Erinnerungsschrift. Sie ging unter anderem als Sozialhelferin in eine ärmliche Gegend von Chicago. 1921 heiratete sie den Arzt Theodor Haemmerli und führte mit ihm die Clinique Valmont in Glion. Zurück in Zürich engagierte sie sich stark für Frauenanliegen. So gründete sie unter anderem den Verein Mütterhilfe, war am Aufbau des Zivilen Frauenhilfsdiensts in Zürich beteiligt und von 1942 bis 1946 Präsidentin des Schweizerischen Zivilen Frauenhilfsdiensts. Sie präsidierte von 1947 bis 1954 die Frauenzentrale Zürich, später den Bund Schweizerischer Frauenvereine, war in den 1950er-Jahren in der Direktion des Schweizerischen Roten Kreuzes und half 1958 bei der Schweizerischen Ausstellung für Frauenarbeit mit. Offensichtlich war Getrud Haemmerli-Schindler eine Führungspersönlichkeit, wie Hans Schindler sie vielleicht gerne gewesen wäre oder zumindest hätte sein sollen, wenn es nach seinem Vater gegangen wäre.
«Bruder Dietrich war der intelligenteste, er rettete sich aus dem Herrschaftsbereich des Vaters, indem er eine akademische Laufbahn ergriff», schreibt Hans Schindler über seinen ältesten Bruder. Dietrich hätte auf Wunsch der Eltern als ältester Sohn die Nachfolge seines gleichnamigen Vaters in der MFO antreten sollen. Sie schickten ihn deshalb in die gymnasiale Industrieschule. Statt anschliessend an der ETH zu studieren, entschied er sich jedoch für die Juristerei, was ihn neben Zürich zwischenzeitlich auch an die Universitäten von Berlin und Leipzig brachte. Für seinen kleineren Bruder Hans öffneten die Briefe aus Deutschland damals den Blick in die grosse Welt und waren ein «Erziehungsmittel». Sie liessen in ihm den Wunsch aufkommen, später ebenfalls ins Ausland zu gehen. Trotz dieser ersten kleinen Flucht trat Dietrich Schindler 1916 in die MFO ein und war vor allem in Genf und in Frankreich mit rechtlichen Fragen beschäftigt. Er fand aber keine innere Befriedigung und konnte sich mithilfe seines Onkels Max Huber endgültig von seinem Vater und der Firma lösen. Dietrich Schindler wurde schliesslich Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, später kamen Völkerrecht und Rechtsphilosophie dazu. Er verfasste Gutachten zur Neutralitätspolitik der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und nahm 1946 als Delegierter an den Verhandlungen zum Washingtoner Abkommen teil. In seinem Tagebuch beklagt er sich bitter über seine Eltern. Sie seien «so ungesellschaftlich als möglich» gewesen und hätten den Umgang mit anderen Menschen nicht gefördert. Er habe deshalb «die zürcherische Knorzigkeit» nicht überwinden können, und seine emotionalen Anlagen seien nicht vollständig entwickelt. Dies dürfte wohl auch auf seinen Bruder Hans zugetroffen haben, der aber mit seiner charmanten Art diese Defizite überdecken konnte.
Mit dem sehr sensiblen Bruder Werner, der nur ein Jahr älter war, hatte Hans Schindler später am meisten zu tun, weil auch er sich später in die MFO «einspannen liess», wie Hans Schindler es ausdrückte. Er litt allerdings stark darunter, dass er von seinem Vater nie voll anerkannt und Hans ihm vorgezogen wurde. Werner Schindler machte eine kaufmännische Ausbildung und reiste ganz im Sinne von Lehr- und Wanderjahren längere Zeit durch Europa, Nord- und Südamerika. Er war sehr belesen und fühlte sich besonders zu theologischen und philosophischen Werken hingezogen.
Die Geschwister wuchsen in einer sehr frommen Umgebung auf. Insbesondere Grossmutter Elise Schindler-Escher und ihre Schwester Pauline Escher wirkten mit einem gewissen missionarischen Eifer. Vor allem die Töchter und Schwiegertöchter litten unter der «Mischung aus Zwängerei und Frömmigkeit». Hans Schindler erinnert sich, wie er und die anderen Enkel jeweils am Mittwochnachmittag in der Villa «zum oberen Engenweg» (heute: Gemeinschaftszentrum Schindlergut) versammelt wurden, um im grossen Garten oder in der hinteren Stube zu spielen. Die Stimmung glich derjenigen eines «patriarchalen Gutsbetriebs». Abends mussten sie Körbe voller Sauerkraut und missionarische Zeitschriften nach Hause tragen. Grosstante Pauline Escher finanzierte noch im hohen Alter einen Kirchenbau der orthodoxen Minorität Unterstrass, einer evangelikalen Gemeinschaft, die sich für eine wortgetreue Auslegung der Bibel einsetzte. Der Bekanntenkreis der Familie bestand standesgemäss nur aus Protestanten, Katholiken waren wenig angesehen: «Der Katholizismus ist recht für Dienstmädchen», soll der Vater stets gesagt haben. Die Ansichten im Haus der Grosseltern Huber waren offener und sehr liberal. Peter Emil Huber beschäftigte sehr viele Juden in seinen Unternehmen. Von dem damals grassierenden Antisemitismus und Nationalismus war nichts zu spüren. Seine Frau, Anna Marie Huber, war Gründungspräsidentin des Frauenvereins für Mässigkeit und Volkswohl (später: Zürcher Frauenverein), der sich unter der Ägide von Susanna Orelli-Rinderknecht mit dem Betrieb von alkoholfreien Kaffeestuben für die Verbesserung der Volksgesundheit und für die Besserstellung der Frau in gastgewerblichen Berufen einsetzte.