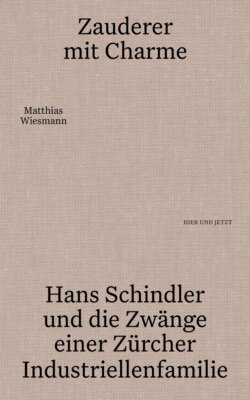Читать книгу Zauderer mit Charme - Matthias Wiesmann - Страница 24
Führungsvakuum im Gemischtwarenladen
ОглавлениеNur ein Jahr nach seinem Rücktritt als Generaldirektor starb Dietrich Schindler 1936. Die MFO aber befand sich fortan in einem strukturell bedingten Führungsvakuum. Hans Schindler war zwar in die Stellung seines Vaters nachgerückt, doch er führte die Direktion weder formell noch faktisch. Die Unterstellungs- und Verantwortungsverhältnisse waren sehr unübersichtlich. Drei von vier Direktoren trugen formell noch den Titel eines Vizedirektors. Zudem waren sie laut Anstellungsvertrag eigentlich direkt dem Verwaltungsrat unterstellt. Die 1939 vorgenommene Analyse der Unternehmens- und Betriebsführungsebene brachte diese Führungsprobleme klar zum Ausdruck. Als Reaktion wurden die fehlenden Managementfunktionen aufgebaut. Dazu gehörte ein Kontrollapparat mit Kostenrechnungs- und Budgetierungssystem, der dem Direktionsbereich von Werner Schindler mit Einkauf und Finanzen angegliedert wurde. Er konnte sich allerdings mit diesen Controlling-Instrumenten nie richtig anfreunden. Bei der Verkaufsdirektion richtete man ein Büro für Marktforschung ein, um eine systematische Analyse einzelner Produkte vorzunehmen. Die wichtigste Neuerung aber war die Schaffung einer Managementfunktion Personal, die mit Rudolf (Rudi) Huber besetzt wurde, dem Enkel des Gründers Peter Emil Huber und Sohn des Verwaltungsratspräsidenten Max Huber. Rudolf Huber hatte am MIT in Boston Betriebswirtschaft studiert und Einblick in amerikanische Unternehmen erhalten. Er legte besonderen Wert auf die Einführung einer lebendigen und attraktiven Betriebsgemeinschaft und auf gewisse Mitsprachemöglichkeiten des Personals.
Die Analyse des Betriebs ergab noch ein anderes Problem: Die MFO war mit ihrer Produktpalette viel zu breit aufgestellt. Doch welche Sparte sollte man aufgeben? Hans Schindler stellte gegenüber dem Verwaltungsrat fest, dass «alle unsere Branchen [Abteilungen] eigentlich gleich schlecht» seien. Nichtsdestotrotz hatte man sich in allen Bereichen grosses technisches Können angeeignet, das man nicht einfach wieder hergeben wollte. In den Hauptabteilungen Elektrische Kraftzentralen und Elektrische Traktion waren eine Vielzahl von Einzelprodukten notwendig, die eng miteinander verknüpft waren. Die Abteilung Transformatoren und Kleinmotoren erzielte einen konstanten Inlandsabsatz und damit eine wertvolle Grundauslastung. Es kam letztlich nur zu kleinen Flurbereinigungen, indem etwa der Kranbau aufgegeben wurde. War ein Artikel nicht mehr leistungsfähig, sollte er nicht fallen gelassen, sondern durch Weiterentwicklung wieder konkurrenzfähig gemacht werden. Zudem galt es, neue Absatzgebiete und neue Anwendungen zu finden. Der Reduktionsversuch scheiterte in dieser Phase und auch später am Widerstand der Direktbetroffenen. Die Durchsetzung hätte eine sehr harte unternehmerische Hand bedingt, die weder in der Geschäftsleitung noch im Verwaltungsrat vorhanden war. Die zögerliche Haltung spiegelt aber auch das Grundproblem der MFO zu dieser Zeit wider: Die Firma stand technisch in keinem Bereich an der absoluten Spitze, und sie konnte sich nirgends als klare Preisleaderin positionieren. Es fehlten also die Verkaufsschlager, deren Forcierung bei der Aufgabe einiger anderer Produkte eine Umsatzreduktion hätte kompensieren können.
Tat sich die Geschäftsleitung schwer, wären Impulse vom Verwaltungsrat umso nötiger gewesen. Mit Max Huber war das Präsidium allerdings mit einem Mann besetzt, der die Reorganisationsbemühungen zwar unterstützte, jedoch keine neuen Ideen und Konzepte einbrachte. Er beschränkte sich auf die moderierende Rolle des väterlichen Beraters der Unternehmensleitung, die mit drei jungen Familienmitgliedern, seinem Sohn und zwei Neffen, besetzt war. 1944 übernahm mit Alfred Stahel-Hanhart ein Aussenstehender das Verwaltungsratspräsidium. Er starb allerdings bereits 1946 und konnte so wenig bewirken.
Der allgemeine Geschäftsgang der MFO zog nach 1935 wieder etwas an, jedoch konnten bis 1938 keine Dividenden ausgezahlt werden. Erst der Kriegsausbruch liess die Anzahl Bestellungen deutlich ansteigen. Die Produkte der MFO waren während des Zweiten Weltkriegs gefragt, da viele ausländische Fabriken kriegsbedingt ihre Produktion einstellen mussten. Zudem mussten zerstörte Infrastruktur im Bereich der Elektrizitätsproduktion und -verteilung, aber auch defekte Lokomotiven, die für den Transport von Menschen und Gütern von herausragender Bedeutung waren, ersetzt werden. Der zeitweilige Wegfall der alliierten Länder als Exportdestinationen konnte gut mit dem Inlandsabsatz aufgefangen werden: Die Modernisierung der Kraftwerke, die Elektrifizierung der Haushalte und der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in der Schweiz schritten trotz des Kriegs weiter voran. Problematisch war die durch den Militärdienst bedingte häufige Abwesenheit des Personals. Die Materialversorgung der Fabrik konnte dank der Handelspolitik des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements weitgehend sichergestellt werden. Daneben sammelte man Alteisen, um es einzuschmelzen und wiederzuverwerten, ersetzte Kupfer teilweise durch Aluminium und überliess die Beschaffung von Dynamoblechen und Kupfer den ausländischen Kunden.
Insgesamt kam die MFO gut durch den Krieg, viele strukturelle Probleme blieben allerdings ungelöst. Das Sortiment war zu breit und bestand zudem aus Einzelanfertigungen auf Kundenwunsch. Serienprodukte gab es nicht. Hinzu kamen Schwierigkeiten mit langen Lieferfristen und zu tief angesetzten Preisen, die am Schluss die Kosten nicht deckten. Als Firma mit einem weltumspannenden Marktgebiet war man mit einer einzigen zusätzlichen Produktionsstätte in Frankreich ausserordentlich schwach internationalisiert. Gerade bei Staatsaufträgen, wie sie im Bereich der Energiegewinnung und -verteilung sowie der Bahninfrastruktur üblich waren, ergab sich daraus ein grosser Nachteil: Der Staat bestellt lieber bei einheimischen Produzenten. Umso dringender erschien es Hans Schindler, den Exportmarkt China frühzeitig zu beackern, noch bevor im September 1945 auf der ganzen Welt die Waffen endlich schwiegen.
MFO-Generator in Innertkirchen als Sujet auf einer Ersatznote der Schweizerischen Nationalbank. Entwurf: Hans Erni, 1941.
Die Ehepaare Hans und Ilda Schindler sowie Rudolf und Bausi Huber zusammen mit Max Huber am MFO-Landitag, 1939.