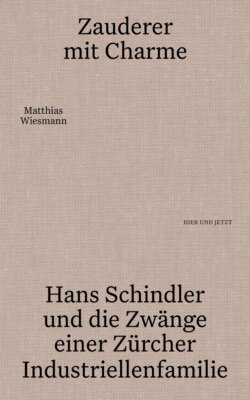Читать книгу Zauderer mit Charme - Matthias Wiesmann - Страница 22
Dem Generaldirektor und Vater «beigegeben»
ОглавлениеHans Schindler trat 1925 auf Wunsch des Vaters und nach einem mehrwöchigen Praxistest beim französischen Ableger in Ornans ins Mutterhaus in Oerlikon ein. Vorerst arbeitete er als Chemiker in der Entwicklung von elektrischen Wasserzersetzern. Diese Elektrolyseure zerlegten mithilfe von Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. 1928, mit 32 Jahren, wurde er Adjunkt der technischen Direktion. Es war auch das Jahr, in dem er Ilda Baumann heiratete. Als Adjunkt beschäftigte er sich unter anderem mit Fragen der Organisation und des Absatzes im In- und Ausland. Sein Bruder Werner war bereits etwas früher als Hans ins Unternehmen eingetreten und setzte sich vor allem mit finanziellen Fragen auseinander. Als Prokuristen nahmen beide ab Ende der 1920er-Jahre auch immer öfter an Direktionssitzungen teil, insbesondere Hans Schindler in der Funktion als Protokollführer.
Werbeanzeige der MFO in der Romandie, 1901.
Nach dem Ausscheiden von Generaldirektor Hans Behn-Eschenburg und dessen Wechsel in den Verwaltungsrat war Dietrich Schindler alleiniger Generaldirektor. Der bisherige Leiter der französischen Tochtergesellschaft in Paris, F. E. Hirt, wurde 1929 zum Verkaufsdirektor ernannt. Er sollte als Verbindungsmann zwischen Verkauf, Konstruktion und Werkstätten eingesetzt werden. Dietrich Schindler gab damit zur Entlastung die Leitung der auswärtigen Verkaufsgesellschaften und Vertretungen ab, behielt aber die Oberleitung über das Gesamtunternehmen. Nachdem der Direktor der Fabrikation altershalber und der technische Direktor nach einem Konflikt mit Dietrich Schindler zurückgetreten waren, festigte Schindler seine Alleinherrschaft. Die beiden Abteilungen wurden fortan durch Vizedirektoren geleitet. Diese beiden Vizedirektoren, Jakob Brunner und Arnold Traber, nahmen zusammen mit Direktor F. E. Hirt und den beiden Schindler-Brüdern ab 1931 in einem neu geschaffenen Direktionskollegium Platz. Sie berieten abteilungsübergreifende Angelegenheiten und tauschten sich mit Generaldirektor Schindler aus. Als ebenbürtig in geschäftlichen Fragen sah Dietrich Schindler allerdings nur den Verwaltungsrat an, die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Direktionskollegiums war marginal. Hans Schindler wurde «der Generaldirektion beigegeben», so der Verwaltungsrat. Er sollte bei Abwesenheit den Generaldirektor ersetzen und als Bindeglied zwischen den Abteilungen fungieren. Die neue Aufgabenteilung lässt erkennen, dass Dietrich Schindler wohl von Hirt als seinem ehemals präferierten Nachfolger abgerückt war und er Sohn Hans direkt als neuen Kronprinzen installieren wollte. Tatsächlich verschärften sich die Konflikte zwischen den beiden dominierenden Figuren der MFO immer mehr, weil Hirt in den Augen von Dietrich Schindler zu selbstständig agierte.
Grossmaschinenbau bei der MFO. Wandbild im Hauptgebäude der ETH Zürich, gemalt von Wilhelm Ludwig Lehmann, 1929.
Die MFO hatte bis Anfang der 1930er-Jahre floriert. Die Belegschaft betrug insgesamt 3400 Personen, davon 2500 Arbeiter in den Werkstätten. Nun traten jedoch erstmals Probleme bei der Einhaltung von Lieferzeiten und bei einer effizienten Organisation der Fertigung auf. Durch die ab 1931 in der Schweiz spürbare Weltwirtschaftskrise wurde die MFO doppelt hart getroffen. Neben dem krisenbedingten Rückgang der Bestellungen waren auch die Auslieferungen der letzten Lokomotiven für das Elektrifizierungsprogramm der SBB ausgelaufen. Es kam zu Lohnsenkungen und Entlassungen. Im ersten Halbjahr 1935 beschäftigte die MFO noch die Hälfte ihrer früheren Belegschaft. Trotz Verlusten wäre genügend Kapital vorhanden gewesen, um den Betrieb zu rationalisieren und konkurrenzfähig zu halten. Es fehlte auch nicht an Vorschlägen der Direktion. Dietrich Schindler stellte sich jedoch quer und sprach sich gegen jede Reorganisation und Investition aus. So wurde beispielsweise die oft geforderte Modernisierung der Kleinmotorenproduktion immer wieder aufgeschoben. Seine Devise zur Überwindung der allgemeinen Wirtschaftskrise war Sparsamkeit und Verringerung der Unkosten. Der Tod seiner Frau 1934 versetzte ihm zusätzlich einen schweren Schlag. Die Kräfte des 78-Jährigen schwanden, und die Gebresten des Alters nahmen langsam überhand. Umso mehr klammerte er sich an die Macht und wollte alles selbst entscheiden.