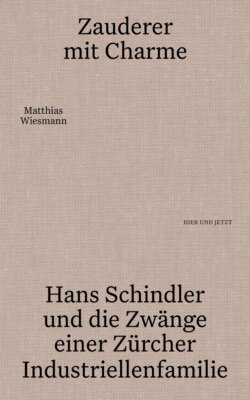Читать книгу Zauderer mit Charme - Matthias Wiesmann - Страница 7
Einleitung
Оглавление«Seine grauen Augen blicken energisch und frisch, und es liegt ein Schimmer in ihnen, der gesunden Menschenverstand und Sinn für Humor verrät.» So beschreibt ein Journalist der Zürcher Woche im August 1954 den 58-jährigen Direktionspräsidenten der Maschinenfabrik Oerlikon (MFO), Dr. Hans Schindler-Baumann. Auf den ersten Blick entsprach der 1896 geborene Industrielle idealtypisch dem Bild eines Angehörigen der Schweizer Wirtschaftselite, wie es noch bis in die 1980er-Jahre vorherrschte. Er war männlich, Schweizer Staatsbürger, Chef eines Grossunternehmens, freisinnig, Milizoffizier, sass in mehreren Verwaltungsräten, hatte sich an der ETH zum Ingenieur ausbilden lassen und Lehrjahre im Ausland verbracht. Privat stammte er aus einer angesehenen Familie, trat die Nachfolge im Unternehmen des Vaters an, heiratete standesgemäss, hatte mehrere Kinder und einen repräsentativen Wohnsitz. Was nach einer erfüllten Berufskarriere, gesellschaftlichem Ansehen und befriedigendem Familienleben aussieht, erweist sich bei genauerer Betrachtung allerdings als konfliktreicher persönlicher Weg. Dieser endete erst mit dem dramatischen Ausscheiden Hans Schindlers aus der operativen Führung der kriselnden MFO 1957 und der äusserst schmerzvollen Scheidung von seiner ersten Frau Ilda Schindler 1959 – zwei Ereignisse, die Hans Schindler rückblickend aber als «Befreiung» aus einem Zwangskorsett empfand.
In welchem Sinn musste sich Hans Schindler befreien? Was spielte sich in seinem Innern ab? Wie erklärte er sich die Schwierigkeiten in beruflicher und familiärer Hinsicht? Er war, so schrieb er später, bis zu einem eigentlichen Neustart im siebten Lebensjahrzehnt ein Gefangener seiner familiären Prägung: «In meinem Leben spielten die vom Elternhaus übernommenen Vorstellungen eine grosse Rolle. Sie hatten ein erstaunliches Beharrungsvermögen. Auslandsaufenthalte, aktive Betätigung im Beruf, Militärdienst in allen Chargen vom Rekruten bis zum Bataillonskommandanten, Heirat, eigene Kinder, all das erweiterte zwar den Horizont, änderte aber wenig an den Vorstellungen über Pflichten, Stellung in der Welt, Erlaubtes und Verbotenes, Verteidigungswürdiges und zu Bekämpfendes. Parallel zum Beharrungsvermögen alter Vorstellungen geht eine akute Blindheit gegenüber Erscheinungen, die nicht zu den alten Vorstellungen passen. Was nicht sein darf, wird ignoriert, abgeleugnet, abgestritten. Ich sündigte in dieser Beziehung schwer, zum Erstaunen von wohlwollenden Leuten, deren Blick ungetrübt von familiären Vorurteilen war.» Erschwerend kam seine generelle Unsicherheit hinzu, die er erst im Alter ablegen konnte. Als veritables Handicap erwies sich aber seine Unfähigkeit, andere Menschen richtig einzuschätzen und sie mit ihren Stärken und Schwächen zu akzeptieren.
Zu seinem 70. Geburtstag schrieb der ehemalige Nationalrat Hermann Häberlin, sein langjähriger Weggefährte im Arbeitgeberverband schweizerischer Maschinen- und Metall-Industrieller (ASM), in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ), dass der ehemalige Präsident des Verbandes, Hans Schindler, «aus weicherem Holz geschnitzt» gewesen sei als sein Vater, der in streng patronaler Manier genau das Gegenteil verkörpert habe. Kurz vor seinem unfreiwilligen Ausscheiden aus der aktiven Unternehmensführung stellte Hans Schindler selbst fest, dass er als Unternehmer wohl zu wenig Härte an den Tag gelegt habe. Was er als scharfe Abgrenzung zu seinem strengen Vater praktizierte, wurde mit der Zeit zu einer schweren Hypothek. Seine Anordnungen wurden im Betrieb mit der Zeit immer weniger ernst genommen, und es mangelte ihm an Durchsetzungskraft und Entscheidungsfreude. Dazu kam das selbst diagnostizierte Fehlen des «Unternehmer-Gens», was die MFO fast ungebremst in eine schwere Krise schlittern liess. Die Reparatur gelang zwar halbwegs ab 1958 unter neuer Führung, doch für ein Überleben im internationalen Markt war der spätere Zusammenschluss der MFO mit der Brown, Boveri & Cie. (BBC) schliesslich unumgänglich.
Was in Künstlerbiografien gerne und oft ausführlich beschrieben wird, ist bei Abhandlungen über die Wirtschaftseliten kaum ein Thema: die Auswirkungen der familiären Situation auf die Karriere. Hans Schindler ist ein Beispiel dafür, wie sehr sich seine alles andere als idealen privaten Verhältnisse auch auf seine berufliche Tätigkeit auswirkten. Sein Cousin Rudolf Huber-Rübel, der mit ihm zusammen die MFO leitete, brachte es in seinen Lebenserinnerungen klar zum Ausdruck: «Schindler […] machte auch seine Familie schwer zu schaffen.» Er sei im Betrieb oft unausgeglichen gewesen. Die fehlende Liebe zwischen Hans Schindler und seiner Frau lastete schwer auf dessen Seele. Dazu kam, dass seine Frau als praktizierende Ärztin und passionierte Bergsteigerin in keiner Weise dem vorherrschenden Bild einer Industriellengattin entsprach. Mit der häufigen Abwesenheit ihrer Eltern und den gleichzeitig hohen Ansprüchen an ihr wohlgeratenes Gedeihen konnten auch die sechs Kinder kaum umgehen. Entsprechend problematisch gestalteten sich ihre Beziehungen zu den Eltern.
Die Verflechtung von Familien- und Firmengeschichte und der persönliche Einblick in das Denken und Fühlen eines Zürcher Wirtschaftsführers aus der Mitte des 20. Jahrhunderts ist vor allem aus einem Grund möglich: Hans Schindler hat von 1945 bis 1957 detailliert Tagebuch geschrieben. Die überlieferten 25 Hefte sind handschriftlich geführt, umfassen insgesamt knapp 3000 Seiten und weisen von wenigen Ausnahmen abgesehen zu jedem einzelnen Tag einen Eintrag auf. Sie erlauben einen fast schon intimen Blick in das Innenleben von Hans Schindler und zeigen seine Sorgen und Nöte auf – in geschäftlicher wie auch in privater Hinsicht. Da das 25. Heft bis zur letzten Seite gefüllt ist und seine Kinder auch spätere Tagebücher gesehen haben wollen, kann man annehmen, dass Hans Schindler im Oktober 1957 nicht aufgehört hat, Tagebuch zu führen. Die späteren Tagebücher sind aber nicht mehr auffindbar. Vermutlich vernichtete sie seine zweite Frau Dora Loppacher nach Hans Schindlers Tod. Sie nahm ab 1958 eine zentrale Rolle in seinem Leben ein und wurde ab diesem Zeitpunkt wohl auch sehr häufig im Tagebuch erwähnt.
Erhalten sind weiter seine Memoiren mit dem bezeichnenden Titel «Überprüfungen» und dem Zusatz «Als Kind und Jugendlicher anfangs des Jahrhunderts im Industriellen-Milieu Zürichs und spätere Erlebnisse». Interessanterweise räumt Hans Schindler der problembeladenen Zeit ab dem Zweiten Weltkrieg bis zu seinem Ausscheiden aus der aktiven Leitung der MFO 1957 nur sehr wenig Platz ein. Ausführlich beschreibt er seine Jugend, seine ersten Jahre bei der MFO und dann wieder die Zeit nach 1958. Zudem unterzieht er sein Leben ganz im Sinne der titelgebenden Überprüfung einer ziemlich schonungslosen Bewertung. Das privat gedruckte Büchlein mit einem Umfang von 69 Seiten gab er «tropfenweise» an Familienangehörige und Freunde ab. Als Gegenstück zu den persönlichen Aufzeichnungen von Hans Schindler standen mir auch Briefe seiner ersten Ehefrau Ilda Schindler zur Verfügung, die sie an ihre Freundin Suzanne – genannt Sus – Öhman-Schwarzenbach, die in Schweden wohnte, geschrieben hatte. Hans Schindler spielt darin allerdings im Gegensatz zur ausführlich geschilderten Entwicklung der Kinder eine Nebenrolle.
Aufgrund der sehr persönlichen und offenen Tagebucheinträge, die thematisch von schweren Auseinandersetzungen mit Familienmitgliedern und Arbeitskollegen über scharfe Selbstanklagen und psychiatrische Behandlungen bis hin zu unerfülltem sexuellem Begehren reichen, stellt sich eine wichtige Frage: Darf man ein Tagebuch, das der Verfasser im Prinzip nur für sich geschrieben hat, als Quelle für eine Publikation benutzen und so den Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich machen? Im vorliegenden Fall sprachen einige gewichtige Gründe für die Verwertung des Materials. Hans Schindler ist seit über 35 Jahren tot, ebenso (fast) alle Hauptpersonen, die im Tagebuch genannt werden. Er und sein Umfeld stehen damit nicht mehr persönlich im Fokus, sondern fungieren als zeittypische Vertreter einer heute in dieser Form untergegangenen Elite. Und hätte Hans Schindler nicht gewollt, dass auch unschöne Dinge aus seinem Leben an die Öffentlichkeit gelangen, hätte er in seiner Autobiografie gewisse Probleme nicht so schonungslos geschildert. Der wichtigste Grund für die Veröffentlichung ist aber sicherlich die Bereitschaft seiner noch lebenden Kinder, dieses einmalige Zeitdokument – auch auf Empfehlung der Wirtschaftshistorikerin Dr. Margrit Müller von der Universität Zürich – interessierten Kreisen zugänglich zu machen. 2017 haben sie die Tagebücher dem Schweizerischen Wirtschaftsarchiv in Basel übergeben und mir im Jahr darauf den Auftrag zum Schreiben dieser Biografie erteilt.
Natürlich stellt sich weiterhin die Frage, ob man allzu Privates nicht weglassen sollte, ob man nicht Gefahr läuft, einem gewissen Voyeurismus Vorschub zu leisten. Doch Schindlers Aufzeichnungen sind so vielseitig und offen, dass es schade wäre, sie zu zensurieren. Der Unternehmer, der in historischen Abhandlungen oft stark hagiografisch gezeichnet wird, erhält hier ein komplexeres Gesicht – Zaudern, Zweifel, gar Verzweiflung gehören dazu, und auch privates und geschäftliches Scheitern werden thematisiert.
Auf den ersten Blick spiegeln die Geschehnisse zwischen 1945 und 1957 ein Bild von Hans Schindler wider, das von einigen Misserfolgen im Unternehmen und persönlichen Schwierigkeiten geprägt ist. Beeindruckend ist aber sein unbändiger Wille, sich selbst und die MFO zu verändern, seine Offenheit, sein Sinn für Humor und seine scharfe Beobachtungsgabe. Immerhin gelang ihm im Alter der Übertritt in eine glücklichere Lebensphase, was seine Krisenjahre in einem versöhnlichen Licht erscheinen lässt – auch im Hinblick auf die zuvor sehr schmerzlichen Konflikte in der Familie, die damals teilweise beigelegt werden konnten. Faszinierend ist seine unmittelbare Zeitzeugenschaft in der Nachkriegszeit. So begegnete er etwa dem sehr erschöpften Winston Churchill bei dessen berühmtem Besuch in der Aula der Universität Zürich, 1949 trat er im Kampf um einen Ständeratssitz gegen Gottlieb Duttweiler an, er machte Bekanntschaft mit der immer stärker in einen sektiererischen Antikommunismus abdriftenden christlichen Bewegung der Moralischen Aufrüstung, er lernte bei seinen vielen Geschäftsreisen in die USA den freizügigen American Way of Life kennen und zimmerte als Arbeitgeberverbandspräsident zusammen mit den grossen Gewerkschaftsführern wie Konrad Ilg insgesamt drei Verlängerungen des Friedensvertrags in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Besondere Kühnheit verlangte aber 1945 eine Reise nach China, das sich immer noch im Kriegszustand mit Japan befand. Dieser riskante Besuch zur ersten Anbahnung von Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und der Schweiz war für Hans Schindler der Anlass, mit dem Schreiben eines Tagebuchs zu beginnen, und soll auch hier dazu dienen, in das turbulente Leben dieses Zürcher Industriellen einzutauchen.