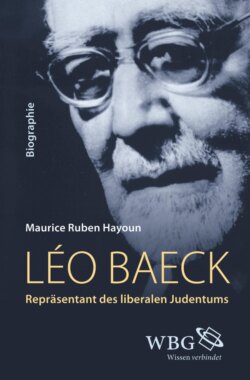Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Mendelssohns Auffassung vom Judentum
ОглавлениеWelche Auffassung vom Judentum vertrat Mendelssohn? Zu Beginn des zweiten Teils des Werkes Jerusalem unterstrich Mendelssohn, dass weder Kirche noch Staat sich das Bannrecht anmaßen dürften. Das Judentum selbst, so sagt er, habe keine Glaubensartikel, sondern eine einfache, geoffenbarte Gesetzgebung. Bei der Offenbarung auf dem Sinai sei es weder um eine Heilslehre noch um ein rationales Prinzip gegangen. „Man hat auf diesen Unterschied immer wenig acht gehabt; man hat übernatürliche Gesetzgebung für übernatürliche Religionsoffenbarung genommen. […] Ein anderes ist geoffenbarte Religion; ein anderes geoffenbarte Gesetzgebung.“ Andernfalls sei der Universalismus des Schöpfers unhaltbar: Wenn ein amerikanischer Indianer nur durch eine Offenbarung und nicht aus eigenen kognitiven Möglichkeiten heraus zur ewigen Glückseligkeit gelangen könne, wäre Gott nicht gerecht gewesen, da ja nur die Kinder Israels von der Theophanie hätten profitieren können. Daher hinge die Glückseligkeit von ewigen Wahrheiten ab, zu denen wir über den Umweg des Verstehens gelangen würden. Mendelssohn weist auch darauf hin, dass die Bibel nirgendwo den Glauben verlangt, sondern lediglich vorschreibt, in gewissem Sinne zu handeln. Da aber in der alten israelitischen Verfassung Staat und Religion eng miteinander verbunden seien, bedeute das Sündigen gegen das eine auch das Sündigen gegen das andere: So sei die Entheiligung des Sabbats gleichzeitig ein Verstoß gegen das Zivilgesetz.
Jedoch hätten die Juden das Recht, über die Gebote ihrer Religion nachzudenken, ohne aber die Befreiung davon anzustreben: Denn bei dem, was Gott vorgeschrieben habe, habe der Mensch nicht das Recht, es zu zerstören. Da er wusste, dass der Staat christlicher Natur und daher kaum unparteiisch sei, verlangte Mendelssohn, dass, wenn die Juden die Gesetze dieses (christlichen) Staates respektieren würden, dieser seinerseits deren eigenes Bestreben gegenüber Gott respektieren solle.
Ein Hauptanliegen Mendelssohns war es zu beweisen, dass das Judentum im Gegensatz zum Christentum keine Dogmen besitzt und deshalb niemals der Vernunft widerspricht. Es musste demgemäß eine Art Naturreligion sein, ausgestattet mit einem rationalen Substrat, zu der eine geoffenbarte, spezifische Gesetzgebung kam, die sich nur an die Kinder Israels richtete. Durch diesen „Zuschnitt“ schaffte es Mendelssohn, gegensätzliche Imperative miteinander zu versöhnen: das spezifisch Jüdische (dieser Begriff ist dem Begriff „partikularistisch“ vorzuziehen) und der Universalismus, der den Anhängern der Aufklärung so immens wichtig war. Das so genannte auserwählte Volk wollte keine Wahrheiten hinstellen, die sein Geist sich selbst erschließen konnte. Es hatte eine Reihe von spezifischen Gesetzen erhalten, durch deren Erfüllung es zur ewigen Glückseligkeit gelangte. Doch die anderen Völker, die dieses Gesetz nicht hatten, weil es ihnen nicht bestimmt war, könnten es schaffen, diese ewigen Wahrheiten zu entdecken, die ihnen den Weg zu derselben Glückseligkeit öffnen würden. Die Botschaft der Theophanie beginnt mit den Worten: „Ich bin der Ewige, dein Gott“, und nicht „das nothwendige, selbständige Wesen, das allmächtig ist und allwissend, das den Menschen in einem zukünftigen Leben vergilt, nach ihrem Thun.“
Wenn die überwiegende Mehrheit der Menschen keine Offenbarung benötigt, um zur ewigen Glückseligkeit zu gelangen, wie soll man dann erklären, dass sie für die Hebräer unerlässlich ist? Genau hier zeigt sich die Brüchigkeit von Mendelssohns Argumentation, wie sie sich auch bei seinem Vorgänger Maimonides gezeigt hatte. Mendelssohn flüchtet sich in den unergründlichen Charakter der göttlichen Weisheit: Es habe der Weisheit Gottes gefallen, dieses Volk mit einer besonderen Gnade zu versehen. Wäre es nicht weiser gewesen, wie die jüdischen Averroes-Anhänger des Mittelalters zu behaupten, die Offenbarung sei so etwas wie ein Mittel, um die ungebildeten Massen zu leiten, indem ihnen „notwendige Glaubensinhalte“ gegeben werden?
Indem er zwischen diesen beiden Wahrheitskategorien unterscheidet, hat Mendelssohn wahrscheinlich eine Idee von Leibniz aufgenommen, der von „Vernunftwahrheiten“ und „Tatsachenwahrheiten“ spricht. Auch hier ist es der Status der Offenbarung, der zur Debatte steht: Ist sie historisch, mit anderen Worten: Hat sie wirklich stattgefunden? Und können wir dem Zeugnis jener glauben, die ein solches Ereignis bestätigen?
Exakt an diesem Punkt versucht Mendelssohn, den Mittelweg in der Haltung jüdischer Denker des Mittelalters zu reflektieren, von Saadya Gaon (gest. 942) bis zu Elijah Delmedigo (gest. 1493). Der erste, der aus einem arabisch-muslimischem Milieu stammte, sprach den Wundern eine apodiktische Wirksamkeit zu, die Maimonides ihnen absprach. Für den Autor des Buches Führer der Verwirrten sind die Wunder in gewisser Weise ein Teil der natürlichen Ordnung, weil sie ja vom Ursprung an in der allgemeinen Ökonomie des Universums vorgesehen waren. Diese Lösung bietet den Vorteil, Anhänger wie Gegner zu befriedigen: Erstere hielten sich an eine bestimmte Auffassung von der göttlichen Allmacht, während letztere das begreifbare Fundament und die Stabilität der Geschöpfe bewahren wollten.
Maimonides (Führer der Verwirrten III, Kap. 15) begann mit seinen Ausführungen folgendermaßen: „Das Unmögliche hat eine feste Natur und kann nicht das Werk eines Handelnden sein.“ Später, in der Renaissance, sollte Elijah Delmedigo den Wundern eine averroistische Interpretation geben: Die Wunder seien eine Art Illusion für die unwissenden Massen. Für Mendelssohn dienen die Wunder nicht dazu, die Wahrhaftigkeit dieser oder jener Lehre zu belegen: Es gebe keinen Beweis durch das Wunder. Tatsächlich ist die Position des Autors unangenehm: Was sagte man zu den von Moses und Aaron vollzogenen Wundern bei der Konfrontation mit dem Pharao? Mendelssohn lässt sich tatsächlich von Maimonides und Leibniz leiten.
Leo Baeck hat die Ideen Mendelssohns über das Judentum studiert, sowohl im orthodoxen Seminar in Breslau als auch in Berlin, in der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums von Abraham Geiger. Er hat die fundamentalen Doktrinen Mendelssohns akzeptiert, mit einer Ausnahme, nämlich den so genannten Zeremonialgesetzen.
Aus der Feder eines jüdischen Denkers mag das überraschen und erstaunen. Zeremonialgesetz ist die deutsche Übersetzung des lateinischen caeremonia, was das hebräische Hukkim (Gesetz, Statut) wiedergeben sollte. Bei seinen Recherchen zum Wesen des Judentums war Mendelssohn sichtlich in Verlegenheit: Sollte man das Judentum auf die Idee beschränken oder auch den religiösen Praktiken einen – wenn auch kleinen – Platz einräumen? Dies war das Dilemma Mendelssohns, der sich in der Folge dazu entschloss, von einer Art unauflöslichem Kern des Judentums zu sprechen, in dem die Lehre autonom und gleichzeitig von einem Gesetzeskörper untrennbar sei. Doch sollte man klar sagen, dass die gelehrten Doktrinen bei den zur Anwendung gebrachten religiösen Gesetzen aus dem Tritt kämen? Mendelssohn war davon überzeugt, ohne diesen Schritt je gegangen zu sein. Zu sagen, dass die Praxis erst an zweiter Stelle käme, wäre für weite Teile der jüdischen Gemeinschaft nicht hinnehmbar gewesen. Einige Beispiele für Zeremonialgesetze: die Beschneidung (Gen 17,9–14), der Sabbat (Ex 31,13), das Begehen von Festen, insbesondere Ostern (Ex 13,9). In den Augen vieler Juden war eine solche Auffassung inakzeptabel.